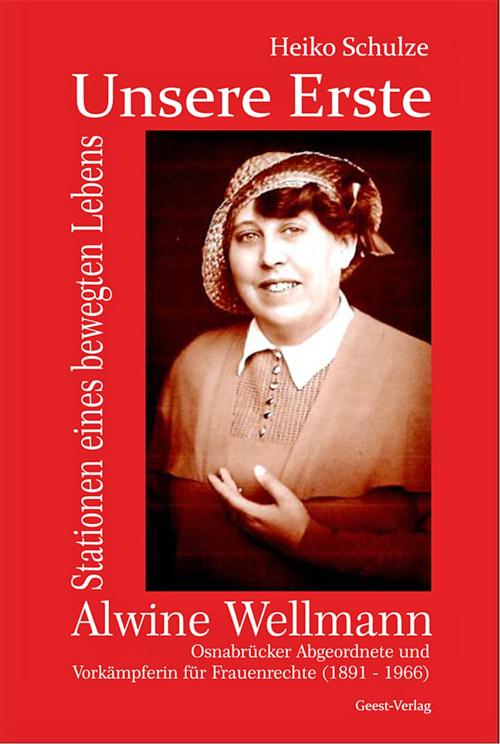Günther Grunert / Walter Tobergte
Die Allgegenwärtigkeit neoliberaler Mythen
Neoliberale Mythen sind allgegenwärtig: Wir brauchen „Reformen“, sonst ist der Wirtschaftsstandort gefährdet; Staatsverschuldung ist schlecht, staatliche Sparsamkeit gut – oder erst jüngst: Die Deutschen müssen mehr arbeiten und weniger Urlaub machen, um die Corona-Kosten wieder hereinzuholen. Bei einigen dieser Mythen liegt es auf der Hand, dass hier interessengeleitete Vorstellungen und Vorschläge mit vermeintlichen wirtschaftlichen Sachzwängen begründet werden, bei anderen Mythen ist weniger offensichtlich, warum sie verbreitet und aufrechterhalten werden. Wir möchten uns in dieser Serie in unregelmäßiger Folge mit beiden Arten neoliberaler Mythen beschäftigen. Grundlage unserer Kritik ist die „Modern Monetary Theory“, eine noch sehr junge Theorie, die seit den 1990er Jahren in den USA und in Australien entwickelt wurde und seit einiger Zeit auch in Europa und Deutschland zunehmend Verbreitung findet. Sie stellt unserer Ansicht nach die weitreichendste und überzeugendste Kritik an der herrschenden neoliberalen Lehre dar.
 Da wir in einem auf Geld und Kredit basierenden Wirtschaftssystem leben, liegt es nahe, sich im ersten Teil der Serie mit der Frage zu beschäftigen, wie Geld und Kredit in die Welt kommen und welche Rolle die Banken dabei spielen. Hier gibt es den weitverbreiteten Mythos, dass Banken nichts weiter als Geldvermittler zwischen Sparern und Kreditnehmern sind.
Da wir in einem auf Geld und Kredit basierenden Wirtschaftssystem leben, liegt es nahe, sich im ersten Teil der Serie mit der Frage zu beschäftigen, wie Geld und Kredit in die Welt kommen und welche Rolle die Banken dabei spielen. Hier gibt es den weitverbreiteten Mythos, dass Banken nichts weiter als Geldvermittler zwischen Sparern und Kreditnehmern sind.
Mythos Nr. 1
So heißt es im Lehrbuch-Bestseller „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre“ von N. G. Mankiw und M. P. Taylor (deutsche Ausgabe 2018, S. 743) und so werden es wohl auch die meisten in der Schule und/oder im Studium gelernt haben. Selbst in fortschrittlichen Lehrbüchern wie dem von H.-J. Bontrup und R.-M. Marquardt, das gerade erst erschienen ist, wird diese Argumentation manchmal übernommen:
„Vereinfacht betrachtet sammeln Banken das überschüssige Geld von Menschen ein, die zu viel davon haben, um es dann denen zu geben, die einen Kredit benötigen“ („Volkswirtschaftslehre aus orthodoxer und heterodoxer Sicht“, 2021, S. 353).
In zugespitzter Form findet sich die Sichtweise auch in der bekannten (nicht ganz ernst gemeinten) „3-6-3-Regel“, nach der Bankmanager arbeiten sollten: Leihe dir das Geld morgens zu 3 Prozent, verleihe es mittags zu 6 Prozent und sieh zu, dass du um 3 Uhr nachmittags auf dem Golfplatz bist.
„Tut uns leid, uns sind die Kundeneinlagen ausgegangen!“
Das mag alles plausibel klingen, nur – es stimmt nicht. Und wenn man etwas genauer darüber nachdenkt, wird man schnell feststellen, dass es so auch gar nicht funktionieren kann. Denn wenn Banken tatsächlich nur reine Geldvermittler wären, die sich Geld von Sparern leihen, um es danach an Kreditsuchende zu verleihen, entstünde ein Problem: Es wäre praktisch unvermeidlich, dass zumindest gelegentlich Engpässe bei den Einlagen auftreten. Die Banken wären also dem Risiko ausgesetzt, dass ihnen das eingesammelte Geld knapp würde. Warum geschieht das in der Realität nicht? Oder kennt jemand den Fall, dass eine Bank einem ihrer Kunden einen Kredit mit den Worten verweigert hat:
„Es tut uns aufrichtig leid, aber wir können Ihnen momentan keinen Kredit geben, obwohl wir Sie für uneingeschränkt kreditwürdig halten. Bei uns sind nämlich gerade die Kundeneinlagen ausgegangen. Bitte gedulden Sie sich noch einige Zeit, bis wieder Gelder bei uns eingegangen sind. Wir können Sie aber auf unsere Warteliste setzen und geben Ihnen sofort Bescheid, wenn wieder Geld da ist.“
Das ist offenkundiger Unsinn. Und da hilft auch nicht der Hinweis, dass die Banken doch aus ihren ursprünglichen Einlagen ein Mehr an Geld schöpfen können – mit dem sogenannten „Geldschöpfungsmultiplikator“ als dem Geldbetrag, den die Banken aus jedem Euro an ursprünglichen Einlagen schaffen. Denn die hinter dieser Vorstellung stehende (falsche) „Theorie der partiellen Reservehaltung“ behauptet, dass nur das Bankensystem als Ganzes – durch die Interaktion der einzelnen Banken – zusammen Geld schöpfen könne, nicht aber eine einzelne Bank. Jede einzelne Bank sei ein reiner Geldvermittler, der Einlagen sammeln und diese verleihen müsse und der nicht mehr verleihen könne, als er von den Einlegern erhalten habe.
Auch das Argument, dass im Fall knapp werdender Einlagen bei den Banken eben die Zentralbank (also die Deutsche Bundesbank bzw. die Europäische Zentralbank) einspringt, zieht nicht: Die Geschäftsbanken können sich nämlich nicht bei der Zentralbank Zentralbankgeld leihen und dieses dann an (Nichtbank-) Unternehmen oder private Haushalte weiterverleihen (wir kommen gleich noch darauf zurück).
Banken als Geldproduzenten
Wenn aber Banken keine bloßen Geldvermittler sind, die Geld von Sparern zu Kreditnehmern transferieren, wie funktioniert die Kreditvergabe dann?
Tatsächlich gewährt eine Bank einen Kredit, indem sie das Geld, das sie an einen Kunden verleiht, neu schafft, also „aus dem Nichts“ erzeugt. Sie stellt dazu einerseits gegenüber dem Kunden den Kredit als Forderung in ihre Bilanz ein und bucht ihm andererseits auf seinem Konto bei ihr ein Giroguthaben ein, so dass in ihrer Bilanz die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden in gleicher Höhe zunehmen. Die ganze Aktion reduziert sich also – etwas simpel formuliert – auf das Eingeben einer Zahl in einen Computer.
Die folgende Abbildung verdeutlicht dies in vereinfachter Form am Beispiel eines von Bank A gewährten Darlehens in Höhe von €1000 an den Kunden X (um die Darstellung übersichtlicher zu halten, werden nur die Veränderungen auf der Aktiv- und Passivseite gezeigt):
Abbildung: Bilanz der Bank A nach einer Kreditvergabe
| Veränderungen bei den Aktiva | Veränderungen bei den Passiva |
| Kredit an Kunde X = + €1000 | Girokonto von Kunde X = + €1000 |
In dem Augenblick, in dem Bank A ihrem Kunden X den Betrag von €1000 auf dessen Girokonto als Sichteinlage gutgeschrieben hat, ist Giral- oder Buchgeld entstanden. Kunde X kann nun über den gutgeschriebenen Betrag verfügen und ihn z.B. zum Kauf eines neuen E-Bikes verwenden.
Um das Geld, über das Kunde X nun verfügen kann, zu schaffen, brauchte Bank A weder vorherige Bankeinlagen noch vorherige Guthaben bei der Zentralbank noch Bargeld im Tresor. Es ist durch den beschriebenen Geldschöpfungsprozess aber auch niemand reicher geworden: Kunde X nicht, weil er jetzt zwar €1000 auf seinem Konto, aber auch €1000 Schulden hat (die er mit Zinsen zurückzahlen muss), aber auch Bank A nicht, weil sie nun zwar auf der Aktivseite ihrer Bilanz eine Kreditforderung gegenüber ihrem Kunden X hat, der jedoch auf der Passivseite in gleicher Höhe die Einlage von Kunde X als Verbindlichkeit gegenübersteht.
Überweisungen und Barabhebungen
 Was geschieht nun, wenn der Kunde X die €1000 an einen Verkäufer Y von E-Bikes überweist? Wenn der Darlehensnehmer X und der Verkäufer Y ihre Konten bei der gleichen Bank haben, ist das sehr einfach: Kunde X wird von seinem Konto die Summe von €1000 abgezogen und Verkäufer Y gutgeschrieben. Was aber passiert, wenn Verkäufer Y nicht Kunde der gleichen Bank A ist?
Was geschieht nun, wenn der Kunde X die €1000 an einen Verkäufer Y von E-Bikes überweist? Wenn der Darlehensnehmer X und der Verkäufer Y ihre Konten bei der gleichen Bank haben, ist das sehr einfach: Kunde X wird von seinem Konto die Summe von €1000 abgezogen und Verkäufer Y gutgeschrieben. Was aber passiert, wenn Verkäufer Y nicht Kunde der gleichen Bank A ist?
In diesem Fall benötigt Bank A üblicherweise Zentralbankguthaben. Geschäftsbanken akzeptieren nämlich nicht das Giralgeld anderer Banken als Zahlungsmittel, sondern nur Zentralbankgeld, das sind Bargeld und sogenannte Reserven. Zentralbankgeld kann nur von der Zentralbank geschaffen werden. Alle Geschäftsbanken eines Landes führen bei der für sie zuständigen Zentralbank Reservekonten, auf denen sie Einlagen halten und über die sie Überweisungen untereinander abwickeln. Die Guthaben der Banken bei der Zentralbank werden „Reserven“ genannt. Nur Banken haben über ihre Reservekonten direkten Zugang zu Reserven. Anders als manchmal dargestellt, können Geschäftsbanken also auch keine Reserven an Produktionsunternehmen oder private Haushalte (weiter-) verleihen, da diese über keine Konten bei der Zentralbank verfügen. Reserven werden nur auf Konten bei der Zentralbank gehalten und daher allein zwischen Banken verliehen (sie verlassen nie den Bereich der Zentralbankkonten). Mit anderen Worten: Einlagen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank und Einlagen von Kunden bei den Geschäftsbanken zirkulieren in getrennten Systemen.
Wir wollen hier nicht im Detail darstellen, wie der Zahlungsausgleich der Banken funktioniert. Nur so viel: Betrachtet man die Überweisung von einer Bank A (in unserem Beispiel der Bank von Kunde X) zu einer Bank B (in unserem Beispiel der Bank des E-Bike-Verkäufers) isoliert und etwas vereinfacht, dann verwendet Bank A Zentralbankgeld, um Bank B zu beauftragen und dafür zu bezahlen (bzw. zu „entschädigen“), dass Bank B gegenüber dem Überweisungsempfänger Y eine Verbindlichkeit in Form einer Sichteinlage eingeht. Bank A verliert bei dieser Transaktion die Sichteinlage des überweisenden Kunden X und gleichzeitig verringert sich ihr Zentralbankguthaben; bei Bank B erhöhen sich umgekehrt ihre Zentralbankguthaben und ebenso die Sichteinlagen des Überweisungsempfängers Y.
Was geschieht, wenn Bank A nicht über hinreichend Zentralbankguthaben verfügt, um die Zahlung durchführen zu können? In diesem Fall kann sie sich Zentralbankguthaben leihweise über den Interbankenmarkt – also von anderen Banken – oder von der Zentralbank beschaffen.
Auch wenn Kunde X sein Giroguthaben bei Bank A (das durch die Kreditgewährung entstanden ist) in Bargeld umwandeln möchte, um sein E-Bike bar zu bezahlen, besteht für Bank A ein Bedarf an Zentralbankguthaben: Die Banken können ihre Guthaben bei der Zentralbank jederzeit in der Form von Bargeld abfordern, also in bar abheben. Für die Zentralbank ist das kein Problem, da sie das ausschließliche Recht zur Ausgabe der Banknoten besitzt und damit in einem Geld zahlt, das sie selbst jederzeit und unbegrenzt herstellen kann. Auch die Reserven erzeugt die Zentralbank „aus dem Nichts“ – es handelt sich um nichts weiter als elektronische Einträge über eine Tastatur.
Der Handlungsspielraum der Banken
Was folgt aus alledem für die Stellung der Banken in der Volkswirtschaft? Lässt sich daraus schließen, dass die Banken nur einen sehr eingeschränkten Gestaltungsspielraum besitzen, da sie letztendlich auf die Bereitstellung von Reserven durch die Zentralbank angewiesen sind?
Keineswegs. Denn erstens wird – wie bereits erwähnt – kein Zentralbankgeld (in Form von Reserven) gebraucht, wenn der Darlehensnehmer (in unserem Beispiel Kunde X) und der Zahlungsempfänger (Verkäufer Y) ihre Konten bei der gleichen Bank unterhalten.
Zweitens ist es nicht so, dass jede Überweisung eines Kunden der einen Bank zu einem Kunden einer anderen Bank stets von einem entsprechenden Reservetransfer begleitet wird. Zum Zahlungsausgleich werden nur Reserven benötigt, wenn über einen bestimmten Zeitraum eine Bank an eine andere in der Summe mehr an Überweisungen tätigt, als die andere in entgegengesetzter Richtung. Oder anders ausgedrückt: Die beiden Banken ermitteln die Differenz im Zahlungsverkehr und gleichen nur diese über ihre Reservekonten bei der Zentralbank aus, indem die „defizitäre“ Bank die errechnete Nettosumme an die andere Bank überweist.
Drittens haben die Banken verschiedene Methoden entwickelt (Ausgleich der Salden im Zahlungsverkehr mit anderen Banken durch sogenannte „Repos“, Verrechnung über privat geführte Korrespondenzkonten ohne Beteiligung der Zentralbank etc.), welche die Abhängigkeit von „ihrer“ Zentralbank verringern.
Viertens brauchen die Banken – unter normalen Umständen und solange sie solvent sind – nie zu befürchten, an Reserven, die sie für den Zahlungsausgleich untereinander benötigen, nicht heranzukommen. Sie wissen, dass sie sich, wenn sie knapp an Reserven sind, diese auf dem Interbankenmarkt von anderen Banken oder – falls das nicht möglich ist – immer von der Zentralbank leihen können. Die Zentralbank muss die Banken und mithin die Volkswirtschaft insgesamt stets mit den erforderlichen Reserven versorgen und selbst eine stark steigende Nachfrage der Banken nach Reserven bedienen. Weigerte sie sich, dies zu tun, würde sie nicht nur die Banken in Zahlungsprobleme stürzen, sondern letztendlich das gesamte Finanzsystem fundamental destabilisieren, was mit ihrem Mandat der Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs nicht vereinbar wäre.
Der Handlungsspielraum und damit die „Macht“ der Geschäftsbanken ist damit deutlich größer, als man vielleicht aufgrund ihres Bedarfs an Zentralbankgeld (Bargeld und Reserven) vermuten könnte.

Eine Regulierung des Finanzsektors ist unabdingbar
Gerade wenn man bedenkt, dass Banken für die Vergabe von Krediten kein Geld benötigen, das ihnen vorab von Sparern zur Verfügung gestellt werden muss, sondern einfach dem jeweiligen Kreditnehmer den entsprechenden Geldbetrag auf seinem Girokonto gutschreiben können, wird deutlich, wie wichtig eine effektive Regulierung des Bankenbereichs ist. Dies nicht zuletzt, um zu verhindern, dass beispielsweise massenhaft Kredite vergeben werden, die zur Entstehung einer sogenannten „Asset-Blase“ führen – wie etwa der Immobilienblase in Spanien –, bei deren Platzen dann auch die Realwirtschaft in die Krise gerissen wird.
Doch leider kommt ein Umdenken nur sehr langsam in Gang: Obwohl selbst die konservative Deutsche Bundesbank vor einigen Jahren von der „Geldvermittlungstheorie“ abgerückt ist und obwohl diese Theorie inzwischen auch empirisch eindeutig widerlegt wurde, hält die Mehrheit der Ökonomen in Deutschland (und weltweit) eisern an der harmlosen Vorstellung fest, dass Banken reine Geldvermittler sind, die Einlagen einwerben und dann diese (begrenzten) finanziellen Mittel an Kreditnehmer weiterleiten. Warum ist das so?
Die Antwort ist recht einfach: Wenn die herrschende Lehre diese Betrachtung aufgäbe und stattdessen die Rolle der einzelnen Banken als Geldschöpfer akzeptierte, gerieten damit auch andere, wichtige neoliberale Mythen ins Wanken. Dazu demnächst mehr.
Für diejenigen, die sich für mehr Einzelheiten und/oder zusätzliche Informationen interessieren – also etwa die Frage, warum Banken denn überhaupt an Sicht- und Spareinlagen interessiert sind, wenn sie doch Geld „aus dem Nichts“ schaffen können –, hier einige weiterführende Beiträge, die im Online-Magazin Makroskop erschienen sind:
Die unverstandene Welt der Banken (Teil 1)
Die unverstandene Welt der Banken (Teil 2)
Wozu brauchen Banken Kundeneinlagen?
Banken: Geldvermittler und Geldschöpfer?