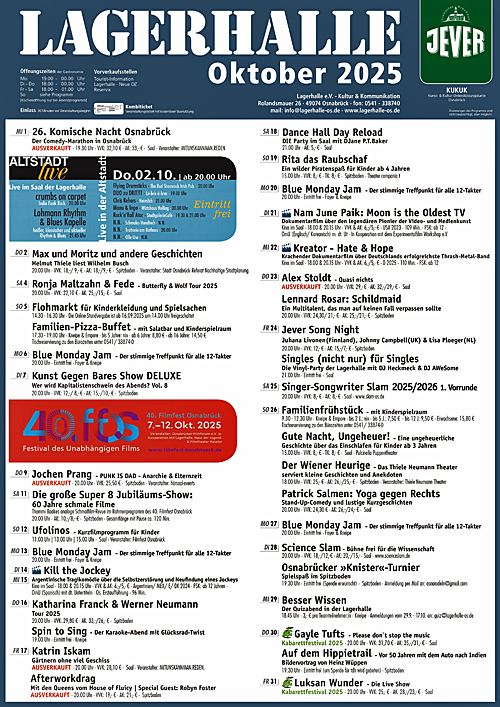Stellungnahme zu der Netflix-Serie „Adolescence“
Die Netflix-Serie Adolescence zeigt, wie tief soziale Medien in das Leben junger Menschen eingreifen – und wie hilflos Erwachsene diesen Realitäten oft gegenüberstehen. Bildungswissenschaftler der Uni Osnabrück sehen darin einen Weckruf: Nicht Verbote, sondern Begleitung müsse im Mittelpunkt stehen.
Die Serie behandelt unter anderem die Themen Online-Radikalisierung, Cybermobbing und toxische Männlichkeit. Die Nationalakademie Leopoldina hat vor Kurzem ein Diskussionspapier veröffentlicht, in dem sich die Wissenschaftler unter anderem für eine stärkere gesetzliche Regulierung digitaler Medien aussprechen – zum Schutz der psychischen Gesundheit, des Wohlbefindens und der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, wie es darin heißt. In ihrer Stellungnahme zu „Adolescence als Spiegel gesellschaftlicher Schlüsselprobleme“ plädieren Osnabrücker Schulpädagogen indes für eine mehrdimensionale Betrachtung des Themas.
„Schulen und digitale Lebenswelten dürfen nicht als in sich abgeschlossene Räume betrachtet werden“, sagt Prof. Dr. Sven Thiersch von der Uni Osnabrück. Ein Handyverbot an Schulen oder ein bestimmtes Mindestalter für die Einrichtung von Social-Media-Accounts halten Probleme nicht aus dem Klassenzimmer heraus: „Das entspricht nicht den Lebensrealitäten“, so Thiersch, der sich unter anderem durch das BMFTR-Projekt „Zur sozialen Praxis digitalisierten Lernens“ intensiv mit dem Thema befasst hat.
„Handyverbote an Schulen regulieren das Verhalten lediglich an der Oberfläche, erzielen aber keine tiefgreifenden Wirkungen, sondern nur Beruhigungen und die Fiktion von Kontrolle“, heißt es in der Stellungnahme, an der neben Sven Thiersch auch Prof. Dr. Christian Reintjes von der Uni Osnabrück sowie Dr. Dorthe Behrens und Prof. Dr. Till-Sebastian Idel von der Uni Oldenburg sowie Prof. Dr. Grit im Brahm von der Ruhr Universität Bochum mitgewirkt haben.
Die Wissenschaftler sprechen sich für eine verstärkte medienpädagogische Bildung aus, die auch das außerschulische Umfeld – insbesondere die Eltern – einbeziehe und Wissen vermittle, das zur Reflexion anrege. So seien Jugendliche in der Lage, eigene Positionen zu entwickeln und eine nachhaltige Resilienz gegenüber destruktiven Einflüssen digitaler Kulturen zu entwickeln.
Wie digitale Kompetenz bereits an Grundschulen gestärkt werden könnte, das untersucht aktuell auch der Osnabrücker Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Christian Reintjes in dem Projekt „Digitalisierungsbezogene und digital gestützte Schul(kultur)entwicklung durch Multiprofessionelle Kooperation an ganztägigen Grundschulen“ (DigischuKuMPK). Das Projekt, an dem sich ein Team von rund 35 Mitarbeitern verschiedener Universitäten sowie 30 Grundschulen beteiligen, wird ebenfalls vom Bundesministerium für Forschung und Technologie gefördert.