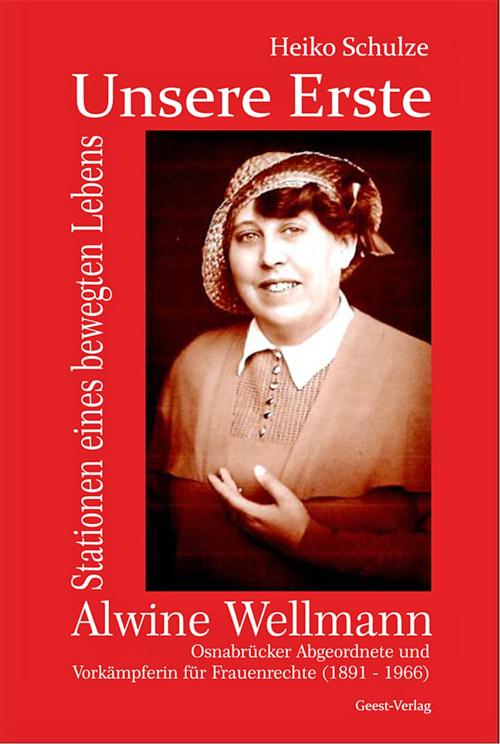Willy Brandt – 2. Teil
(hier geht es zum 1. Teil)
III. Ende des Exils und Neubeginn in Deutschland
Als er zum Ende des Krieges um Aufnahme in der SPD ersuchte, erhielt er vom Londoner Exilvorstand SoPaDe (so lautete dessen Abkürzung) zunächst eine Abfuhr. Die dortige Parteirechte um Erich Ollenhauer hatte sein Wirken für die SAP nicht vergessen. Im Laufe dieser Zeit stellte sich für ihn die Frage, ob er in Norwegen bleiben oder wieder Deutscher werden sollte, denn 1938 hatte man ihm die Staatsangehörigkeit entzogen. Rut, seine zweite Frau und geborene Norwegerin, war von einer Übersiedlung nach Deutschland nicht begeistert.
Bevor er sich 1947 endgültig für Deutschland, genauer für Berlin als neuen Wohn- und Lebensort und damit für die Teilhabe am politischen Wiederaufbau Deutschlands entscheidet, besucht er Deutschland als Berichterstatter norwegischer Zeitungen bei den Nürnberger Prozessen. Hier sind einige seiner grundsätzlichen Bemerkungen interessant, die 1946 unter dem Titel „Verbrecher und andere Deutsche“ in Schweden und Norwegen erschienen. Sie sind für die damalige Zeit überraschend differenziert und enthalten große Zweifel an der Kollektivschuldthese und auch an der Sinnhaftigkeit der Entnazifizierungsverfahren mit ihren „Persilscheinen“. Er geht sogar so weit, die Mitschuld auch bei denen zu suchen, die durch ihre politischen Fehler die Opfer der Gewaltherrschaft der Nazis wurden, z.B. bei sich selbst und seinesgleichen.
Es ist vielleicht der Ort zu einer der Zeit weit vorauseilenden grundsätzlichen Bemerkung. Brandt hat insbesondere in den sechziger Jahren, ausgelöst und salonfähig gemacht von Adenauer und der CDU im Bundestagswahlkampf 1961, unter der Diskreditierung seiner Emigration im Verbund mit seiner unehelichen Geburt gelitten und einige haben ihm vorgeworfen, sich zu defensiv gegen die Angriffe verteidigt zu haben. Das war angesichts des damaligen Main-Streams in der Bevölkerung, den Adenauer ja kalkuliert bediente, auch nicht einfach, denn er musste sich für sein Verhalten verteidigen, nicht aber Adenauers Staatssekretär Globke, der immerhin Mitautor der Nürnberger Rassengesetze war. Globke war vielleicht die Spitze des Eisberges, denn die alten Nazis steckten weiterhin in führenden Stellungen der Wirtschaft, der Politik, den Verwaltungen, der Justiz und des Bildungs- und Erziehungssystems, eigentlich der gesamten Gesellschaft. Erst heute wird das Ausmaß beispielsweise in den Bundesministerien bis zur Bundesanwaltschaft durch eine sehr späte Aufarbeitung öffentlich bekannt und benannt.
Brandt hat seine Emigration immer als richtig angesehen, aber nie machte er jemanden, sofern er nicht schwere persönliche Schuld auf sich geladen hatte, einen Vorwurf daraus, einen anderen Weg gegangen zu sein als er. In einem langen, als Buch erschienen Gespräch Mitte der achtziger Jahre wird daraus ein Titel „…wir sind nicht als Helden geboren“ und er fügt hinzu, glücklich seien die Zeiten, die keine Helden verlangen. Und auch als sich die Stimmungslage dann wendet und seine Vergangenheit nicht mehr Makel, sondern zum Teil seines internationalen Ansehens wird, da ändert er seinen Umgang mit dem, was man seine Vergangenheit nennt, nicht.
In die SPD ist er über Umwege dann doch gekommen. Er sitzt anfangs gleich zwischen der Gruppe der alten Funktionäre, die ihn seiner SAP-Vergangenheit wegen kritisch beäugen und der in Hannover ansässigen Zentrale um den legendären Nachkriegsvorsitzenden Kurt Schumacher. Man müsste dieser durch seine Leidensgeschichte geprägten außerordentlichen Persönlichkeit viel mehr Raum widmen, als das hier möglich ist, um ihm auch nur annähernden gerecht zu werden. Da das nicht möglich ist, halten wir für unser Thema nur fest, dass die persönliche Chemie zwischen dem eher autoritären Schumacher und Willy Brandt nicht stimmt. Hinzu kommen politische Dissonanzen. Schumachers rabiater Antikommunismus, der alle Fehler und Schuld für das Scheitern der Weimarer Republik nur bei der KPD als Erfüllungsgehilfen Moskaus sieht, entspricht nie Brandts Analyse, der ja – wie erwähnt – zur Weimarer SPD immer ein distanziertes Verhältnis behielt.
Die Dissonanzen steigerten sich in der Folgezeit insbesondere in der Außenpolitik zu Differenzen, die Brandt aus der Berliner Sicht um den exponierten Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter, seinem neuen Mentor, nun mit entwickelt. Und man sieht Willy Brandt in dieser Debatte gesäßgeografisch plötzlich auf der Seite der Parteirechten. Wie konnte das geschehen?
Versuchen wir den Kern dieser Differenzen hier möglichst kurz zu umreißen, denn hier entwickelt sich jene Position, die nun für Brandts Politik konstitutiv wird. In der nun folgenden Lebensphase, geprägt durch den Kalten Krieg, wird Willy Brandt fast ausschließlich Außen- und Deutschlandpolitiker. Er ist kein klassischer Kalter Krieger, der in der Kontinuität seiner alten mit den neuen Feindbildern lebt. Er weiß um die schon benannte Dialektik von Innen- und Außenpolitik im Kalten Krieg und mahnt, wohl sei „jeder Demokrat ein Antikommunist, aber deshalb noch lange nicht jeder Antikommunist auch ein Demokrat“.
Zunächst zerbrechen Brandts Vorstellungen und Erwartungen über die Nachkriegszeit. Es gibt keine dauerhafte Allianz der Siegermächte, stattdessen entwickelt sich in aller Kürze das, was man dann den Kalten Krieg nennt. Und eine der wesentlichen Folgen ist die Teilung Deutschlands mit einer besonders fragilen Zusatzlage in Berlin, deren Kostprobe 1948 die Luftbrücke darbietet.
Kurt Schumacher, der im ersten Weltkrieg schwer verwundet wurde und während der Nazidiktatur lange im KZ saß, sieht, nachdem sich das deutsche Bürgertum durch die Unterstützung der Nazis historisch desavouiert hatte, in der SPD nun die einzig zur Führung Deutschlands legitimierte Partei. Aus der Erfahrung der Weimarer Republik nimmt er als Lernprozess mit, die Linke – also die SPD – sei gescheitert, weil sie die nationale Frage missachtet habe. Dies dürfe nicht wieder geschehen und so wird durch Schumacher – welch Paradox – die SPD zum Gralshüter der nationalen Interessen und Souveränität. Die Einheit Deutschlands steht über allen weiteren außenpolitischen Erwägungen. Einige der Fakten des Zweiten Weltkrieges, dass Europa nun definitiv vom Subjekt zum Objekt der Weltpolitik herabgestiegen ist, werden ebenso wenig beachtet wie die Tatsache, dass über die Antwort auf die deutsche Frage faktisch nicht mehr die Deutschen entscheiden.
Der erste Irrtum Schumachers entpuppt sich mit dem Wahlsieg des durch Adenauers CDU konfessionell vereinten Bürgertums in der ersten Bundestagswahl 1949. Zwar ist die Kanzlermehrheit mit einer (Adenauers) Stimme knapp, aber die Gestaltungsmacht geht nicht an die SPD. Der zweite Irrtum lebt länger fort, eigentlich bis Juni 1960, als der letzte der vielen Deutschlandpläne von Herbert Wehner in einer Bundestagsdebatte mit einer 180 Grad Wende zu den Grundprämissen der Politik Adenauers ausgerechnet in dem Augenblick begraben wird, wo dieser selbst das Fundament entzogen wird.
Skizzieren wir kurz die Grundpositionen: Adenauers Priorität ist die Westintegration der BRD und deren Stabilisierung als Kernstaat eines künftigen vereinten Gesamtdeutschlands, denn gestützt auf die Stärke des Westens wird Moskau, wo allein der Schlüssel zur deutschen Einheit liegt, irgendwann die „Zone“ herausrücken. Eigentlich gingen die Forderungen über die „Zone“ hinaus, denn der eigenen Rechtskonstruktion folgend, existiert immer noch das Deutschland in den Grenzen von 1937. „Drei geteilt: niemals!“ stand auf Mahnschildern an den Ortsausgängen und Ortseingängen.
Schumacher sieht in Adenauers Primat der Westintegration lauter Schritte zur Vertiefung der Teilung Deutschlands. Gegen Adenauers auch militärische Bindung an den Westen, die er aus seiner Einschätzung der Sowjetunion eigentlich auch teilen müsste, setzt er die Strategie, dass durch gesamtdeutsche Wahlen Deutschland seine volle Souveränität erhalten soll und dann frei entscheidet, wie es seine innere und äußere politische Zukunft gestaltet. Das kann man mit Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der Nationen so fordern, ist aber bei etwas genauerer Betrachtung illusionär. Die simple Frage lautet, warum sollte die Sowjetunion das zulassen.
Da Schumacher nicht nur ein Anhänger der Totalitarismustheorie war, sondern auch von einer aggressiven, nach Machterweiterung strebenden sowjetischen Außenpolitik ausging – wofür es unmittelbar nach dem Kriegsende durchaus Anschauungsmaterial gab -, brauchte er eine Integration in das Westbündnis, um sich vor Moskau zu schützen, aber wenn das alles Schritte zur Spaltung waren, dann hatte er für eine harmonische Lösung der deutschen Einigung den Sowjets auch nichts zu bieten. Ungedeckt ist auch der Scheck, dass es irgendeine Macht im Westen gebe, die an einer Wiederherstellung des alten Deutschlands in den Grenzen von 1937 interessiert sei, denn offiziell war zu einem Verzicht darauf die SPD auch (noch) nicht bereit.
Man kann für die 50er Jahre von einem Wiedervereinigungsmythos der SPD sprechen, der sich zwar als Counterpart zur Adenauer-Politik gut machte, aber in einer Frage der Zeit hinterherlief, die für die SPD kurios wurde. Die weltpolitische Lage und die Stimmung – zumindest in der westdeutschen Bevölkerung – war sehr viel europäischer, insbesondere bei den Jugendlichen, als national. Man lag mit der Überbetonung der nationalen Frage gar nicht im Trend des Zeitgeistes – und schon gar nicht in der eigenen Tradition. Diesen Teil der zukunftsweisenden Modernität besetzten ausgerechnet die Konservativen, während man mit der Intransigenz der Wiedervereinigung eher „alte Kameraden“ anlockte.
Aber die SPD wäre nicht sie selbst, wenn es nicht hier auch andere Flügel gegeben hätte. Einer dieser und zugleich ein gewichtiger Flügel kam aus Berlin, an der Spitze zunächst Ernst Reuter, dann später Willy Brandt. Erst als Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses ab 1955, nachdem er zuvor, ohne groß in Erscheinung zu treten, im Bundestag gesessen hatte, und schließlich ab 1957 selbst als Regierender Bürgermeister von Berlin.
Aus einer Berliner Sicht stellte sich die Lage anders dar. Berlins Vier-Mächte-Sonderstatus und seine geografische Lange inmitten der DDR / SBZ machte die Stadt für alle Krisen besonders verwundbar und anfällig. Außerdem hatte man es hier mit dem Gegenüber, den Nachfolgern der KPD einschließlich der Zwangsvereinigung mit der SPD zur SED unmittelbar zu tun. Diese Erfahrungen verschärften die Sicherheitsbedürfnisse enorm und hatten zur Folge, dass die Berliner in der Partei außenpolitisch kritisch zur Parteiführung standen und Adenauers Priorität der Westanbindung, präziser die Bedeutung der amerikanischen Schutzmacht für wesentlich wichtiger einschätzten.
Alle alten Vorstellungen über einen Dritten Weg und Brückenkopftheorien verloren durch den sich faktisch vollziehenden Kalten Krieg und seine unmittelbaren Auswirkungen im Berliner Mikrokosmos der Weltpolitik an Plausibilität. Der Realpolitiker Brandt sah die Wiedervereinigung nicht in greifbarer Nähe wie Schumacher oder Ollenhauer, allen Entspannungsübungen nach Stalins Tod, dem XX. Parteitag der KPdSU von 1956, den Entmilitarisierungsplänen des polnischen Außenministers Rapacki und etlichen anderen zum Trotz. Brandt war als Regierender Bürgermeister in seinem Element, der Außenpolitik. Man kann ihn sich als klassischen Kommunalpolitiker auch nur schwer vorstellen.
Zu dieser Rolle prädestinierten ihn nicht zuletzt seine intensiven Beschäftigungen mit internationalen und außenpolitischen Fragen in der Emigrationszeit. Er lernte dadurch wohl eine entscheidende Kategorie, die bei den meisten Genossen merkwürdigerweise ein Fremdwort war: Macht. Die feinen Unterschiede der Brandtschen Position zu Adenauers Außen- und Deutschlandpolitik – das gilt nicht für die Innenpolitik – in dieser Zeit können wir hier auf sich beruhen lassen.
Mehr und mehr wurde er mit zunehmender Krise ab dem Berlin-Ultimatum Chruschtschows im November 1958 zum Nebenaußenminister, der durch die gesamte Welt jettete und für die Unterstützung der freien Stadt Berlin warb. Hier kamen ihm seine Weltoffenheit, seine Weltgewandtheit und die relative Jugend sehr entgegen. Auf dem internationalen Parkett war er einfach stilsicher zu Hause. Das unterschied ihn von allen anderen Bonner Politikern, die dagegen wie altbackene Provinzler wirkten. Sein späterer Hauptfeind, die Springer-Presse, feierte ihn als den deutschen Kennedy und mit seiner bezaubernden Frau Rut verbreiteten die beiden einen Glamour, den man bis dahin in der deutschen Politik nicht kannte. Dass man ihn auch den „schönen Willy“ nannte, ist Geschmacksache, aber dass er als junger Mann ein Womenizer war, ist verbürgt. Solche Glorie gebiert auch jede Menge Neid und Neider.
Brandt hatte als Weltreisender in Sachen Außenpolitik seine politische Berufung gefunden. Der parallel sich vollziehende Modernisierungsprozess der alten Tante SPD zum Godesberger Programm 1959, der programmatische Nachvollzug des faktisch längst vollzogenen Übergangs von der Klassen- zur Volkspartei fand seine Unterstützung, entsprach er doch seinem skandinavischen Lernprozess. Dazu inhaltlich beigetragen hat er nichts.
Seine Popularität nahm solche Ausmaße an, dass er an Stelle des eher blassen altgedienten Funktionärs Erich Ollenhauer für die Bundestagswahl 1961 zum Herausforderer gegen Adenauer gekürt wurde. Brandt führte einen hochmodernen Wahlkampf á la Kennedy. Allein nach Herbert Wehners Bundestagsrede am 30. Juni 1960 zur außenpolitischen Frontbegradigung, d.h. in diesem Falle nahezu komplette Übereinstimmung mit Adenauers Außenpolitik, der Zustimmung zur Wiederbewaffnung und Mitgliedschaft in der NATO, fehlte dem Herausforderer fast jegliche inhaltliche Alternative, umso mehr wurde seine Jugend und Modernität herausgestellt. Gemessen an dem Ausmaß persönlicher Diffamierungen und Unterstellungen, die sich mehr noch auf Brandts Herkunft als auf seine politische Vergangenheit bezogen, kann man den Wahlkampf 1961 als einen der schmutzigsten in der Geschichte der BRD bezeichnen. Doch in diesem Jahr war nicht nur Adenauer die Herausforderung, sondern die sich auf Berlin konzentrierende Dramatik der Weltpolitik. Die Bundestagswahl verlor er trotz eines Zugewinns von vier Prozentpunkten, aber als Krisenmanager gewann er an Statur, was der „Alte von Rhöndorf“ an Reputation verlor.
IV. Vom Mauerbau zur Ostpolitik
„Am 13. August 1961 fand in New York das Endspiel um die amerikanische Baseball-Meisterschaft statt und in Berlin wurde eine Mauer gebaut.“ Mit diesem Satz beginnt Billy Wilders köstliche Ost/West- Komödie „Eins, zwei, drei“ aus dem Jahre 1962, die wegen dieses respektlosen Anfangs übrigens bis in die Mitte der achtziger Jahre in Westdeutschland auf dem (nicht vorhandenen) Index stand und erst dann in Berlin zum absoluten Kultfilm avancierte.
In der schon seit Ende 1958 schwelenden Berlin-Krise deutete sich etwas Einschneidendes an, aber mit dem Bau einer Mauer, um den Massenexodus aus der „Zone“ aufzuhalten, hatte man nicht gerade gerechnet. Das war ein Schock, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Wie Brandt waren die Berliner wütend und empört über die ruchlose Tat des Ulbricht-Regimes, aber auch über die nur mäßige, pflichtgemäße Reaktion der Westmächte. Und zu dieser Untätigkeit gesellte sich die deprimierende Erkenntnis absoluter Ohnmacht. Da entstand in der aufgebrachten und verzweifelten Bevölkerung eine höchst explosive Mischung.
Am 16. August 1961 versammelten sich Hunderttausende vor dem Schöneberger Rathaus, Brandts offiziellem Amtssitz. Er hielt die Rede seines Lebens. Er musste der auch selbst empfundenen Gemütslage Ausdruck verschaffen und dann den entscheidenden Dreh finden, dass diese nicht zu unbedachten Reaktionen führt mit unvorstellbaren Folgen, sondern in Besonnenheit kanalisiert wird. Brandt weiß, wenn die Menge jetzt etwas der Gefühlslage Angemessenes an der Grenze macht, droht der Übergang vom Kalten in den Heißen Krieg. Seine Fähigkeit sich in die Lage seines Publikums hineinzuversetzen, wird hier zu seinem größten Kapital.
Er ist nicht der hinreißende Redner mit dem Pathos eines Ernst Reuter oder der schneidenden Schärfe eines Helmut Schmidt oder der analytischen Brillanz eines Fritz Erler, aber hier hilft seine oft bekrittelte und bespöttelte Neigung zu kryptischen Formulierungen. Kurzum: das schwierige Werk gelingt. Er trifft genau den richtigen Ton und die aufgewühlte Menge wählt den friedlichen Heimweg. Fast so gut wie zwei Jahre später John F. Kennedy in seiner legendären Berliner Rede macht er den Menschen Mut – mit nichts.
Der noch tiefer und weiter reichende Schock lag in der unvermeidbaren Erkenntnis, dass mit dieser (im wahrsten Sinnen des Wortes) Zementierung der Spaltung Deutschlands die gesamte gerade inaugurierte gemeinsame Deutschland– und Außenpolitik gescheitert ist. Zwar war der Mauerbau ein Ausdruck der Schwäche der DDR und des Ostblocks, aber andererseits zeigte sich auch, dass die Hoffnung, man käme aus einer Position der Stärke des Westens irgendwann zur Wiedervereinigung, sich erst einmal als pure Illusionen entpuppte.
Die USA hatten unter dem neuen umjubelten Präsidenten Kennedy aus dem Faktum eines nuklearstrategischen Patts mit den Sowjets die Konsequenz gezogen, dass die Einflusszonen in Europa abgesteckt sind und der bestehende Status quo mit militärischen Mitteln nicht mehr zu verändern ist. Also blieb nur eine Art friedlicher Koexistenz. Wie man heute den Archiven entnehmen kann, waren Kennedy und Chruschtschow im Sommer 1961 bei ihrem Gipfeltreffen in Wien darin übereingekommen, die bestehenden Einflusssphären in Europa abzustecken. Damit hatte die Sowjetunion faktisch in ihrer Hemisphäre freie Hand. Dass aus Kennedys Amerika ein anderer Wind als unter dem Kalten Krieger und Roll-back-Rhetoriker John F. Dulles, das war Eisenhowers Außenminister, weht, hatte Brandt atmosphärisch schon bei seinem Besuch in Washington vor dem Bau der Mauer gespürt, aber noch nicht richtig begriffen.
Aus der Sicht der USA standen für Europa die Zeichen auf Entspannung, die Konflikte mit dem Weltmachtkonkurrenten verlagerten sich auf die Dritte Welt, die Gebiete der Dekolonisation. Um hier Terrain zu gewinnen und zu sichern, verkündete Kennedy die „Allianz für den Fortschritt“. Was nun „Entwicklungshilfe“ genannt wird, ist das globale Mittel im Kampf um die Vorherrschaft in der Welt gegen den Kommunismus. Nach der dramatischen Zuspitzung in der Kubakrise wird dieser Kurs noch deutlicher. Die gemeinsame Angst vor einem Atomkrieg macht aus den Feinden Verbündete gegen den Schrecken, der im Oktober 1962 so greifbar nahe gelegen hatte.
Nachdem die SPD nun gerade in ihrer Deutschland- und Außenpolitik den Weg zur Großen Koalition beschlossen hatte, stand sie wie die Regierung Adenauer vor einem Scherbenhaufen, denn eigentlich stimmte jetzt nichts mehr. CDU und CSU fühlten sich von der Kennedy- Administration verraten und zerrieben sich in Kämpfen zwischen Atlantikern und Gaullisten. An ihrer Grundposition, dass die Wiedervereinigung Deutschlands die Voraussetzung für eine Entspannung in Europa sei, hielten sie fest und begaben sich damit mehr und mehr ins als letzter Eisblock des Kalten Krieges ins strategische Abseits.
An dieser entscheidenden Stelle schaltete die SPD, an der Spitze Brandt und sein als politischer Berater und Stratege immer wichtiger werdende Pressechef Egon Bahr, schneller um. Faktisch rückte die Wiedervereinigung in weite Ferne, von den Berliner Alltag getrieben bedurfte es aber Lösungen für ein Miteinander mit denen, die man nicht akzeptieren wollte. Um den Verkehr der Menschen zu ermöglichen, brauchte man Kommunikationsmöglichkeiten. Die Passierscheinabkommen, als Politik der kleinen Schritte, durch die allein die Einheit des Volkes in Gestalt von Familien und Verwandtschaften noch gelebt werden konnte, machte die Mauer durchlässiger. Allerdings um den Preis, dass man die „andere Seite“ nicht mehr einfach ignorieren konnte, man musste mit ihr reden, verhandeln, Abkommen unterschreiben und sie damit irgendwie auch „anerkennen“, ohne dies völkerrechtlich zu kodifizieren. Die „Ungenannten“ wurden zum ungewollten „Partner“.
Diese als erfolgreich anerkannte „Politik der kleinen Schritte“ wurde eingebaut in eine Strategie, die Egon Bahr 1963 in einer vielbeachteten Rede in der Evangelischen Akademie Tutzingen unter dem Titel „Wandel durch Annäherung“ zur programmatischen Geburtsstunde der späteren Ostpolitik wurde. In der grundsätzlichen Ausrichtung gibt es nun eine Übereinstimmung mit der neuen amerikanischen „Strategie des Friedens“ unter Kennedy, und der entdeckt nun in Willy Brandt seinen wichtigsten Verbündeten, während ihn Adenauer definitiv nur noch nervte.
Die praktische Politik wird elastischer, sie klammert sich nicht mehr an selbstgestrickte Rechtspositionen, die für Brandt nun zunehmend Formelkram werden. Der grundsätzliche Gedankengang ist recht einfach, nämlich eine Umkehrung der bisherigen Prämissen. Die von den USA und den beiden Supermächten durch das militärische Patt erzwungene und gewünschte Entspannung ist die Basis und Voraussetzung für die Bedingung der Möglichkeit einer deutschen Einheit, die allerdings ein langer Weg wird. Nicht die Wiedervereinigung ist die Voraussetzung für eine Entspannung, sondern die Entspannung die Voraussetzung einer möglichen Wiedervereinigung. Erforderlich ist dafür aber noch mehr, man muss die Realitäten anerkennen, um sie verändern zu können. Und nun kommt jener Teil, der in Bahrs Rede noch nicht auftaucht, sich aber aufdrängt: Was heißt genau Anerkennung der Realitäten? Des Status quo? Welcher? Die Anerkennung der DDR? Und was heißt das für den immer noch bestehenden offiziellen Anspruch auf Wiederherstellung eines Deutschlands in den Grenzen von 1937?
Diese offenen Fragen schwelen zunächst weiter, beschäftigen die politischen Debatten. In der Grenzfrage hält sich die SPD auch noch im Bundestagswahlkampf 1965 bedeckt. Brandt, der in diesem Jahr wieder als Kanzlerkandidat gegen Ludwig Erhard antritt, ist immer noch Regierender Bürgermeister in Berlin und seit 1964 auch Parteivorsitzender als Nachfolger von Erich Ollenhauer. Die Bundestagswahl bringt zwar einen weiteren Stimmenzuwachs, aber Genosse Trend führt nur an die vierzig Prozent heran und zu einem Regierungswechsel reicht es wieder nicht.
Der Kandidat hatte ganz auf sozialpolitische Themen gesetzt, Berlin war kein beherrschendes Thema mehr und gegen den noch populären „Vater des Wirtschaftswunders“ Ludwig Erhard hatte er wenig Fortune. Seine persönliche Krise ging so tief, dass er ein Jahr später, als die Koalition von CDU und FDP im Spätherbst 1966 zerbrach und Wehner und Schmidt quasi ohne Brandt die Große Koalition unter einem Kanzler Kiesinger meißelten, zunächst gar nicht ins Kabinett wollte. Schließlich gab er nach und wurde Außenminister.
Das war schon eine interessante Mischung, dieses Kabinett. Da saß das ehemalige NSDAP-Mitglied Kurt-Georg Kiesinger als Bundeskanzler neben dem Antifaschisten und Emigranten Brandt (beider Zuneigung war so groß, dass die beiden nur als Amtspersonen brieflich miteinander kommunizierten). Neben dem Altkommunisten Wehner, eine bittere Kröte für die Kalten Krieger, wurde auf der anderen Seite Franz-Josef Strauß, der Sünder der Spiegel-Affäre aus dem Jahre 1962, die ihn aus dem Amt als Verteidigungsminister warf, rehabilitiert. Wegen der Vielzahl der Skandale, in die er verwickelt war, könnte man ihn auch die „Skandalnudel“ der BRD nennen. In den Grundsatzfragen der Deutschland- und Außenpolitik kam man in der Großen Koalition über ein paar Akzente einer vorsichtigen Unterspülung der Hallstein-Doktrin nicht hinaus.
Die Hallstein-Doktrin verlangte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit jedem Staat, der die DDR völkerrechtlich anerkannte. Da dies aber immer mehr Staaten der „Dritten Welt“ taten, wurde sie zum gefährlichen Bumerang. Aber im Außenministerium arbeitete ein Mann an der Blaupause eines neuen, großen und riskanten Projektes: dem Durchbruch in der Deutschland- und Außenpolitik. Der Architekt dieses Werkes war Egon Bahr, doch dafür musste sein Bauherr Brandt Kanzler werden.