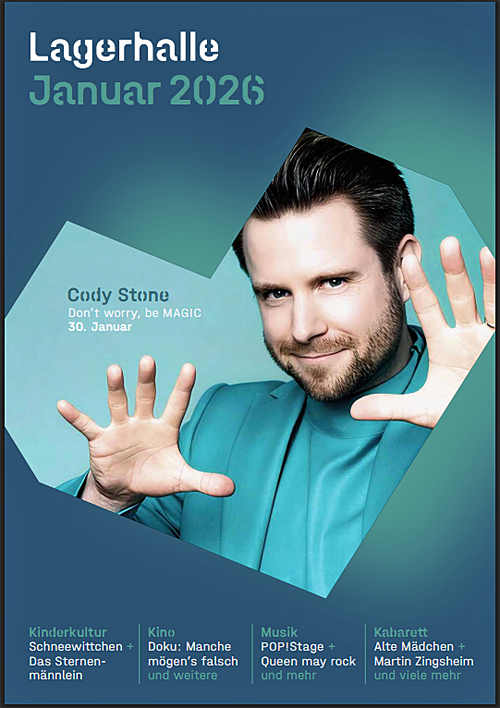Zum Verhältnis von Politik, Kultur und neuen digitalen Medien
Kunst wie auch Politik bieten sich seit einigen Jahren neue digitale Techniken um sich wechselseitig herauszufordern, um strategisch auf die jeweils ‚andere Seite‘ zu reagieren. Damit rückt weniger eine geschlossene ästhetische Form als vielmehr eine gerade umstrittene, oft widersprüchlich Rezeption in den Mittelpunkt des jetzt Sagbaren und Sichtbaren: Kunst wie Politik operieren dabei gleichzeitig hochaffektiv und strategisch, authentisch-heiss und zynisch-kalt zugleich.
Verkörpern Kunst und Politik heute jeweils eine grundsätzlich affektive Aktivität, die vor allem im aktivistischen Gegeneinander besteht? Walter Benjamins subtile Diagnose der „Ästhetisierung von faschistischer Politik“ aus dem Jahr 1935/36 ist unter heutigen Bedingungen im Kern noch gültig:
Ästhetische Politik verhält sich offenbar immer mehr wie politische Kunst. Sie handeln beide unter dem Stress von Freiheitsoptionen – gerade so als ob sie extrem gegenwärtig wie Getriebene handeln müssten: irritierend, strategisch, auf Fehler der Gegenseite lauernd, deutungsmächtig, gegenwartsfixiert, ständig polarisierend. Aber zu welchem Preis für die Gesellschaft und mit welchen Effekten? Wozu treibt die eine Seite die andere und umgekehrt?
Kunst ist heute nicht mehr nur als Kunst/werk erkennbar; sie wird – ihrerseits politisch geworden – einer bestimmten Aktivität/Rezeption zugerechnet. Damit stellt sich die Frage wie heute überhaupt Probleme von Gemeinschaften realisiert oder eben auch nicht-realisiert, ausgegrenzt oder abgelehnt werden. Das „Stadtbild“ lässt grüssen …
Öffentlich sichtbar gemachte Probleme werden heute weniger direkt und transparent gelöst als „empörungsoffen“ kommunikativ bearbeitet. Beide Handlungsfelder operieren dabei sprachlich höchst „übersensibel“, genauer gesagt hyperreaktiv. Ihre schnell reagierenden, digitale Kommunikationen zwingen uns, die Wählenden und Fans, zu ebenfalls permanent schnellen Reaktionen.
Je schneller die Zustimmung/ Ablehnung desto weniger Zeit zur eigenen Gedankenbildung. Kunst und Politik „müssen“ dabei immer mehr polarisieren umd blockieren sich so nicht selten gegenseitig; es kommt zum Nicht-Realisieren, zur gegenseitigen Lähmung von Debatten.
Dass Kunst seit dem XX. Jahrhundert immer auch Nicht-Kunst, also Grenzbereiche des Paradoxen, reflektiert, gilt seit Marcel Duchamps readymades als gesichert . Was der grosse Kunsttheoretiker Niklas Luhmann im XX. Jahrhundert nicht ahnen konnte, war die Tatsache , dass heute Strategien und Modi der Empörung, der Polarisierung und der Wiederbelebung rechter Ideologie das Verhältnis zwischen linken und rechten Aktivismus insgesamt getriggt hat. Beide Seiten handeln zunächst um jeweils eigene Macht zu demonstrieren – nicht mehr aber um Diskurse von minimaler Gemeinsamkeit zu ermöglichen.
Doch ist besonders Kunst – ein altes Leitmedium von Freiheit, Autonomie und Schönheit nicht selbst – ähnlich wie auch visionäre Anteile politischer Ideen – notwendig unrealisierbar ? Oder reflektiert diese Vermutung nur unsere Enttäuschung darüber, dass ein Kunstwerk//ein Gesetz leider so ist wie es ist und eben nicht sein Gegenteil? Kunst reflektiere sich im Nichterreichen der Idee von Kunst – schreibt Niklas Luhmann in seiner „Kunst der Gesellschaft“ (1995).
Politik reflektiert sich nicht nur durch Wahlergebnisse sondern durch Haltungen zu großen Ideen – etwa zu Freiheit, Menschenrechte oder Gerechtigkeit. Dass beispielsweise der Bürokratieabbau in Deutschland nicht gelingt, liegt nicht daran, dass die bürokratische Handlungsweisen hier so unbeliebt und ungewohnt wären. Vielleicht braucht Bürokratie einfach mehr Mut die eigenen Regelwerke im Sinne eines „Less is more“ zu entregeln und zu entsorgen. Neie Freiheitsräume entsteht jedenfalls – wie auch in Kunst und Politik selbst – mit der Chance sich selbst regelmäßig in Frage zu stellen.