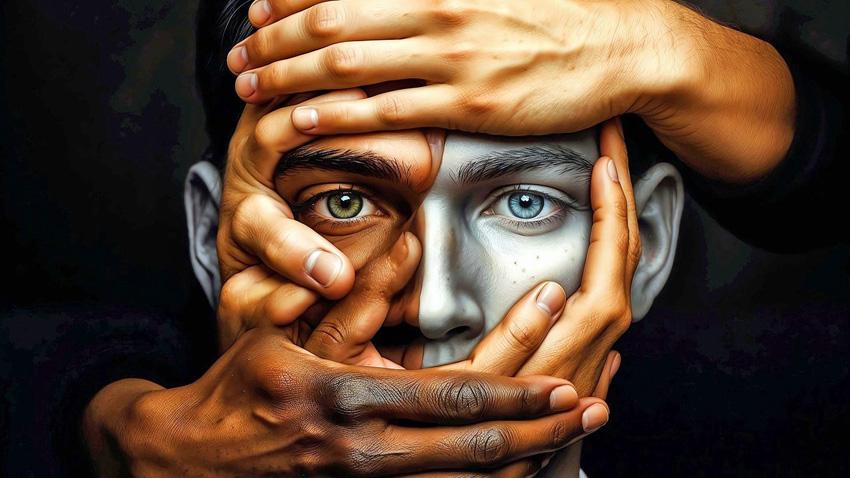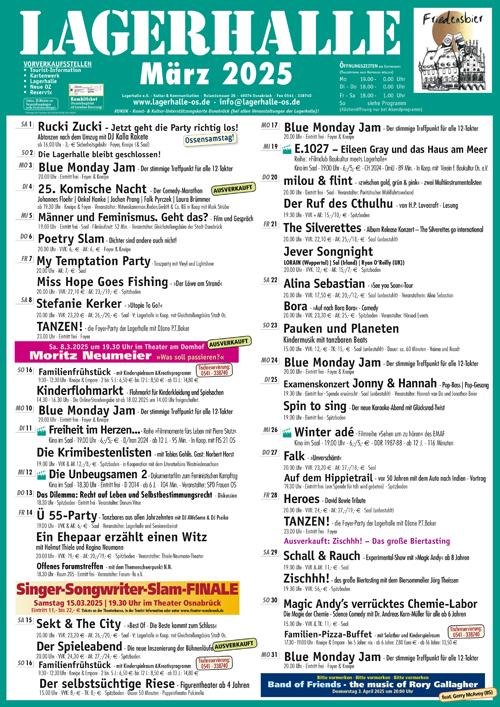Monitoringbericht 2025 des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa)
In der Friedensstadt Osnabrück merkt man es vielleicht etwas weniger als andernorts. Aber wachsende AfD-Stimmen und fiese Sprüche wie Aktionen sind leider auch hier unübersehbar. Denn: Rassistische Einstellungen sind in der deutschen Gesellschaft nach wie vor verbreitet. Diskriminierung – sei es durch rassistische Zuschreibungen oder aufgrund anderer Merkmale – gehört für viele Menschen zum Alltag.
Der am vergangenen Donnerstag vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) vorgelegte Monitoringbericht 2025 des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa) „Verborgene Muster, sichtbare Folgen. Rassismus und Diskriminierung in Deutschland“ zeigt die ungleich verteilten Diskriminierungserfahrungen in der deutschen Gesellschaft. Zentrale Ergebnisse der Studie sind:
Mehr als ein Fünftel der deutschen Gesamtbevölkerung hat gefestigte rassistische Einstellungen
22 % aller Befragten glauben, dass ethnische und religiöse Minderheiten in den letzten Jahren wirtschaftlich mehr profitiert haben, als ihnen zusteht. 23 % sind der Meinung, dass ethnische und religiöse Minderheiten zu viele Forderungen nach Gleichberechtigung stellen. Diese Befunde unterstreichen, dass rassistische Vorurteile über den Zeitraum von 2022 bis 2024 innerhalb der Gesamtbevölkerung fortbestehen.
54 % der rassistisch markierten Menschen erfahren Alltagsdiskriminierung
Mehr als jede zweite rassistisch markierte Person (54 %) erfährt mindestens einmal im Monat Diskriminierung – bei nicht rassistisch markierten sind es 32 %. Besonders betroffen von subtilen Diskriminierungsformen sind muslimische (61 %) und Schwarze Frauen (63 %) sowie Schwarze Männer (62 %). Hautfarbe ist für Schwarze (bis zu 84 %) und asiatische Menschen (bis zu 52 %) der häufigste Diskriminierungsgrund, muslimische Personen nennen vor allem ihre Religion (bis zu 51 %). Zudem berichten bis zu 55 % der asiatischen und muslimischen Befragten, als „nicht deutsch“ wahrgenommen und benachteiligt zu werden.
Die Zahlen zeigen: Diskriminierungserfahrungen sind nicht zufällig, sondern erfolgen anhand rassistischer Zuschreibungen.häufig durch diese diskriminiert wurden. Bei asiatischen Menschen sinkt das Vertrauen von 86 % auf 4 %, wenn sie häufig Diskriminierung durch die Polizei erfahren haben. Besonders betroffen von subtilen Diskriminierungsformen sind muslimische (61 %) und Schwarze Frauen (63 %) sowie Schwarze Männer (62 %). Hautfarbe ist für Schwarze (bis zu 84 %) und asiatische Menschen (bis zu 52 %) der häufigste Diskriminierungsgrund, muslimische Personen nennen vor allem ihre Religion (bis zu 51 %). Zudem berichten bis zu 55 % der asiatischen und muslimischen Befragten, als „nicht deutsch“ wahrgenommen und benachteiligt zu werden. Die Zahlen zeigen: Diskriminierungserfahrungen sind nicht zufällig, sondern erfolgen anhand rassistischer Zuschreibungen.
42 % der Schwarzen Männer und 38 % muslimische Frauen erfahren Diskriminierung vor allem im öffentlichen Raum
Rassistisch markierte Menschen werden etwa im öffentlichen Raum, in Ämtern, Behörden, in der Freizeit sowie durch Polizei und Justiz diskriminiert. Am
häufigsten tritt Ungleichbehandlung im öffentlichen Raum auf: 42 % der Schwarzen Männer und 38 % der muslimischen Frauen berichten von regelmäßigen negativen Erfahrungen. Auch in Restaurants, Geschäften und bei Veranstaltungen sind Schwarze Männer (36 %), Schwarze Frauen (30 %), muslimische (24 %) und asiatische Personen (23 %) besonders betroffen. In Ämtern und Behörden erleben besonders muslimische (37 %) und Schwarze Frauen (29 %) Diskriminierung. Ein zentrales Problem ist rassistische Benachteiligung durch die Polizei:
Diskriminierung geht mit einem erhöhten Risiko psychischer Belastung einher
Menschen, die mehrfach im Monat Diskriminierung erfahren, zeigen deutlich häufiger Symptome für Depressionen und Angststörungen als jene ohne solche Erlebnisse. Besonders betroffen sind muslimische und asiatische Personen: Jede dritte Person, die häufig Diskriminierung erfährt, leidet unter moderaten bis schweren Symptomen – im Vergleich zu rund 10 % der Nicht-Betroffenen,
Besonders bei Betroffenen von Diskriminierung sinkt das Vertrauen in staatliche Institutionen
Seit 2022 ist das Vertrauen in die Bundesregierung bis zu 20 Prozentpunkte gesunken, vor allem bei muslimischen und asiatischen Menschen. Auch das Vertrauen in Polizei und Justiz nimmt ab, besonders bei Menschen mit Diskriminierungserfahrung. So vertrauen 87 % der muslimischen Personen der
Polizei, wenn sie keine Diskriminierung erlebt haben – jedoch nur 19 %, wenn sie häufig durch diese diskriminiert wurden. Bei asiatischen Menschen sinkt das Vertrauen von 86 % auf 4 %, wenn sie häufig Diskriminierung durch die Polizei erfahren haben.
Den NaDiRa-Monitoringbericht 2025 „Verborgene Muster, sichtbare Folgen – Rassismus und Diskriminierung in Deutschland“ ist online abrufbar.