Aktuelles Schulsystem bereitet zu wenig auf Zukunft vor: Konrektor aus Georgsmarienhütte fordert radikale Wende im Bildungssystem
Die Bürgerinitiative Osnabrücker Schulen im Aufbruch (OSIA) hat am Mittwoch, dem 8. Oktober, dem Bestreben der Realschule Georgsmarienhütte nach einem humanitären und zukunftsgerichteten Lernkulturchange gewürdigt.
Der OSIA-Gründer Thorsten Sandvoß überreichte fünf Schülerinnen, Direktorin Barbara Stahl und dem 1. Konrektor Christian Diekmann ein Schule-im-Aufbruch-Schild, das die Bildungseinrichtung offiziell als „SIA-Netzwerkschule in Niedersachsen“ auszeichnet. Der stattfindende Lernkulturwechsel ist das Ergebnis eines mehrjährigen Schulentwicklungsprozesses und startete mit dem „FREI DAY“.
Im Interview sprachen wir mit Christian Diekmann über die konkrete Bedeutung des „FREI DAY“ für die Schule, den Weg dorthin, weitere mögliche Entwicklungsschritte und seine kritische Sicht auf die derzeitige deutsche Bildungslandschaft.
Herr Diekmann, wie und warum hat sich Ihre Schule entschieden, das Lernformat „Frei Day“ einzuführen, und was ist aus Ihrer Sicht das größte Problem der traditionellen Schule?
Der Prozess ging bei uns etwa vor vier Jahren richtig los. Eine Gruppe in der Schulentwicklung hat festgestellt, dass das tradierte Unterrichtssystem veraltet ist und es im Grunde einerseits eine De-Implementation von Unterrichtsinhalten braucht, um zeitgemäßere Formate und Fächer einzuführen. Dazu kommt, dass die Schule in der aktuellen Form wenig zum Schüler passt und Schule generell eher vom Lehren als vom Lernen gedacht wird.
Wir in der Realschule Georgsmarienhütte schneiden zwar immer noch überdurchschnittlich gut im Vergleich ab, müssen unseren Blick aber auf die Entwicklung und die Zukunft richten. Wir haben bemerkt, dass personenbezogene Kompetenzen wie das selbstregulierte oder selbstorganisierte Lernen bei den Schülern in den letzten zehn Jahren abgenommen haben und kaum noch jemand Verantwortung für sich, für die Gemeinschaft und die Umwelt übernimmt.
Die PISA-Ergebnisse zeigen ja weiterhin auch schon seit Langem, dass die Lernleistung eher schlechter wird. Wir brauchten interne Veränderungen, die das Kind wieder fokussiert ins Zentrum rücken. Das Lernformat FREI DAY (entwickelt von Margret Rasfeld, Schule im Aufbruch gGmbH) ist kein klassisches Unterrichtsformat und bedient genau das, was benötigt wird: Schüler zu beteiligen und sie verstärkt wieder in die Verantwortung zu bringen.
Welche Schwierigkeiten gab es bei der Umsetzung und wie sind Sie mit Widerständen umgegangen?
Wir haben vor drei Jahren mit der ersten Pilotklasse im Jahrgang 5 (4-stündig) angefangen. Gleichzeitig haben wir im Jahrgang 6 eine zweistündige Anlage getestet. Im Jahrgang 6 stellten wir fest, dass die zweistündige Form dem „FREI DAY“ nicht gerecht wurde, da kaum Projektunterricht durchgeführt werden konnte. Auch konnten die Inputphasen und der Einstieg (Checkin) und der Abschluss (Checkout) nicht effektiv erfolgen.
Im zweiten Jahr haben wir daher auf eine vierstündige Anlage umgestellt und jahrgangs- und klassenübergreifend gearbeitet. Allerdings findet der offizielle Start des FREI DAY´s mittlerweile erst im 6. Jahrgang statt, da die Schüler beim Übergang von den Grundschulen in der Regel einfach noch nicht die digitalen Skills mitbringen, die notwendig sind. Weiterhin sollen sich die 5. Fünftklässler generell erst einmal in ihrer neuen Peergroup orientieren und sind mit dem offenen Lernformat teils etwas überfordert. Nun werden sie im 2. Halbjahr im Klassenverband auf das FREI DAY Lernformat vorbereitet und starten dann ab Jahrgang 6 bis einschließlich 7 beginnend mit dem gemeinsamen Kick-Off offiziell durch.
Eine weitere Herausforderung war u.a. den normalen Fachunterricht in den Klassenzimmern von dem neuen Lernformat, welches in Lernräumen stattfindet, räumlich zu trennen, weil die „FREI DAY-Kids“ häufig sehr aktiv auf den Gängen unterwegs sind, um ihre Projekte zu organisieren. Insbesondere im Kollegium gab es hier Widerstände, da häufig Klassenarbeiten oder ruhigere Unterrichtsphasen gestört wurden. Im dritten Projektjahr haben wir darauf reagiert und alle FREI DAY-Lernräume in einen Gebäudetrakt zusammengelegt, sodass andere Klassen nicht mehr gestört wurden.
Es gibt nun auch einen zentralen FREI DAY-Raum u.a. mit einer Plantafel für alle Projektgruppen, wobei ein Lernbegleiter bei der Koordinierung die Gruppen unterstützt und Bescheid weiß, wenn Gruppen für ihr Projekt auch mal den Campus verlassen. In Abhängigkeit von Vertrauenspunkten (Graduierungssystem), die man erwerben kann, ist dies möglich. Zudem mussten wir alle an einer neuen Haltung arbeiten, weil wir als Lernbegleiter im FREI DAY eine ganz andere Rolle einnehmen. Hier gibt es keinen Frontalunterricht mehr, es wird Kontrolle abgegeben, ergo wir lernen gemeinsam loszulassen. Die Kinder wiederum übernehmen mehr die Regie und müssen sich mi„anfreunden“ und verantwortungsvoll umgehen lernen.
Das Lernformat FREI DAY wird übrigens offiziell unterstützt und gefördert durch den 2024 eingeleiteten Freiräumeprozess des Kultusministeriums in Niedersachsen. Es ist der Wunsch des Ministeriums, dass die Schulen verstärkt Freiräume nutzen, um die Schüler vorzubereiten auf eine sich immer stärker verändernde Welt. Für die Flexibilität, die wir vom Kultusministerium bekommen, sind wir dankbar um schulindividuelle Lösungen zu finden. Bei der Umsetzung stehen wir dennoch oft vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, Unterricht zu verlagern um „Platz für Neues zu schaffen“.
Wie profitieren die Schülerinnen und Schüler konkret von diesem Format, besonders im Umgang mit digitalen Medien und bei Rückschlägen?
Wir geben an jedem FREI DAY-Schultag kurze, variierende Inputphasen (20-30 Minuten), in denen bestimmte Informationen weitergegeben werden: z.B. wie man seriöse Internetquellen nutzt, um notwendige Informationen für die Projekte zusammenzutragen. So lernen die Kinder u.a., was FakeNews sind und werden sensibilisiert, kritisch zu denken und zu handeln. Das ist wichtig, da viele Schüler die Informationen aus Social Media (TikTok und Co.) oder KI-Plattformen wie Chat GPT häufig als bare Münze annehmen.
Die FREI-DAY-Schüler stellen unendlich viele Fragen und lassen sich bei Rückschlägen nicht davon abbringen, einen Weg für Antworten oder Lösungen zu finden. Wenn sie z.B. bei der Bürgermeisterin eine Absage bekommen, sind sie ganz selten resigniert, sondern suchen nach Alternativen: „Ey, das muss doch irgendwie anders gehen“. Sie lernen, eine wirkliche E-Mail an Fremde oder eine Firma zu schreiben, um notwendiges Infomaterial zu besorgen. Sie verwenden auch KI als Unterstützung dazu und lernen mit der Gruppe einen Weg zu finden.
Das führt dazu, dass alle wirklich selbstbewusster werden, da sie Selbstwirksamkeit erfahren können durch ihr Tun. Jeder bringt sich hier mit seinen Stärken ein. Man gewinnt als Individuum, aber auch als Team und lernt die Stärken der anderen zu schätzen. Im normalen Fachunterricht kommen die einzelnen Potentiale der Kids leider nicht in dem Maße zum Tragen, ebenso wenig werden Themen in der Tiefe so detailliert durchdacht.
Sie arbeiten eng mit Externen zusammen. Welche Rolle spielen diese Kooperationen für das Lernen?
Sich Unterstützung von Externen wie Kooperationspartner aus dem Handwerk oder der Industrie über Ehemalige oder Ehrenamtliche zu holen, ist eine im wahrsten Sinne des Wortes sinnvolle Sache. Wir sind als Realschule, nicht nur bedingt durch unseren gut aufgestellten Industriestandort in GM-Hütte und unserer Berufsorientierung, sehr praxisnah ausgerichtet.
Wenn man zum Beispiel den Satz des Pythagoras behandelt, kann ein Tischler anhand eines praktischen Beispiels praxisnah zeigen, ergo z.B. an einem Werkstück, inwiefern dieser Satz bei Anwendungen nützlich ist. Wenn der Schüler versteht, dass es sinnvoll ist und er es bei seinem Projekt oder für seine Lösungsfindung braucht, dann ist er motivierter, es lernen zu wollen.
In vielen schulischen Themen fragen die Schüler völlig zu Recht : Warum muss ich das eigentlich lernen?, „Wofür brauche ich das eigentlich?“. Einblicke aus dem Arbeitsalltag helfen hier oft. Der Hirnforscher Gerald Hüther hat ja auch ganz klar herausgestellt, du kannst einen Menschen nicht zwingen, sich zu verändern, sondern ihn nur einladen.
Was ist Ihre Vision für den „Frei Day“ an der Schule?
Der „FREI DAY“ ist unser Einstiegsformat auf dem möglichen Weg zu einem fundamentalen Lernkulturchange unserer Schule. Die Teilnahme für die Lehrkräfte ist bei uns freiwillig.
Wir hoffen, dass alle irgendwann die Erkenntnis haben, dass die am Ende dabei resultierenden, persönlichkeitsbildenden Kompetenzen wichtig sind für die Vorbereitung der Schüler auf das Leben und eine Welt, die sich zunehmend verändert. Wir wissen doch heute schon nicht mehr wie alles in 10 Jahren aussehen wird.
Daher sehe ich wesentlich mehr Sinn darin, dass ein Schüler lernt, wie er sich saubere Informationen beschafft, um damit selbstorganisierte Projekte im Team zu realisieren als sich viel zu spezifisches Wissen anzueignen, das in den meisten Fällen nie wieder benötigt wird.
Der FREI DAY ist natürlich nur ein Einstiegsformat und die Lernkultur ist weiter ausbaufähig durch Lernformate wie zum Beispiel „Herausforderung“ oder „Verantwortung übernehmen“. Generell sind auch noch größere Veränderungen wie die Einführung von Lernbüros/-ateliers denkbar, die digital gestützt sehr lernwirksam sind.
Die Umsetzung bedarf allerdings einen sehr starken Willen nach Veränderung durch alle an Schule beteiligten Personen. Bei allen Formaten geht es darum, die sozialen Kompetenzen, die Handlungskompetenzen und die selbstbestimmten Lernkompetenzen zu fördern. Letztendlich geht es darum, junge Menschen zu handlungsfähigen Persönlichkeiten erwachsen zu lassen, die in der Lage sind kooperativ im Team Lösungen zu erarbeiten und sich auch mit den großen Fragen der Welt intensiv zu beschäftigen.
Entscheidend ist in diesem Zuge der Aufbau auf den Potentialen und Stärken der Schüler, nicht der Fokus auf Defizite. Die Kinder verlassen dann die Schule mit dem Gefühl: „Wir können für alles eine Lösung finden, aber das funktioniert am besten im Team.“
Systemkritik und der Appell an die Bildungspolitik. Wo sehen Sie die größten Schwachstellen im aktuellen Bildungssystem außerhalb des Schulalltags?
Hier gibt es ja viele Ansätze die man verfolgen kann, wie die De-Implementierung von Inhalten, das überdenken der Fächer, die Auflösung des 45-Minuten Rhythmus oder die Lehrerbildung. Wir haben beispielsweise eine Fortbildungskultur, die zum Abgewöhnen ist.
Ich sehe ein Problem darin, dass eigentlich niemand kontrolliert, wann jemand welche Fortbildung macht. Länder in bildungseffizienteren Ländern lösen die berufliche Weiterbildung anders. Hier müssen sich Kolleginnen und Kollegen regelmäßig in didaktischen, methodischen oder auch in fachlichen Bereichen fortbilden oder bekommen hier Inputs über die aktuellsten Studienlagen.
Dies sorgt in den Systemen dann dafür, dass die Lehrkräfte auch innovativere Strömungen schneller verstehen oder umsetzen können. Agile Teams sind in jedem Berufsbild unheimlich wichtig. Hier besteht systemisch sicherlich Optimierungsbedarf. Es gibt leider Kollegen, die seit Jahren im Dienst sind und abgesehen von den schulinternen Maßnahmen keine Fortbildungen gemacht haben. Wir bräuchten schon eine Fortbildungskonstanz, um sicherzustellen, dass man permanent auf der Höhe der aktuellen Debatte bleibt und aktuelle Studienlage (wie z.B. die Hattie-Studie) kennt.
Gibt es in der Bildungslandschaft zu viele Interessensgruppen, die dasselbe Ziel verfolgen, und müsste das koordinierter stattfinden?
Das ist eine schwierige Frage. Natürlich habe ich den Wunsch nach zentraler Fortbildung und auch zentraler Überprüfung der Fortbildung, um sicherzustellen, dass alle Pädagogen ein bestimmtes Wissen haben. Im Moment beobachtet man einen sehr starken Graben zwischen denen, die Schule zukunftsorientiert gestalteten wollen und denen, die eher das tradierte System fortführen wollen.
Wir freuen uns, dass z.B. unser Dezernat, die Presse, die Uni und viele Lehrkräfte anderer schulischer Einrichtungen ein Interesse an unserem FREI DAY haben und uns in der Schule besuchen. Das führt zu Vernetzung und ist sehr wertvoll. Mir fehlt hier allerdings noch die stärkere regionale und überregionale Vernetzung der Bildungslandschaft über das Dezernat oder das Kultusministerium. Vielleicht bin ich da aber auch zu ungeduldig.
Was wünschen Sie sich konkret von der Bildungspolitik, um wirksame Konzepte in die Breite zu bringen?
Ich wünsche mir vor allem Mut und Entschlossenheit im Handeln. Wenn man weiß, dass ein Konzept, eine Methode oder ein Unterrichtssetting effektiver und lernwirksamer ist als ein altes, dann frage ich mich immer, warum wir das nicht ändern. Insbesondere in einer sich so schnell technisch und gesellschaftlich verändernden Welt.
Mein Wunsch wäre, dass man von oben noch klarer zum Ausdruck bringt: Das geht jetzt in die Breite oder dahin möchten wir uns entwickeln. Wir haben in Deutschland so viele beeindruckende Beispiele an modernen Schulen, da kann man sicher viel abschauen. In skandinavischen Systemen wird nach wissenschaftlichen Studien umgebaut, ausprobiert, aufgeklärt und anschließend in allen Systemen umgesetzt.
Wir danken für das Interview und wünschen noch viel Erfolg bei den kommenden Schritten.
Mit folgenden Gedankengängen schließen wir diesen Artikel ab:
Es wäre also an der Zeit, aufzuwachen und unsere Schulen in das umzuwandeln, was sie sein müssten: Werkstätten des Entdeckens und Gestaltens, Erfahrungsräume zur Entfaltung der in allen Kindern angelegten Potenziale, Begegnungsorte für das Voneinander- und Miteinander-Lernen, Basislager des Erlebens von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und des Gefühls, aneinander und miteinander über sich hinauswachsen zu können.
Gerald Hüther, Neurobiologe
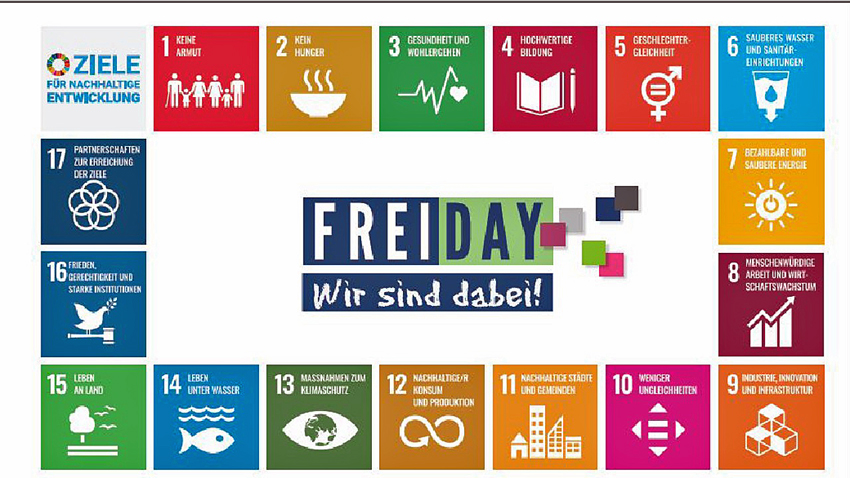
Text Infobox zum FREI DAY/ Freiräumeprozess des MK-Niedersachsen
Der FREI DAY ist ein projektbasiertes Lernformat an Schulen, bei dem Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich und selbstgewählte Projekte zu gesellschaftlichen oder ökologischen Themen umsetzen. An einem festen Tag pro Woche (mindestens vier Unterrichtsstunden) arbeiten sie jahrgangsübergreifend in Teams an konkreten Lösungen, die sie oft in der eigenen Nachbarschaft oder Gemeinde verwirklichen. Das Ziel ist, mündige Bürgerinnen und Bürger zu fördern, die lernen, Verantwortung zu übernehmen, kreativ zu werden und die Welt aktiv mitzugestalten.
Wie funktioniert der FREI DAY (Bedeutung: Strukturierter Freiheitstag)?
- Selbstgewählte Themen: Schülerinnen und Schüler identifizieren selbst, welche Fragen oder Probleme sie bewegen.
- Projektarbeit: Sie arbeiten gemeinsam an diesen Themen in jahrgangsübergreifenden Teams.
- Praktische Umsetzung: Die Projekte werden in der Praxis umgesetzt, zum Beispiel in der lokalen Nachbarschaft oder Gemeinde.
- Lernbegleitung: Lehrkräfte agieren als Lernbegleiterinnen und -begleiter, die den Prozess unterstützen, aber nicht bevormunden.
- Fokus auf Aktion: Es geht um das selbstständige Handeln, um die Erfahrung zu machen, dass man etwas bewirken kann.
- Zeitrahmen: Der FREI DAY nimmt an mindestens vier zusammenhängenden Schulstunden einen ganzen Tag ein, um eine intensive Arbeit zu ermöglichen.
Freiräume-Prozess MK Niedersachsen
- Ziel: Schulen sollen mehr Freiräume nutzen, um sich an die sich verändernde Welt anzupassen und zukunftsorientiert zu gestalten.
- Kernidee: Es wird auf bewährte Good-Practice-Beispiele zurückgegriffen, um Schulen zu inspirieren und zu motivieren, eigene Wege zu gehen.
- Beispiele für Maßnahmen: Weiterentwicklung von Bildungsstandards, projektorientiertes und individualisiertes Lernen, Schwerpunktsetzung durch Schulen, Fortbildung von Schulleitungen und Gremienarbeit.
- Umsetzung: Die Schulen gestalten ihre Freiräume nach den individuellen Bedürfnissen vor Ort.
- Einbindung von Gremien: Für die Einführung solcher Projekte werden zuständige Gremien wie die Gesamtkonferenz und der Schulvorstand beteiligt.














