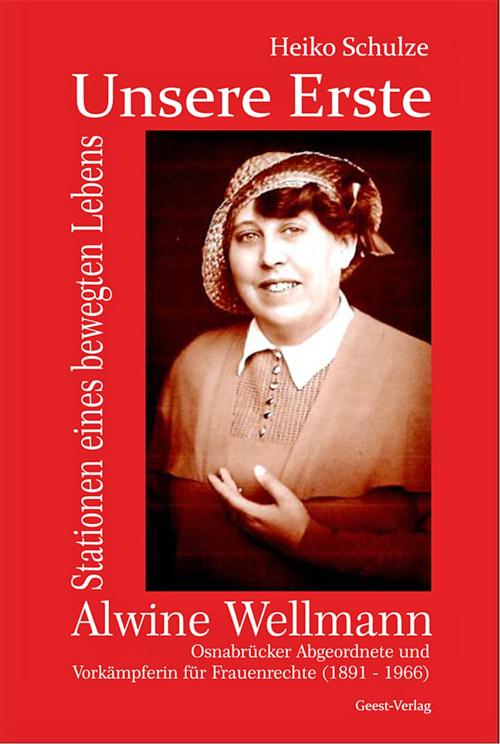Günther Grunert
Wirtschaftsexperte ist der neue Parteichef der CDU. Er genießt den Ruf eines ausgewiesenen Wirtschaftsexperten. Doch daran muss gezweifelt werden.
„Keiner Partei wird in Umfragen mehr Wirtschaftskompetenz zugeschrieben als der CDU mit ihrem Protagonisten Friedrich Merz“, klagte im letzten Jahr Gustav Horn im SPD-Organ Vorwärts. Das ist richtig und gilt insbesondere für Merz selbst, der am letzten Samstag von der CDU auf ihrem digitalen Parteitag mit fast 95 Prozent der Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt wurde.
In den Medien gilt Friedrich Merz weithin als der „Wirtschaftsfachmann aus dem Sauerland“ (Bild), der „CDU-Wirtschafts- und Finanzexperte“ (Stuttgarter Zeitung) oder als „ausgewiesener Wirtschaftsexperte“ (Augsburger Allgemeine). „Sein ökonomischer Sachverstand ist überragend“ (The European) und Merz „stärkt den Kompetenzvorteil der Union in Wirtschafts- und Finanzfragen“ (rp online).
Die Bewunderung für Merz in einem Großteil der deutschen Medien reicht dabei schon weit zurück. Nachdem sich der CDU-Politiker im Jahr 2009 zunächst aus der Politik verabschiedet hatte, glaubte die WirtschaftsWoche schon drei Jahre später eine „unerloschene Sehnsucht nach Friedrich Merz“ zu erkennen und stellte fest: „Immer wieder, wenn es um wirtschaftliche Kompetenz ging, dauerte es seit dem Merzschen Rückgang nicht lange, bis irgendein CDUler seinen Namen fallen ließ. […] Das hat seine Gründe. Merz, zu seiner aktiven Zeit einer der wenigen angesehenen Wirtschaftspolitiker, wurde in dieser Funktion nie ersetzt. Nie übernahm einer diese Kompetenz. Die Lücke, die er im politischen Berlin hinterließ, blieb sichtbar. Über Jahre.“
Nun hat das Renommee von Merz als herausragender Wirtschaftsexperte zwar in den letzten Monaten ein paar Kratzer erhalten. So gab es vereinzelt Kritik an seinen ökonomischen Äußerungen, die aber zumeist relativ kurz (manchmal auch oberflächlich) ausfiel und/oder sich auf ein oder zwei Punkte konzentrierte – insbesondere Merz‘ Ausführungen zur sogenannten „Liquiditätsfalle“. Seinem Ruf insgesamt hat dies nicht merklich geschadet.
In diesem Beitrag soll etwas genauer hingeschaut werden: An fünf Beispielen wird gezeigt, dass der ökonomische Sachverstand des neuen CDU-Chefs längst nicht so weit reicht wie gemeinhin angenommen. Von hoher Wirtschaftskompetenz kann keine Rede sein.
Die Liquiditätsfalle
Nach dem Beschluss eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 im März 2021 twitterte Merz:
„Der Bundeshaushalt steigt auf ein Volumen von 550 Milliarden Euro, 240 Milliarden Euro davon sind neue Schulden. Deutschland und die EU sind mit ihrer Finanzpolitik da angekommen, wo sie niemals hätten hinkommen dürfen: in der Liquiditätsfalle.“
Liquiditätsfalle: Das klingt beeindruckend und nach ökonomischer Kompetenz: Was aber ist eine Liquiditätsfalle? Der Begriff wurde ursprünglich von Dennis Robertson, der in den 1930er Jahren an der Cambridge University eng mit Keynes zusammenarbeitete, geprägt. Die Liquiditätsfalle entsteht bei einem bestimmten Mindestzinssatz (der bei Null liegen kann, aber keineswegs muss), wenn die Wirtschaftssubjekte davon ausgehen, dass das Zinssatzniveau so niedrig ist, dass sich die Zinsen nur noch in eine Richtung bewegen können – nämlich nach oben. Das Ergebnis ist dann, dass die Wirtschaftssubjekte, sobald die Zinssätze diese Untergrenze erreichen, es vorziehen werden, neues Geld in Kasse statt in Anleihen resp. Wertpapieren zu halten. Warum? Weil beim Kauf von Anleihen zu den aktuellen Marktpreisen mit Kursverlusten zu rechnen wäre: Denn wenn die Zinssätze steigen, sinken die Anleihekurse.
John Maynard Keynes schreibt dazu in seiner “General Theory“:
„Es besteht die Möglichkeit […], dass, nachdem der Zinssatz auf ein gewisses Niveau gefallen ist, die Liquiditätspräferenz praktisch absolut wird in dem Sinne, dass fast jedermann Kasse dem Halten einer Finanzanlage zu einem so niedrigen Zinssatz vorzieht. In diesem Fall hätte die Währungsbehörde die effektive Kontrolle über den Zinssatz verloren.“[1]
Dies ist die Liquiditätsfalle – aber auf welche Weise hat nun eine offenbar falsche Finanzpolitik dazu geführt, dass Deutschland und die EU in einer solchen Falle stecken, wie Merz meint? Das bleibt rätselhaft und auch sonst ergibt Merz‘ Tweet wenig Sinn. Wenn überhaupt, dann ist die Fiskalpolitik nicht die Ursache, sondern die Lösung des Problems.
Wenngleich Keynes selbst das historische Auftreten einer Liquiditätsfalle als sehr unwahrscheinlich ansah, spielte sie bei seinen späteren Interpreten – etwa im von J.R. Hicks entwickelten IS-LM-Modell – eine nicht unwichtige Rolle. In dem genannten IS-LM-Modell wird die Geldpolitik als Beeinflussung der Geldmenge durch die Zentralbank beschrieben. In einer Liquiditätsfalle führt nun eine Erhöhung der Geldmenge zu einem gleich hohen Anstieg der Geldnachfrage, so dass sich der Zinssatz nicht verändert. Das heißt, jede zusätzliche Geldmenge verschwindet in der Kassenhaltung der privaten Haushalte und hat keine Wertpapierkäufe und mithin Zinssatzsenkungen zur Folge. Mit anderen Worten: Der Zinssatz ist auch bei einer Geldmengenerhöhung nach unten starr, was bedeutet, dass es der Zentralbank nicht mehr möglich ist, die Zinsen durch eine Erhöhung der Geldmenge weiter zu senken. Die Geldpolitik verliert damit ihre Wirksamkeit: Sie ist nicht länger in der Lage, die Gesamtnachfrage zu beeinflussen. Damit kann nur noch die Fiskalpolitik effektiv sein, die zum entscheidenden wirtschaftspolitischen Instrument wird.
Wir können an dieser Stelle nicht auf die Probleme eingehen, die das Konzept der Liquiditätsfalle aufweist. Um nur einen von mehreren Punkten zu nennen: So kann zumindest die ursprüngliche Version nicht erklären, warum die Nachfrage nach Staatsanleihen häufig hoch bleibt, wenn die Zinssätze (sehr) niedrig sind. Bei Kassenhaltung sind keine Kapitalverluste zu erwarten (außer über die Inflation), während die Anleihekurse bei ausgesprochen niedrigen Zinssätzen (und Renditen) zukünftig eher fallen als steigen werden.
Aber zurück zu Merz: Wie man es auch dreht und wendet, seine Behauptung bleibt unverständlich: Wenn er tatsächlich glaubt, dass Deutschland und die EU in die Liquiditätsfalle geraten sind, müsste er in seiner Logik für eine stärkere Rolle der Fiskalpolitik plädieren, da in einer Situation der Liquiditätsfalle die Geldpolitik versagt und nur noch die Fiskalpolitik (Defizite) das reale BIP-Wachstum beleben kann. Das ist dann aber nicht vereinbar mit seiner Kritik an einer zu laxen Fiskalpolitik bereits in den Jahren zuvor, die nach Ansicht von Merz offenbar dringend korrigiert werden muss.
 Die Preiselastizität der Nachfrage
Die Preiselastizität der Nachfrage
In einem Interview mit dem Spiegel vom 26.06.2020 antwortete Friedrich Merz auf die Frage, wie billig Fleisch sein dürfe, wie folgt:
„Wertschätzung ist wichtig, auch Respekt vor dem Lebewesen Tier. Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen allerdings auch, dass die Preiselastizität bei Nahrungsmitteln nicht höher als 15 bis 20 Prozent liegt.“
Auch das klingt nach dem Versuch, mit ökonomischen Begriffen Wirtschaftskompetenz zu beweisen, und der Spiegel reagiert darauf auch sofort mit der Frage: „Können Sie das übersetzen?“
Tatsächlich ist eine „Übersetzung“ dieses Zitats schwierig, aber aus anderen Gründen, als der Spiegel vermutlich denkt. Denn die von Merz hier angesprochene Preiselastizität der Nachfrage ist eine Kennziffer, die die prozentuale Veränderung der nachgefragten Menge (Wirkungsgröße) in Relation zu einer prozentualen Veränderung des Preises (Ursachengröße) eines Gutes setzt. Steigt etwa der Preis eines Produkts von 100 Euro auf 110 Euro, also um 10 Prozent, und sinkt deshalb die nachgefragte Menge von 500 Stück auf 400 Stück, also um 20 Prozent, so ist die Preiselastizität der Nachfrage –2 (–20 Prozent dividiert durch 10 Prozent).[2]
Merz glaubt nun anscheinend, dass Fleisch nicht zu stark im Preis steigen darf, da „die Preiselastizität bei Nahrungsmitteln nicht höher als 15 bis 20 Prozent liegt“, also offenbar (sehr) gering ist. Fleisch dürfe somit nicht so teuer werden, „wie es manche Kritiker unserer Fleischproduktion gern hätten“. Denn in diesem Fall – so Merz – „könnten sich viele Bürger in der Tat kein Fleisch mehr leisten“, es wären dann „nicht viel mehr als zehn Prozent der Bevölkerung bereit, wirklich dauerhaft mehr zu bezahlen.“
Dies kann nur heißen, dass die Nachfrage nach Fleisch wegen des Preisanstiegs stark zurückginge. Eine deutliche Reaktion der Nachfrager auf Preisveränderungen zeigt aber eine hohe und nicht – wie Merz offenkundig meint – eine geringe Preiselastizität der Nachfrage an! Generell lässt sich feststellen: Wenn die prozentuale Änderung der nachgefragten Menge größer als diejenige des Preises ist, so gilt die Nachfrage als elastisch (der Betrag der Elastizität ist dann größer als 1). Ist dagegen die prozentuale Nachfrageänderung kleiner als die prozentuale Preisänderung, so wird die Nachfrage als unelastisch bezeichnet (der Betrag der Elastizität ist dann kleiner als 1).
Was aber meint Merz mit einer Preiselastizität bei Nahrungsmitteln von nicht mehr als 15 bis 20 Prozent? Prozent von was? Streng genommen müsste zunächst einmal das Vorzeichen negativ sein, da im Normalfall ein negativer Zusammenhang zwischen dem Preis und der Nachfrage besteht, also eine Erhöhung des Preises eine Verringerung der Nachfrage bewirkt. Nun ist es allerdings so, dass die Preiselastizität häufig als (absoluter) Betrag definiert wird. So weit kann man Merz daher noch folgen. Das Problem ist, dass die Elastizität eine dimensionslose Zahl ist, die mithin unabhängig von der verwendeten Einheit (also etwa Geldeinheiten, Mengeneinheiten) als Vergleichskriterium benutzt werden kann, die aber – und das ist wichtig – nicht in Prozent ausgedrückt wird (dividiert man einen Prozentsatz durch einen anderen Prozentsatz, kürzt sich das Prozent heraus).
Hat sich Merz also vertan und meint in Wahrheit eine Preiselastizität im Bereich 15 bis 20, die dann angibt, um wieviel Prozent sich die Nachfrage (durchschnittlich) verändert, wenn man den Stückpreis um ein Prozent variiert? Wenn aber mit einer Änderung des Preises um 1 Prozent eine 15- bis 20-prozentige Änderung der nachgefragten Menge einhergeht, lässt sich wohl kaum von einer geringen Preiselastizität der Nachfrage sprechen.
Damit ist die Verwirrung komplett: Erst hält Merz anscheinend die Preiselastizität der Nachfrage bei Nahrungsmitteln für gering („nicht höher als 15 bis 20 Prozent“) und begründet damit, dass Fleisch nicht zu teuer werden dürfe. Wenn aber die Preiselastizität der Nachfrage gering ist, impliziert dies eine nur schwache Reaktion der Nachfrager auf eine Preisänderung: Die Menschen werden folglich auch dann noch fast die gleiche Menge kaufen, wenn der Preis beträchtlich steigt. In seiner Erklärung beschreibt er dann aber eine starke Reaktion der Nachfrager auf Preisänderungen, das heißt, eine große Preiselastizität. Ja, was denn nun?
Natürlich hätte Friedrich Merz auch einfach sagen können, dass sich viele Menschen Fleisch kaum noch leisten können, wenn dessen Preis zu sehr steigt. Ein wahrer Wirtschaftsexperte aber streut beiläufig einen ökonomischen Fachbegriff ein, auch wenn er den gar nicht richtig verstanden hat, und alle sind schwer beeindruckt von so viel Kompetenz und Expertise.
Die Belastung zukünftiger Generation
Wenn es so etwas wie ein Evergreen der wirtschaftspolitischen Diskussion gibt, dann die Behauptung, dass steigende Staatsschulden eine schwere Bürde für kommende Generationen hinterließen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Bereits im Mai 1963 griff Ex-US-Präsident Dwight D. Eisenhower die damalige Regierung von US-Präsident John F. Kennedy wegen angeblich übermäßiger staatlicher Ausgaben scharf an: „In Wirklichkeit bestehlen wir unsere Enkel, um unsere Wünsche von heute zu befriedigen.“[3] Eigentlich verwunderlich, dass die damalige Enkelgeneration nach dem Erwachsenwerden nicht gegen diesen dreisten Diebstahl auf die Barrikaden gegangen ist …
Auch Friedrich Merz hat in der Vergangenheit immer wieder betont (z.B. hier), dass die Staatsverschuldung eine finanzielle Belastung künftiger Generationen bedeute, denen die Schulden und Zinslasten vererbt würden. So kritisierte er im September 2020 den damaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz wegen dessen „Geldverschwendung“ bei den Corona-Hilfsmaßnahmen:
„Der Finanzminister haut zurzeit das Geld raus, ab gäbe es kein Morgen mehr. Unsere Kinder werden das alles bezahlen müssen.“
Noch drastischer hatte er dies in früheren Zeiten formuliert, als er sich wegen eines von ihm befürchteten Abrückens der ehemaligen rot-grünen Bundesregierung von einem strikten Sparkurs in die Behauptung verstieg, mit der Inkaufnahme höherer Schulden würden „die Sparbücher unserer Kinder zum Plündern freigegeben.“
Nun sollte ein „Wirtschaftsexperte“ eigentlich wissen, dass diese Argumentation schon auf der elementarsten Ebene falsch ist, wie immerhin in einigen Medien zu Recht festgestellt wird:
„Denn die Formel von der Last für die Nachfahren blendet aus, dass auch die entsprechenden Vermögen vererbt werden. Als Steuerzahler erben die Jüngeren zwar die Zahlungspflichten des Staates. Aber auch die Erben der zugehörigen Wertpapiere gehören zur nächsten Generation und erhalten im gleichen Umfang Zahlungsansprüche gegenüber dem Staat, jedenfalls dann, wenn diese Vermögen nicht überwiegend im Ausland gehalten werden. Das ist in Deutschland jedoch nicht der Fall“ (hier).
Wichtig ist aber vor allem, dass Staaten nur selten Schulden zurückzahlen (im eigentlichen Sinne des Wortes). Natürlich tilgen sie ihre Schulden bei Fälligkeit, indem sie auslaufende Staatsanleihen durch neue ablösen[4], aber sie reduzieren fast nie die Gesamthöhe ihrer ausstehenden Verbindlichkeiten, die mehr oder weniger mit dem Umfang der Volkswirtschaft wachsen.
Das lässt sich sehr gut am Beispiel der USA aufzeigen, für die relativ verlässliche lange Zeitreihen zur Verfügung stehen. So ist dort im Zeitraum 1931 bis 2020 in fast jedem Jahr die Bruttostaatsverschuldung gestiegen (in 85 von insgesamt 90 Jahren) – in einer Größenordnung von durchschnittlich 4,42 Prozent des BIP pro Jahr.[5]
Aber müssen nicht trotzdem all diese Staatsschulden irgendwann zurückgezahlt werden, wie auch Merz glaubt? Hier ist wiederum ein Blick in die USA hilfreich[6]: Dort war die US-Bundesregierung seit 1776 in nahezu jedem Jahr verschuldet. Nur ein einziges Mal in der US-Geschichte, nämlich zu Beginn des Jahres 1835, wurde die Staatsschuld vollständig getilgt und für zwei Jahre ein Budgetüberschuss aufrechterhalten. Im Jahr 1837 stürzte dann die Volkswirtschaft in eine tiefe Depression, die den Haushalt ins Defizit brachte. Die US-Bundesregierung ist seitdem – also seit dem Jahr 1837 – ununterbrochen verschuldet, hat mithin bereits 184 Jahre lang ihre Schulden nicht zurückgezahlt, ohne dass daraus irgendwelche Probleme entstanden wären. Und es ist nicht davon auszugehen, dass sich daran in den nächsten 184 Jahren etwas ändern wird.
Aber was ist mit den Zinszahlungen? Und was geschieht, wenn der Staat – aus welchen Gründen auch immer – seinen Gläubigern zumindest einen Teil ihres Geldes per endgültiger Tilgung zurückgeben will? Für einen Staat mit einer souveränen Währung entstehen daraus keine Probleme. Ein solcher Staat unterliegt keinen intrinsischen finanziellen Restriktionen, da er die Währung emittiert, und er leistet seine Zinszahlungen genauso beziehungsweise tilgt seine Schulden final so, wie er allgemein seine Ausgaben bestreitet: Indem er nämlich die erforderlichen Geldmittel von einem Konto bei der Zentralbank an das Geschäftsbankensystem überträgt.[7]
Ein souveräner Staat muss nie die Steuern erhöhen, um Einnahmen zur Bedienung und finalen Rückzahlung seiner Schulden der Vergangenheit zu generieren. Er kann immer seine Ausgaben steigern, wenn es erforderlich ist – und zwar ganz unabhängig davon, ob er zuvor Budgetdefizite oder -überschüsse verzeichnet hat. Vorherige Überschüsse vergrößern nicht seine Fähigkeit, in der Zukunft Ausgaben zu tätigen, genauso wenig wie Defizite diese Fähigkeit schmälern.[8]
Arbeitslosigkeit – ein individuelles Problem?
In einem Interview unterstützte Merz im September 2021 ausdrücklich die Idee der sozialdemokratischen Regierung Dänemarks, Arbeitslose – vor allem Langzeitarbeitslose – zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Man habe sich in Deutschland zuletzt vielleicht zu stark auf das Fördern und zu wenig auf das Fordern konzentriert, um Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zurückzubringen. Merz sagte dazu:
„Da kann das ein geeignetes Mittel sein, sie einfach nicht allein zu lassen, sondern sie wirklich auch mal ein bisschen an der Krawatte zu ziehen und zu sagen, ihr müsst euch auch mal um euch selber kümmern.“
Hier wird – in nette und harmlos klingende Worte verpackt – das gar nicht so nette neoliberale Dogma verkündet, dass Arbeitslosigkeit eigentlich kein makroökonomisches Phänomen sei. Vor der Durchsetzung des Neoliberalismus in den 1980er Jahren wurde Massenarbeitslosigkeit zu Recht als Ausdruck eines systemischen Versagens verstanden, eine genügend hohe Zahl von Arbeitsplätzen zu schaffen. Das Erreichen von Vollbeschäftigung – so die damalige Sicht – erfordere es, dass die nationalen Regierungen die Verantwortung für die Aufrechterhaltung ausreichender Gesamtausgaben zur Schaffung der erforderlichen Arbeitsplätze übernähmen.
In der neoliberalen Ära wurde dieses korrekte Verständnis durch die kontrafaktische Behauptung ersetzt, Arbeitslosigkeit sei ein individuelles Problem. Entsprechend seien die Arbeitslosen selbst schuld an ihrer Situation, weil sie es versäumt hätten, geeignete Qualifikationen zu erwerben, weil sie sich aus verschiedenen Gründen nicht intensiv genug um Arbeit bemühten und/oder weil sie „arbeitsscheu“ geworden und zu wählerisch bei den Stellen seien, die sie anzunehmen bereit wären.[9] Folglich müsse man ihnen etwas auf die Sprünge helfen: höhere Hürden bei Sozialleistungen, Senkung der Arbeitslosenunterstützung, Bewerbungstraining, Ausbildungsprogramme und eben auch eine Arbeitspflicht. Damit würden sie dann schnell wieder arbeitstauglich und müssten die soziale Hängematte verlassen, in der sie es sich bequem gemacht hätten. Sie hätten dann einen stärkeren Anreiz, sich wieder „um sich selbst zu kümmern“ und eine Arbeit aufzunehmen.
Friedrich Merz schließt sich offenkundig dieser Sichtweise an. Wer sich als „Wirtschaftsexperte“ sieht, sollte es eigentlich besser wissen. Denn eine Grundregel der Makroökonomie besagt, dass die Gesamtausgaben in einer Volkswirtschaft ein Volkseinkommen und eine Produktion gleicher Größe erzeugen, was wiederum das Beschäftigungswachstum fördert.
Wenn Arbeitslosigkeit existiert, bedeutet dies, dass die Gesamtausgaben nicht ausreichen, um genügend Produktion und damit Arbeitsplätze zu schaffen, um den Jobwünschen der Arbeitslosen zu entsprechen. Die Lösung besteht dann darin, dass der Staat entweder direkt seine Ausgaben erhöht, um den Umsatz im Privatsektor zu steigern und weitere Einkommen zu stimulieren, und/oder die Steuern senkt, was zu höheren privaten Ausgaben führen kann (wobei Steuersenkungen im Allgemeinen weniger effektiv in der Ankurbelung der Ausgaben sind als direkte Staatsausgaben).
Arbeitslosigkeit entsteht mithin durch unzureichende Ausgaben beziehungsweise einen Mangel an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage – sie ist ein makroökonomisches Problem. Denn wie es der bedeutende US-amerikanische Ökonom Hyman Minsky kurz und prägnant formulierte: „Es ist die aggregierte effektive Konsum-, Investitions-, Staats- und Exportnachfrage, die zu Beschäftigung führt.“[10]
Die neoliberale Behauptung, es komme zu Arbeitslosigkeit, weil der Einzelne sich bei der Arbeitsplatzsuche zu wenig anstrenge, geht völlig an der Sache vorbei. Die Arbeitslosen können nicht nach Arbeitsplätzen suchen, die es nicht gibt.
Der Mindestlohn
Schon lange bevor in Deutschland im Januar 2015 der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde, setzte in den deutschen Medien und bei vielen traditionellen deutschen Ökonomen ein Zeter- und Mordio-Geschrei ein. So warnte etwa Hans-Werner Sinn, ehemaliger Präsident des Ifo-Instituts, im Jahr 2013: „Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro würde nach unseren Schätzungen gut eine Million Arbeitsplätze vernichten.“
Eine grandiose Fehlprognose, wie man heute weiß. Nachdem die vorausgesagten Beschäftigungsverluste nach 2015 ausgeblieben sind, ist es deutlich ruhiger um den Mindestlohn geworden. Friedrich Merz behauptete nun im September letzten Jahres, schon immer ein Befürworter einer Lohnuntergrenze gewesen zu sein:
„Ich war immer für den Mindestlohn. Die entscheidende Frage ist, wer ihn in Zukunft festlegt: Die Tarifvertragsparteien, oder der Gesetzgeber? Aus meiner Sicht sollte dieses Thema in der Mindestlohnkommission bleiben und gehört nicht in den Bundestag.“
Tatsächlich? Ist also der Mindestlohn als solcher uneingeschränkt richtig und nur die Frage zu klären, wer ihn festsetzt? Im Jahr 2006 hörte sich das noch anders an. Da hatte Merz die Ansicht vertreten, dass Mindestlöhne die Marktwirtschaft systematisch außer Kraft setzten und das Gegenteil von dem seien, was Deutschland zur Wiederbelebung des Arbeitsmarktes brauche: „Sie sind das Gegenteil von Marktwirtschaft, das Gegenteil von Wettbewerb und das Gegenteil von dem, was wir brauchen, damit der Arbeitsmarkt wieder in Gang kommt.“
Noch deutlicher wurde Merz zwei Jahre zuvor: „Alle Erfahrungen zeigen, dass mit einem Mindestlohn nicht Probleme gelöst, sondern neue geschaffen werden.“ Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich sei zu einem großen Teil auf den dortigen Mindestlohn zurückzuführen. Merz‘ Schlussfolgerung: „Wer auch nur einen Rest von Verstand bewahrt hat, müsste mit größtem Nachdruck gegen diesen Unsinn auch in Deutschland sein.“
Nun ist es sicherlich nicht verwerflich, seine Meinung zu ändern, aber ein solch radikaler Bruch mit der früheren Position verlangt nach einer Erklärung. Die aber sucht man bei Merz vergeblich. Aber vielleicht handelt es sich bei der Frage nach den Beschäftigungseffekten von Mindestlöhnen ja um eine relativ neue Diskussion, die erst vor rund 15 Jahren richtig begonnen und dabei fundamental neue Erkenntnisse gebracht hat, über die Merz im Jahr 2006 noch nicht verfügen konnte?
Das ist wenig plausibel, denn die Diskussion wird schon seit über einhundert Jahren geführt.[11] Sie erlebte zuletzt in den 1990er Jahren weltweit eine Renaissance, eingeleitet vor allem durch eine einflussreiche Untersuchung von David Card und Alan B. Krueger. Die beiden Princeton-Ökonomen verglichen die Beschäftigungsentwicklung in Fast-Food-Restaurants im US-Bundesstaat New Jersey, in dem im Jahr 1992 der gesetzliche Mindestlohn erhöht wurde, mit der im Nachbarstaat Pennsylvania, in dem es keine solche Mindestlohnanhebung gab, und fanden „keinen Hinweis, dass der Anstieg des Mindestlohns die Beschäftigung verringerte.“[12]
Die Card/Krueger-Studie löste einen großen Anstieg theoretischer und vor allem empirischer Untersuchungen zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen aus. Interessant ist nun, dass zahlreiche empirische Studien, die im Gefolge der Arbeit von Card/Krueger entstanden, ebenso zeigen, dass von Mindestlöhnen respektive Mindestlohnerhöhungen keine signifikanten negativen Beschäftigungseffekte ausgehen; einige Untersuchungen weisen sogar positive Auswirkungen auf die Beschäftigung nach. Und viele dieser Studien erschienen bereits vor 2006, d.h. dem Jahr, in dem Merz Mindestlöhne noch kategorisch ablehnte.[13] Warum sich Merz also noch im Jahr 2006 vehement gegen Mindestlöhne aussprach, neuerdings aber (und angeblich schon immer) dafür ist, erschließt sich nicht. Auf einer fundierten Analyse basiert dieser Schwenk wohl kaum, eher auf relativ beliebigen Ad-hoc-Überlegungen. Kompetenz sieht anders aus.
Der vorliegende Beitrag stammt aus dem Online-Magazin Makroskop. Er wurde der „Osnabrücker Rundschau“ freundlicherweise zum Abdruck zur Verfügung gestellt.
[1] Keynes, J.M.: The General Theory of Employment, Interest and Money, London/Melbourne/Toronto 1967, S. 207; Übersetzung G.G.
[2] Zu unterscheiden ist bei der Preiselastizität genau genommen zwischen Bogen- und Punktelastizität. Wir beschränken uns hier auf die Bogenelastizität, bei der – im Unterschied zur Punktelastizität – endliche (und nicht infinitesimal kleine) Änderungen der Variablen betrachtet werden. Im Fall einer linearen Funktion – z.B. Preis-Absatz-Funktion – sind Bogen- und Punktelastizität identisch, ansonsten weichen die jeweiligen Werte voneinander ab.
[3] Zitiert nach Mishan, E.J.: 21 Popular Economic Fallacies, Harmondsworth 1971, S. 73; Übersetzung G.G.
[4] Das heißt: Diejenigen Staatsanleihen, deren Laufzeit zu Ende ist, werden durch Neuemissionen ersetzt, wobei die Einnahmen aus den neuen Anleihen einfach zur Rückzahlung der alten Anleihen verwendet werden. Theoretisch lässt sich dies bis zum Sankt-Nimmerleinstag fortsetzen – in diesem Fall hätte man gewissermaßen „ewige Anleihen“ mit wechselnden Gläubigern.
[5] Vgl. Tymoigne, E.: Seven Replies to the Critiques of Modern Money Theory, in: Levy Economics Institute, Working Paper No. 996, S. 12.
[6] Vgl. Wray, R.: Godley Got It Right, in: Papadimitriou, D./Zezza, G. (eds.), Contributions to Stock-Flow Modeling – Essays in Honor of Wynne Godley, New York 2012, S. 36-62.
[7] Wenn der Staat Waren, Dienstleistungen oder auch Arbeitsleistungen vom Privatsektor kauft, verwendet er dazu Einlagen bei der Zentralbank. Der jeweilige Verkäufer gibt dem Staat sein Bankkonto an und der Staat überweist der entsprechenden Bank diese Einlagen, die für die Bank eine Forderung darstellen. Die dazu gehörige Verbindlichkeit (aus einer bilanziellen Perspektive) sind dann die Einlagen, die die Bank dem Verkäufer gutschreiben muss. Kurzum: Es kommt zu einer gleichzeitigen Gutschrift auf das Bankkonto des Verkäufers und auf das Reservekonto der Bank bei der Zentralbank. Vgl. dazu ausführlicher Paetz, M./Grunert, G.: Fiskalpolitik im 21. Jahrhundert, in: Makroskop – Magazin für Wirtschaftspolitik 2021, S. 48-55.
[8] Wenn hier festgestellt wird, dass Staaten keinen intrinsischen finanziellen Restriktionen unterworfen sind, so heißt dies natürlich nicht, dass dort keinerlei Regeln für die „Haushaltsdisziplin“ (z.B. Defizit- und Schuldengrenzen) existieren können. Erst recht nicht dann, wenn Länder eine Währung verwenden, die sie nicht selbst schaffen können und nicht kontrollieren, wie es etwa in den einzelnen Ländern der Eurozone gegeben ist. In diesem Fall aber basieren solche Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten auf politischen Entscheidungen und nicht etwa auf ökonomischen Notwendigkeiten.
[9] Vgl. Mitchell, W.: Eurozone Dystopia – Groupthink and Denial on a Grand Scale, Cheltenham 2015, S. 229ff.
[10] Minsky, H.: Can ‘It‘ Happen Again? – Essays on Instability and Finance, New York 1982, S. 95; Übersetzung G.G.
[11] Vgl. etwa Webb, S.: The Economic Theory of a Legal Minimum Wage, in: The Journal of Political Economy, Vol. 20, No. 10, 1912, S. 973-998.
[12] Card, D./Krueger, A. B.: Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania, in: The American Economic Review, Vol. 84, No. 4, 1994, S. 772; Übersetzung G.G.
[13] Vgl. z.B. Benhayoun, G.: The Impact of Minimum Wages on Youth Employment in France Revisited: A Note on the Robustness of the Relationship, in: International Journal of Manpower, Vol. 15, Issue 2-3, 1994, S. 82-85; Card, D./Krueger, A.B.: Myth and Measurement – The New Economics of the Minimum Wage, Princeton 1995; Card, D./Krueger, A.B.: A Reanalysis of the Effect of the New Jersey Minimum Wage Increase on the Fast-Food Industry with Representative Payroll Data, in: NBER Working Paper 6386, 1998; Dolado, J. J./Felgueroso, F./Jimeno, J. F.: The Role of the Minimum Wage in the Welfare State: An Appraisal, in: IZA DP No. 152, 2000; Stewart, M. B.: The Impact of the Introduction of the UK Minimum Wage on the Employment Probabilities of Low-Wage Workers, in: Journal of the European Economic Association, Vol. 2, Issue 1, 2004, S. 67-97; Dickens, R./Draca, M.: The Employment Effects of the October 2003 Increase in the National Minimum Wage, Centre for Economic Performance, in: CEP Discussion Paper No 693, 2005.