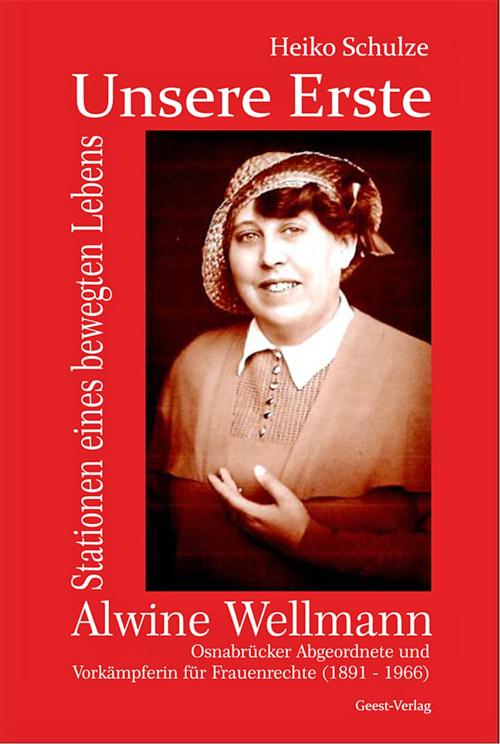Heute vor 82 Jahren fand die Deportation jüdischer Bürgerinnen und Bürger aus Osnabrück nach Riga statt
„Dann kam die ‚Kristallnacht‚, und danach war sie weg. Ich habe sie nie wieder gesehen und erst nach dem Krieg erfahren, daß sie mit ihrer ganzen Familie im KZ umgekommen ist.“ So oder ähnlich enden die meisten Zeitzeugenberichte aus Osnabrück, die den Eindruck vermitteln, die jüdischen Bekannten oder Nachbarn hätten sich einfach in Luft aufgelöst. Fast alle Erinnerungen enden abrupt nach den verharmlosend „Kristallnacht“ genannten Novemberpogromen. Aber die jüdischen Osnabrückerinnen und Osnabrücker waren nach dem Brand ihrer Synagoge keineswegs verschwunden. Von der Pogromnacht am 9. November 1938 vergingen noch drei volle Jahre bis zur ersten Deportation aus Osnabrück am 13. Dezember 1941, heute vor 82 Jahren.
Die etwa 90 nach Buchenwald deportierten Osnabrücker kehrten bis auf drei Männer, die dort ermordet wurden, nach einigen Wochen oder Monaten zurück – abgemagert, traumatisiert und mit geschorenen Köpfen. Man hatte ihnen gedroht, sie wieder in das Konzentrationslager zurückzubringen, wenn sie über ihre Erlebnisse reden würden. Aber schon die Begegnung mit ihnen sagte mehr als viele Worte. Fredrick S. Katzmanns Vater war es gelungen, Auswanderungspapiere für ihn zu bekommen, denn wer nachweisen konnte, dass er auswandern wollte, wurde eher aus dem Konzentrationslager entlasssen. Katzmann berichtete, dass eine „arische“ Mieterin im Haus der Familie an der Möserstraße bei seiner Rückkehr aus Buchenwald weinte: „Wenn sie von der Existenz von Konzentrationslagern nichts gewusst hatte, konnte sie es jetzt nicht länger leugnen.“ Im April 1939 gelang es Frederick S. Katzmann dank eines amerikanischen Visums, seine Heimatstadt Osnabrück zu verlassen „mit dem Gedanken, dass ich nie wieder zurückkommen würde“.
Der überhastete Aufbruch ins Ausland, die Notverkäufe des Eigentums, die Frauen und Kinder, die zunächst oft allein zurückblieben – das alles kann in einer Stadt von der Größe Osnabrücks nicht unbemerkt geblieben sein. Die jüdischen Bürgerinnen und Bürger wurden zwar aus ihren Wohnungen überall in der Stadt in immer weniger Häusern konzentriert, mussten aber Zwangsarbeit im Straßenbau oder kriegswichtigen Industriebetrieben leisten und begegneten dabei täglich Arbeitskolleginnen und -kollegen. Wer wollte, konnte sie auch in den „Judenhäusern“ durchaus noch finden – und ihnen sogar helfen und unterstützen, als sie auf ihre mit einem „J“ gekennzeichneten Lebensmittelkarten kleinere Rationen als der Rest der Bevölkerung und weder Fleisch noch Fisch, Milch, Obst oder Gemüse mehr erhielten. Doch die meisten schauten weg und verdrängten, was sie in den drei Jahren zwischen dem Brand der Synagoge und dem Einsetzen der Deportationen sahen – so wie die Judensterne, an die sich eine Osnabrückerin erinnerte: „Für einige Zeit sah man im Stadtbild öfters Menschen, die einen Judenstern an ihrer Kleidung trugen, traurige, verhärmte Gestalten. Ich erlebte nie, dass jemand diese Leute ansprach, es wurde einfach weggeschaut.“
Den jüdischen Familien war nach den Novemberpogromen klar, dass sie in Deutschland in Lebensgefahr waren. Sie setzten alles daran, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Doch das gelang vielen nicht mehr rechtzeitig. Rudolf Stern beabsichtigte, nach Kanada oder Amerika auszuwandern, hatte aber vom amerikanischen Konsulat die Mitteilung bekommen, dass er erst zwischen Februar und Dezember 1941 mit der Erteilung eines Visums rechnen könne. Kurz vor Ablauf dieser Frist, am 13. Dezember 1941, wurde er von Osnabrück nach Riga deportiert. Rudolf Stern fehlte das notwendige Visum, vielen die notwendigen Finanzmittel für eine Auswanderung. Hermann Schoeps war aufgrund der „Arisierungen“ arbeitslos und erhielt für seine vierköpfige Familie wöchentlich zwanzig Reichsmark vom Arbeitsamt. Das reichte nicht zum Leben und schon gar nicht für die Kosten der Auswanderung. Doch jüdische Hilfsorganisationen unterstützten bei vielen Fluchten in letzter Minute. Die Familie Schoeps hatte ihr Hab und Gut bereits verpackt und der Hilfsverein eine Anzahlung für die Schiffspassage nach Shanghai beim Norddeutschen Lloyd geleistet. Der Lloyd teilte Hermann Schoeps am 12. Mai 1939 mit, dass Ende Mai wahrscheinlich ein Sonderdampfer nach Shanghai fahren werde. Sollte dieses Schiff nicht abgefertigt werden, so werde man alles tun, um die Familie auf einem der nächsten Dampfer unterzubringen. Die Familie solle sich bereithalten, denn es gäbe immer die Möglichkeit, dass in letzter Minute noch Plätze frei würden. Der Andrang war groß – viele versuchten in letzter Minute nach Shanghai zu flüchten. Doch die Familie Schoeps erreichte das rettende Schiff nicht mehr. Hermann und Julie Schoeps wurden heute vor 82 Jahren mit dem 15jährigen Simon-Siegbert und der 18jährigen Tochter Margot nach Riga deportiert und gelten seitdem als „verschollen“.
Die letzte Nacht mussten die 34 Menschen, die für die Deportation bestimmt worden waren, in der Turnhalle der Pottgrabenschule in der Nähe des Bahnhofs verbringen – ohne Betten, auf aufgeschüttetem Stroh. Als eine Osnabrücker Sozialdemokratin ihren jüdischen Bekannten Thermoskannen mit Kaffee in die Turnhalle brachte, sagte der Gestapobeamte am Eingang zu ihr: „Die sehen sie sowieso nicht wieder. Gehen Sie man rein und nehmen Abschied.“ Irmgard Ohl beschrieb die Details der Deportation: „Wir übernachteten auf Strohlagern und wurden am nächsten Morgen unter Begleitung der Gestapo zum Bahnhof geführt. Unser Großgepäck wurde in einen besonderen Waggon geladen. Als der Zug auf dem Osnabrücker Bahnhof einlief, brachte er schon die Juden aus Münster/Westf. und Umgebung. Mit groben Worten der Gestapo wurden wir in die Abteile getrieben und ab ging der Zug.“ Der Deportationszug fuhr von Osnabrück zunächst nach Bielefeld. Von dort ist die Reaktion der Bevölkerung auf den Abtransport überliefert: „Es muß festgestellt werden, daß die Aktion von dem weitaus größten Teil der Bevölkerung begrüßt wurde. Einzeläußerungen war zu entnehmen, daß man dem Führer Dank wisse, daß er uns von der Pest des jüdischen Blutes befreie.“ Reaktionen aus Osnabrück sind nicht bekannt. Die Deportationen fanden in der Folge aber weiter öffentlich statt, während sie etwa in Hamburg nach kritischen Äußerungen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer bei den weiteren Transporten in die Nachtstunden verlegt wurden. Von Osnabrücker Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die sich aufgrund eines Aufrufs in der Lokalzeitung meldeten, um über ihre Erinnerungen an jüdische Osnabrückerinnen und Osnabrücker zu berichten, wurde vielfach behauptet, dass man von den Deportationen nichts mitbekommen habe und sie daher wohl heimlich „bei Nacht und Nebel“ stattgefunden haben müssten. Tatsächlich gab es den Nebel nur in der Erinnerung der Zeuginnen und Zeugen. Die Deportationen fanden wie auch in anderen deutschen Städten am hellen Tag statt.
Die Deportierten klammerten sich an die Hoffnung, dass es tatsächlich nur zu einem Arbeitseinsatz ging, und packten Arbeitskleidung und warme Sachen ein. Sie ahnten nicht, dass am Tag, bevor sie am Osnabrücker Bahnhof in einen Zug mit unbekanntem Ziel stiegen, in Berlin eine Tagung der Reichs- und Gauleiter der NSDAP stattgefunden hatte, bei der Hitler „ungewöhnlich explizit“ seine Entscheidung deutlich gemacht hatte, alle Juden Europas zu ermorden. Bereits am 31. Juli 1941 war der Leiter des Reichssicherheitshauptamts, Reinhard Heydrich, mit der Vorbereitung der „Endlösung der Judenfrage“ beauftragt worden.
Erstaunlich ist, wie genau anscheinend viele Menschen bei dieser ersten Deportation schon ahnten, was mit den jüdischen Menschen geschehen würde. Aus „konfessionellen Kreisen“, die sich wie üblich ablehnend gegenüber der staatlichen Aktion gezeigt hätten, wurden laut Bericht der Hauptaußenstelle des Sicherheitsdienstes in Bielefeld „die wildesten Gerüchte verbreitet“: Die Juden würden zunächst zwar mit Personenwagen transportiert, dann aber in Viehwagen weiter in den Osten gebracht (die Gerüchte sprachen hier von Russland), wo sie Zwangsarbeit in Fabriken leisten müssten, „während die älteren und kranken Juden erschossen würden“. Was der SD als „wildeste Gerüchte“ bezeichnete, war die grausame Wahrheit.
Der sogenannte Bielefelder Transport führte nach Riga in Lettland. Er wurde mit ungeheizten Personenwagen der Reichsbahn durchgeführt und von der örtlichen Schutzpolizei, nicht der Gestapo begleitet, die dafür keine ausreichende Personalkapazität hatte. Drei Tage und zwei Nächte verbrachten die Menschen bei eisigen Temperaturen in den Waggons – ohne Verpflegung oder auch nur etwas zum Trinken zu erhalten. Einer der überlebenden Deportierten, Heinz Wertheim aus Gildehaus, berichtete seiner Frau, dass auf dem Transport einige Menschen aus Angst wahnsinnig geworden seien. Bei der Ankunft auf dem Güterbahnhof in Riga begegneten die Deportierten einer bis dahin nicht gekannten Brutalität. Unter ihnen war der 15jährige Ewald Aul, der die Ankunft in einem nach seiner Befreiung verfassten Bericht beschrieben hat: „In Skirotava jagte uns die SS mit schweren Stöcken und Eisenstangen aus den Waggons und den langen beschwerlichen Weg nach Riga vor sich her.“ Neben der Brutalität wurden die Menschen noch mit der heftigsten Kälte konfrontiert. Bei der Ankunft auf dem etwa acht Kilometer südöstlich von Riga gelegenen Güterbahnhof herrschten Temperaturen zwischen minus 25 und minus 30 Grad. Unter den Deportierten aus Osnabrück waren auch die vierjährigen Zwillinge Edith und Carl Stern und ihre siebenjährige Schwester Ruth-Hanna mit ihren Eltern. Wer von dem Bielefelder Transport den acht Kilometer langen Fußmarsch durch die eisige Kälte in das mit Stacheldraht umzäunte Ghetto nicht schaffte, wurde gleich nach der Ankunft in Riga ermordet, ebenso alle, die ein körperliches Gebrechen hatten. Die Opfer wurden zu Massengräbern im Wald von Bikernieki gebracht und dort erschossen. Nur wer Zwangsarbeit leisten konnte, wurde zunächst am Leben gelassen.
Bei der Ankunft im Rigaer Ghetto fanden die Osnabrücker Familien dort Wohnungen vor, die sich in einem wüsten Durcheinander befanden und offensichtlich von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern in großer Hast verlassen worden waren. Töpfe mit eingefrorenem Essen standen auf dem Herd, Essensreste noch auf dem Tisch. „Das muss man sich mal vorstellen: Im Backofen war noch ein warmer Braten. Oben auf dem Schrank lag bündelweise Geld. Wir dachten, sie wären spazieren“, berichtete Wilhelm Polak aus Papenburg. Die Neuankömmlinge ahnten, dass sich hier Furchtbares abgespielt haben musste. In der Tat waren die vorherigen Bewohnerinnen und Bewohner von Schutzpolizisten auf brutalste Art aus ihren Wohnungen getrieben worden. Man hatte ihnen eine halbe Stunde Zeit gegeben, um sich zum Abmarsch aus dem Ghetto zu einer angeblichen Umsiedlung bereit zu machen. Doch die Mahlzeiten, die noch auf dem Tisch standen, waren ihre letzten gewesen. Um Platz für die aus dem Reich deportierten jüdischen Menschen zu machen, waren in Riga am 30. November, dem „Rigaer Blutsonntag“, und den Tagen danach 26.500 lettische Jüdinnen und Juden von der SS und lettischen Einsatzkommandos im Wald von Rumbula ermordet worden. „Alte, Kranke und Invaliden wurden in ihren Betten erschossen, Kinder von betrunkenen Nazi- Schergen aus den Fenstern geworfen, die Mehrheit wie Vieh über Kilometer hinweg bis in den Wald vom Rumbula gescheucht. Wer nicht schnell genug laufen konnte, den trafen Kolbenschläge oder der Schuss ins Genick.“
Die Menschen des Bielefelder Transportes wohnten fortan in den Wohnungen der Ermordeten. Von den Transporten aus Berlin, Leipzig, Wien, Prag und Dortmund, die nach ihnen ankamen, wurden nur noch die kräftigen jungen Leute verschont, alte und schwache Menschen gleich nach der Ankunft ermordet. Ewald Aul musste in einer Dienststelle arbeiten, die direkt dem SS- und SD-Kommandanten von Lettland, Rudolf Lange, unterstellt war. „In dieser SS-Dienststelle mußten wir die Koffer auspacken, die den ankommenden Juden abgenommen wurden. Anhand der Koffer konnten wir feststellen, aus welchen Transporten sie stammten. So konnten wir erkennen, daß viele Transporte gar nicht mehr im Ghetto ankamen, daß man sie gleich nach ihrer Ankunft im Bikernieker Wald umgebracht hat. Unter der Bewachung von mehreren SS-Leuten mußten wir den Inhalt der Koffer nach Textilien, Lederwaren und Wertgegenständen trennen. Nach jeweils 14 Tagen wurden die Sachen mit einem LKW nach Berlin gebracht, dessen Fahrer übrigens ein Osnabrücker, mit dem Namen Offer, war. Zu dieser Fracht kamen dann noch die Wertgegenstände, die man den Juden kurz vor ihrer Ermordung abnahm: Uhren, Ringe, Broschen, Ketten und die herausgebrochenen Goldzähne und Brücken. Hier haben wir auch die SS-Mordkommandos beobachten können, wenn sie mit den schweren Maschinengewehren zum Bikernieker Wald losfuhren. Abends kamen sie dann total verdreckt und staubverschmiert wieder zurück. Und immer am darauffolgenden Tag kamen dann die Koffer der ermordeten Juden bei uns an, die dann auf Weisung der SS ausgeraubt wurden.“
Auch in Osnabrück bereicherte man sich nach der Deportation, die nach der Elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom November 1941 den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zur Folge hatte. Dadurch fiel das gesamte Vermögen an den deutschen Staat. Die Verwertung des Eigentums wurde sogenannten Vermögensverwertungsstellen der Finanzverwaltung übertragen. Auch die Liegenschaften – fünfzehn von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern enteignete Häuser in Osnabrück – wurden vom Finanzamt verwaltet, das auch die Mieten vereinnahmte. Der Vorsteher des Finanzamtes berichtete am 23. Mai 1942, die sechs Wohnungen im „Judenhaus“ Kommenderiestraße 11 würden sich „wegen der niedrigen Mieten für Beamte und Angestellte mit kleinem Einkommen besonders eigenen. Da in absehbarer Zeit mit dem Abtransport der restlichen Juden gerechnet werden kann, würde das Grundstück für Wohnzwecke alsdann frei werden.“
Der übrige zurückgelassene Besitz wurde versteigert. Allein zwischen März 1943, als die dritte Deportation von Osnabrück stattfand, und November 1944 kauften etwa 2.500 Osnabrückerinnen und Osnabrücker bei 111 Versteigerungen billig Mobiliar, Geschirr, Wäsche und Haushaltsgegenstände von deportierten Jüdinnen und Juden. Einer der Überlebenden der Deporatation nach Riga, der Osnabrücker Kaufmann Rudolf Stern, entdeckte 1950 seinen mit handgeschnitzten Ornamenten versehenen dreitürigen Bücherschrank stark ramponiert in einem Zimmer des Finanzamtes, das ihn als Aktenschrank nutzte.
Rudolf Stern litt nach seiner Rückkehr an den Folgen einer schweren Kopfverletzung, die er im Januar 1942 bei Misshandlungen in Riga erlitten hatte und konnte sich als Selbständiger ohne Krankenversicherung die notwendigen Kuren nicht leisten. Es dauerte zehn Jahre, bis ihm im Rahmen des Entschädigungsverfahrens 1955 endlich die Übernahme der Kosten für Heilverfahren bewilligt wurden. Er starb zwei Jahre später im Alter von nur sechzig Jahren in Osnabrück. Außer ihm kehrten von den 34 aus Osnabrück Deportierten nur vier Personen aus dem Konzentrationslager zurück.