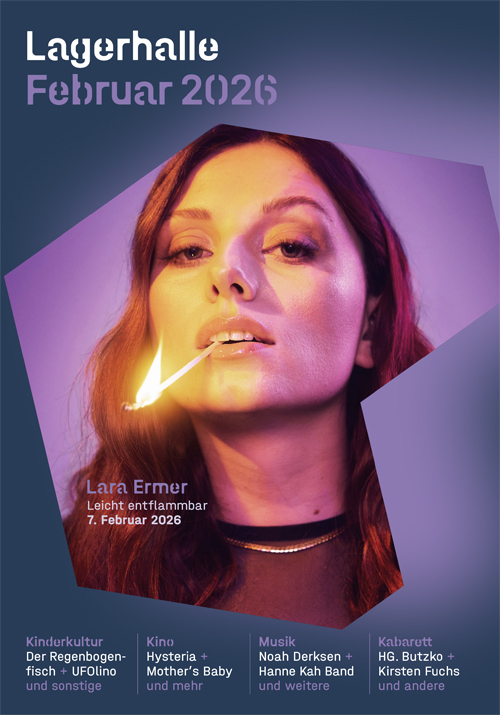Ermordet wegen einer weißen Fahne
Einen Tag, bevor in Osnabrück mit der Einnahme der Stadt durch die Alliierten Streitkräfte der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, kam es zu einer Tragödie im Osten von Osnabrück. Am 3. April 1945 wurde eine Bäuerin auf ihrem Hof durch einen Pistolenschuss getötet. Als mögliche Täter wurden zwei örtliche Nazifunktionäre und der zu der Zeit amtierende Oberbürgermeister ausgemacht.
Hundegebell begleitet mich, als ich an einem sonnigen Nachmittag in diesen letzten Tagen des März auf das Gelände eines Bauernhofes an der Nordstraße fahre. Das Hofgelände ist sauber und aufgeräumt und wirkt sehr gepflegt, so ganz anders als die Bauernhöfe meiner lange zurückliegenden Kindheit. Trotz des Gebells aus dem Zwinger ist kein Mensch zu sehen. An der Haustür eines modernen Wohngebäudes, das neben den älteren Hofgebäuden steht, klingle ich. Nach kurzer Zeit öffnet mir eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm und einem Kleinkind, das mich neugierig hinter einem Bein ihrer Mutter hervor anblickt. Nichts deutet darauf hin dass an diesem Ort vor 80 Jahren ein schrecklicher Mord geschah.
Heike Daumeyer ist die Urenkelin von Anna Daumeyer. Ihr Vater Gregor und ihr Ehemann Jörn sind gerade auf dem Acker mit der landwirtschaftlichen Frühjahrsarbeit beschäftigt. Als ich sie nach Anna Daumeyer frage, erzählt sie mir, dass in ihrer Familie nicht viel über dieses Geschehen gesprochen wurde. Ihr Großvater Heinrich, einer der drei Söhne von Anna Daumeyer war im Krieg mit Hitlers Wehrmacht im Einsatz ebenso wie der andere Sohn Johannes. Auf dem Hof war nur Franz, der jüngste Sohn von Anna Daumeyer.
Die Vorgeschichte
Die Ostertage des Jahres 1945 waren gerade vorüber, und der Morgen des 3. April begann mit einem durchdringenden Landregen. Über der Stadt lag noch Dunkelheit. „Volkssturmmänner“, die letzte Reserve an der „Heimatfront“, hatten diese Barrikaden notdürftig errichtet und flohen jetzt endlich vor den herannahenden Panzerspähwagen der Briten. Offiziell war der Volkssturm schon am Vorabend aufgelöst worden.
Am Zaun eines Bauernhofs im Osten Osnabrücks im Stadtteil Schinkel hing eine weiße Fahne. Eigentlich war es keine richtige Fahne. Eher ein weißes Tuch, das von einem Bettlaken abgetrennt worden war. Das Stück weißer Stoff hing an einem Zaun an der Nordstraße am Stadtrand von Osnabrück und flatterte leicht im Wind. Ein Symbol der Sehnsucht nach Frieden in diesen Zeiten, aber es war verboten.
Verboten von einem „braunen“ Regime selbsternannter „Herrenmenschen“, das weite Teile der Länder in Mitteleuropa mit brutaler Gewalt überfallen und in seinem Rassenwahn Millionen unschuldige Menschen verfolgt und ermordet hatte. An diesem Tag lag dieses mörderische Regime an allen Fronten in seinen letzten Zügen, denn die Befreier standen förmlich vor der Tür. Die Bevölkerung sollte „seinen Mann stehen bis zum Endsieg“, hieß es im Jargon der braunen Diktatur. Doch das galt offenbar nicht für jene in den braunen Uniformen, die diese Parolen unablässig ausgegeben hatten …
Bis zum Nachmittag hatten die örtlichen Naziführer im Bunker an der Redlinger Straße ausgeharrt, wo die zentrale Leitstelle der Stadt eingerichtet worden war. Dies waren: der ehemalige NS-Gauinspekteur und amtierende NSDAP-Kreisleiter Osnabrücks Fritz Wehmeyer, mit seinem Adjutanten Deeke, der aus den Niederlanden geflüchtete Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Zeeland und ehemalige NSDAP-Kreisleiter Willi Münzer, sein ehemaliger Adjutant und Kreisorganisationsleiter Heinrich Niebaum sowie der Osnabrücker Oberbürgermeister Dr. Erich Gaertner.
An diesem Dienstag nach Ostern trudelten im Bunker an der Redlinger Straße laufend die Meldungen aus dem gesamten Stadtgebiet über die Aktivitäten der Alliierten Angreifer ein. Am Nachmittag begann der Sturm auf die Heeresmagazine auf dem Gelände der Winkelhausenkaserne an der Netter Heide. Mit dem Abzug der deutschen Truppen hatte die deutsche Bevölkerung und mit ihnen die große Zahl der Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter, die keine Aufsicht mehr hatten, damit begonnen, aus den Magazinen herauszuholen, was an Lebensmitteln herauszuholen war. Aus zunächst Hunderten wurden bis zum Abend Zehntausende.
Die Osnabrücker Naziführer flüchten und morden
Als das Motorengeräusch der heranrückenden Alliierten im Laufe des Tages auch aus Richtung Eversburg zu vernehmen war, machte sich die braune Elite Osnabrücks aus dem Staub. Nahezu fluchtartig verließen Erich Gaertner, Willi Münzer, Fritz Wehmeier und die anderen Nazigrößen in aller Eile ihr Versteck im Redlinger Bunker und bewegten sich mit ihren Fahrzeugen in Richtung Osten, um sich nach Oldenburg oder Bremen abzusetzen. Dazu nahmen sie den Weg über die Nordstraße. Etwa gegen 18:30 Uhr erreichten sie den nahe der Straße gelegenen Bauernhof Daumeyer und sahen ein weißes Stück Stoff, das deutlich sichtbar an einen Zaunpfahl genagelt war. Trotz ihrer Eile hielten die Männer mit ihren Autos auf dem Hof an und stiegen aus. Einer von ihnen klopfte an die Tür des Hofgebäudes und fragte: „Wer hat die weiße Fahne gehisst?“
Franz, der Sohn von Anna Daumeyer-Bitter, hielt sich im Badezimmer auf und konnte von dort hören, wie seine Mutter durch die geschlossene Tür rief: „Ich“, obwohl er wusste, dass sie es nicht gewesen sein konnte. Als seine Mutter auf die weitere Frage „Wohnen hier Deutsche oder Ausländer?“ antwortete: „Deutsche“, fiel ein Schuss, der Anna Daumeyer in den Kopf traf und sie tötete. Weitere Schüsse verletzten die polnische Zwangsarbeiterin Stanislawa Bugdalski, die sich aufs Bett fallen ließ und tot stellte. Trotz einer Kugel, die in ihrer Schulter steckte, überlebte sie. Ihr jüngerer Bruder Boleslaw Bugdalski, der mit einer Mistforke in der Dielentür stand, blieb unbehelligt. Eine weitere Kugel durchschlug nach den Angaben von Franz Daumeyer die Holzdecke und traf das Bein eines französischen Kriegsgefangenen, der sich auf dem Dachboden versteckt hatte.
Wer war Anna Daumeyer?

Was für ein Mensch war eigentlich Anna Daumeyer-Bitter? Von Franz Daumeyer und seinen Brüdern Johannes und Heinrich wird die Mutter als warm und herzlich beschrieben, die stets viel Verständnis für die erbärmliche Situation der Zwangsverschleppten aufbrachte. Auf dem Hof hätten sich in einem Raum neben der Diele oft polnische Zwangsarbeiter aus der Umgebung getroffen. Diese Zusammenkünfte seien von Boleslaw Bugdalski organisiert worden und Anna Daumeyer-Bitter habe diese Zusammenkünfte stillschweigend gebilligt.
Zudem sei sie nicht sehr vorsichtig mit ihren Äußerungen gewesen und habe die Endsiegparolen nicht mehr hören können. Wenn Kriegstote bei Verwandten oder Nachbarn zu beklagen waren, habe sie offen geäußert, dass wieder ein unschuldiges Leben für diese Verbrecherclique geopfert worden sei. Den Zwangsarbeitern aus Polen und der Ukraine sei sie mit Wärme und Herzlichkeit begegnet. Trotz schwerer Strafandrohung hätten alle mit am Tisch der Familie sitzen dürfen, denn ihre Mutter habe gesagt: „Wer hier arbeitet, soll auch hier essen.“
Symptomatisch für den Umgang der Familie Daumeyer mit den menschenverachtenden Regelungen des Naziregimes ist auch ein Foto, das den ältesten Sohn Heinrich mit dem polnischen Zwangsarbeiter Boleslaw Bugdalski zeigt: Beide haben ihre Jacken getauscht, sodass Heinrich die Jacke mit dem aufgenähten stigmatisierenden „P“ trägt.
Die Hintergründe für Annas Ablehnung der Ungleichbehandlung von Menschen mag ihre Ursache darin haben, dass sie als Tochter einer minderbegüterten Familie in einem Kotten an der Windthorststraße aufgewachsen ist. Bevor sie den Hoferben Heinrich Daumeyer heiratete und mit ihm drei Söhne bekommen hat, hatte sie als Magd gearbeitet. Nachdem ihr herzkranker Ehemann 1933 gestorben war, heiratete sie Bernhard Bitter, der ihre menschliche Grundhaltung und die Ablehnung des Naziregimes teilte.
Anton Timmers, ein junger niederländischer Zwangsarbeiter, der sich von der Organisation Todt abgesetzt hatte, wurde von den Daumeyers ebenfalls auf dem Hof versteckt. Wie sich später herausstellte, war er es, der zusammen mit Franz Daumeyer das weiße Stück Stoff an dem Zaun angebracht hatte, als die Briten die Stadt erreichten. Und Anna Daumeyers Sohn war sich nicht einmal sicher, ob seine Mutter überhaupt davon gewusst hatte …
Die Nazigrößen, die noch tags zuvor großmäulig getönt hatten, dass jeder die verdiente Strafe erhalten werde, der sich kampflos dem Feind ergebe, und den Mord auf dem Hof Daumeyer begingen, stahlen sich jetzt davon. Doch sie kamen nicht weit.
In der Nähe von Ostercappeln wurde der erste Wagen mit NS-Kreisleiter Fritz Wehmeier plötzlich von britischen Panzerwagen unter Maschinengewehrfeuer genommen. Wehmeier wurde durch einen Bauchschuss schwer verletzt und starb einen Tag später im Krankenhaus in Ostercappeln. Sein Adjutant Deeke wurde durch einen Kopfschuss auf der Stelle getötet, während Münzer leicht verwundet wurde und der vierte Wageninsasse unverletzt blieb. Oberbürgermeister Gaertner und Ex-Kreisleiter Münzer wurden schließlich von den Briten gefangen genommen und in ein Internierungslager gesteckt. Münzer wurde später an die Niederlande ausgeliefert.
Am Mittwoch, dem 4. April 1945, marschierten britische Truppen in die Stadt Osnabrück ein. Der Krieg in Osnabrück war zu Ende.
Untersuchung des Mordes? Fehlanzeige!
Wer von den Dreien geschossen hat und für den Tod von Anna Daumeyer-Bitter verantwortlich war, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Oder sollte es das vielleicht auch gar nicht? Offenbar scheinen sich die für die Strafverfolgung zuständigen Justizbehörden nur sehr oberflächlich um eine Aufklärung bemüht zu haben, denn 1951 handelte sich die Staatsanwaltschaft Osnabrück deshalb eine Rüge der vorgesetzten Dienststelle in Oldenburg ein.
Die Augenzeugen, die den Mord womöglich hätten aufklären können, waren nicht erreichbar: Die ehemaligen Zwangsarbeiter waren ausgewandert oder in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Die Frage, ob es nach Kriegsende Versuche gab, diese Augenzeugen zu befragen oder ob es überhaupt eine Untersuchung dieses Mordfalls gegeben hat, muss offen bleiben. Belege dafür finden sich in den Archiven nicht.
Erst 1995 berichtete der NOZ-Journalist Rainer Lahmann-Lammert über ein Telefoninterview mit zwei der ehemaligen Zwangsarbeiter, die mittlerweile im australischen Adelaide lebten. Leider konnten sie sich nur daran erinnern, „dass zwei Männer in braunen Uniformen und einer in Zivil auf den Hof an der Nordstraße kamen.“ Boleslaw Bugdalski wusste noch, dass ihm der damals 16-jährige Franz Daumeyer zugerufen habe: „Unsere Mutter ist totgeschossen!“ An Einzelheiten oder gar an die Gesichter der drei Männer habe er sich nicht mehr erinnern können.
Die Nachkommen der Familie Daumeyer werden durch meine Anfrage noch einmal mit dem Todesfall ihrer Vorfahrin konfrontiert. „Ich habe noch mit den anderen Nachkommen von Anna Daumeyer gesprochen“, schreibt mir Heike Daumeyer ein paar Tage später. Ein paar Fotos von Anna Daumeyer konnten auf den Dachböden noch ausfindig gemacht werden. Allerdings habe sich auch bestätigt, dass unter den Söhnen über die Umstände des Todes ihrer Mutter kaum gesprochen wurde. „Franz hat über die Ereignisse selbst, wenn überhaupt, nur ungern gesprochen“, heißt es. „Die möglichen Gründe dafür wird jeder nachempfinden können: Durch das Anbringen der weißen Fahne wollte er eigentlich nur ein Symbol des Friedens setzen. Dass dadurch, einen Tag vor Kriegsende in Osnabrück, diese Tragödie mit seiner Mutter ausgelöst wurde, konnte er nicht ahnen und kann ihm niemand anlasten. Dennoch wird er diese Last bis zu seinem Tode mit sich herumgetragen haben. Möge auch er in Frieden ruhen.“
Keine Reue
Ganz anders verhält es sich mit den in Frage kommenden Tatbeteiligten. Niemand musste sich je dafür in einem Gerichtsverfahren verantworten. Der ehemalige NS-Kreisleiter Willi Münzer wurde im Entnazifizierungsverfahren mit der Unterstützung seines Rechtsanwaltes Hans Calmeyer gegen Zahlung einer Geldbuße als „minderbelastet“ eingestuft. Reue zeigte er nie. In einem Tagebucheintrag notierte er gar: „Von den uns angedichteten Schandtaten hat unser Gewissen uns schon längst freigesprochen. […] Wir haben das Gute gewollt und das Beste für unser Volk erstrebt. […] Christentum der Tat!“ Nach einem unbehelligten Leben als Handelsvertreter starb Münzer 1969 in Bad Iburg.
Ex-Oberbürgermeister Erich Gaertner, wurden lange nach seinem Tod 1973 in Freiburg noch zahlreiche Verdienste um den Zivilschutz für die Stadt Osnabrück in der Kriegszeit nachgesagt, obwohl er am 30. März 1933 in einer Begrüßungsrede den Mitgliedern des Osnabrücker Rates zugerufen hatte: „Unser Volk, geführt von Männern, die mit heißem Herzen und flammender Leidenschaft um Freiheit und Wohlfahrt des Volkes ringen, hat sich in letzter Stunde auf sich selbst besonnen und mitgeholfen, den nationalen Staat auf christlicher Grundlage wieder aufzurichten. Wer sein Vaterland liebt, darf jetzt nicht gleichgültig beiseite stehen.“
Auch seine Rolle um die „Verwertung“ des Grundstücks mit der in der Pogromnacht 1938 geschändeten Osnabrücker Synagoge blieb lange Zeit unbeachtet. Sein Porträt hing lange Jahre in der Reihe der honorigen Stadtoberhäupter im Osnabrücker Rathaus, bis es auf Veranlassung von Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip abgehängt wurde, nachdem die Rolle Gaertners in der NS-Zeit nach langem Zögern wissenschaftlich neu betrachtet worden ist und damit die verklärende Darstellung der Rolle Gaertners aus den Nachkriegsjahren endlich revidiert wurde.
Beide, Münzer wie Gaertner, haben das Wissen um den Schuss, der Anna Daumeyer-Bitter am 3. April 1945 getötet hat, mit ins Grab genommen, ohne dass sie sich dafür je verantworten mussten.
 Erich Gaertner, Fritz Wehmeier, Wilhelm Münzer
Erich Gaertner, Fritz Wehmeier, Wilhelm MünzerErinnerung
Anna Bitter, geborene Greve, verwitwete Daumeyer, ist auf dem Schinkeler Friedhof bestattet worden, neben ihrem bereits 1933 verstorbenen ersten Ehemann Heinrich Daumeyer.
Zur Erinnerung an Anna Daumeyer-Bitter wurde am 15. Mai 2009 vor der Hofstelle Daumeyer an der Nordstraße 60 ein Stolperstein verlegt.
 Verlegung des Stolpersteins für Anna Daumeyer-Bitter am 15. Mai 2009 an der Nordstraße 60 in Osnabrück mit (von links) Waltraud und Franz Daumeyer, Heinrich Daumeyer, dem damaligen Oberbürgermeister Boris Pistorius und Alice Graschtat als Patin für den Stolperstein. Der dritte Sohn Johannes war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben. (Foto: Daumeyer)
Verlegung des Stolpersteins für Anna Daumeyer-Bitter am 15. Mai 2009 an der Nordstraße 60 in Osnabrück mit (von links) Waltraud und Franz Daumeyer, Heinrich Daumeyer, dem damaligen Oberbürgermeister Boris Pistorius und Alice Graschtat als Patin für den Stolperstein. Der dritte Sohn Johannes war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben. (Foto: Daumeyer) Ein besonderer Dank gilt den Nachkommen von Anna Daumeyer für die Unterstützung dieses Beitrags!