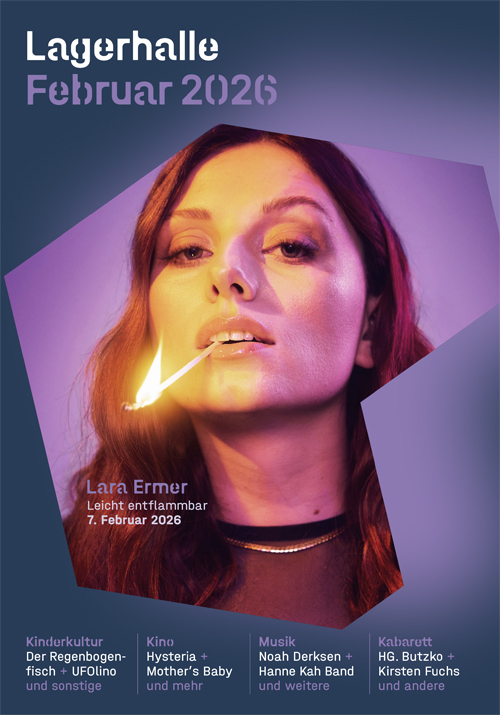Augustina Franziska Stridsberg, *22. August 1892

Sie war die einzige Tochter des Kaiserlichen Rats und Bankdirektors Ferdinand Mayer, der vom Judentum zum Katholizismus konvertiert war und seiner Frau Anna von Monvits (deren geadelter Vater Leopold vermutlich auch aus einer ursprünglich jüdischen Familie namens Horowitz stammte:). Gusti, wie sie genannt wurde, mit vollem Namen Augustina Franziska Mayer, wurde am 22. August 1892 in Czernowitz in der Bukowina – zu dieser Zeit Österreich-Ungarn, heute Ukraine – geboren, in der Vielvölkerstadt, aus der auch Rose Ausländer, Paul Celan, Itzik Manger und Joseph Schmidt stammten. Sie wuchs in einer inspirierenden, gut betuchten, großbürgerlichen Umgebung auf, besuchte das Gymnasium, wurde in England unterrichte und lernte schon als Kind dank zahlreicher Ferienaufenthalte im Ausland mehrere Sprachen.
Als sie während des Ersten Weltkriegs als freiwillige Krankenschwester in einem Wiener Hospital arbeitete, lernte sie den Medizinstudenten Bernhard Jirku kennen, Sproß einer tschechischen Adelsfamilie. Sie heirateten 1916 und ließen sich 1918 auf dem Familienbesitz der Mayers in Hartenstein, in der Nähe der südsteirischen Stadt Windischgrätz (Slovenj Gradec) nieder, den Gusti als Mitgift bekommen hatte und wo im Juli 1918 die gemeinsame Tochter Marietta geboren wurde.
Slowenien
Nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie wurde das Gebiet, auf dem sich der Gutsbesitz befand, Jugoslawien zugeschlagen (heute liegt er in Slowenien). Bernhard Jirku, inzwischen Arzt, hatte Affären und Gusti ließ sich von ihm scheiden und verwaltete weiter ihren großen Gutsbesitz (ihr Vater war schon 1904, ihre Mutter war 1918 gestorben). Gusti konnte sich einen mondänen Lebensstil von ihrem Erbe leisten und machte ausgiebig davon Gebrauch.
1924 engagierte sie Franz Kavčič als Slowenisch-Lehrer für ihre Tochter und nahm bald auch selbst Stunden bei ihm, weil es ihr, so Kavčič später, »immer unangenehmer geworden sei, das sie die Sprache eines Volkes, in dessen Mitte sie schon so lange lebte, nicht beherrsche«. Ihr Lehrer machte Gusti mit den Erzählungen des christlich-sozialistischen Schriftstellers Ivan Cankar (1876 – 1918) bekannt, der in seinen Büchern soziale Missstände und Klassengegensätze anprangerte und heute als die zentrale Gestalt der slowenischen literarischen Moderne gilt. Sie begann, sich für seine Ideen zu begeistern und – bereits geübt in Englisch- und Französisch-Übersetzungen – seine Texte aus dem Slowenischen ins Deutsche zu übertragen. 1929 erschien in Wien eine Cankar-Werkauswahl unter dem Titel »Der Knecht Jernej« und 1930 sein Roman »Das Haus der barmherzigen Mutter Gottes«. Es waren die ersten deutschen Übersetzungen Cankars und es ist Gusti Jirkus Verdienst, ihn im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht zu haben.
Die Arbeit an Cankars Texten hatte ihren Entschluss reifen lassen, selbst zu schreiben. Ihr in Slowenien spielender Roman-Erstling »Zwischen den Zeiten« erschien 1931 in Leipzig, erregte großes Aufsehen und bewog sogar Thomas Mann zu der brieflichen Gratulation, die Autorin stehe »an der Schwelle des literarischen Ruhmes«.
Gelangweilt vom Landleben und ermutigt vom Erfolg beschloss Gusti, ihre Tochter in ein Schweizer Pensionat zu geben und in das kosmopolitische Wien zu ziehen. Sie kam in Kontakt mit sozialdemokratischen und kommunistischen Kreisen, vor allem aus dem neuen Jugoslawien, und der Chefredakteur der Zeitung »Der Wiener Tag« wurde auf ihre selbstbewussten Texte aufmerksam und schlug ihr vor, eine Reportage-Reihe über die Sowjetunion zu verfassen.
Moskau
Gusti Jirku fuhr 1932 also nach Moskau und die Reportagen, die sie hier schrieb (ihre Feuilletons erschienen u.a. auch im »Neuen Wiener Tagblatt« und im »Neuen Wiener Journal«), wurden ihr Einstieg in das Genre, das viele Jahre später als »Neuer Journalismus« bekannt werden sollte und ihr zukünftiges literarisches Schaffen prägte. Sie traf Georgi Dimitroff und Lenins Witwe und den »rasenden Reporter« Egon Erwin Kisch, der ihr eine Aushilfsstelle beim Auslandsrundfunk verschaffte, da ihr Honorar in Österreich ausgezahlt wurde und sie vor Ort Rubel dazu verdienen musste; nebenbei gab sie einem Komintern-Agenten Englisch-Unterricht.
Nach drei Monaten wieder zurück in Wien warb die Untergrundführung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens in Österreich Gusti Jirku als Hilfsagentin an. Ihre Kontaktperson war der »Berufsrevolutionär« Vilim Horvay, der Ex-Sekretär des Jugendverbands SKOJ in Kroatien, der hier unter dem Decknamen »Stefan Svarcman« agierte. Gusti verknallte sich in Vilim-Stefan, wurde seine Geliebte, übernahm gefährliche Aufträge für ihn und die Partei in Slowenien und Kroatien und folgte ihm, als er im Herbst 1933 nach Moskau beordert wurde.
Nun kam Gusti in noch engeren Kontakt mit der Komintern und arbeitete in deren Propaganda-Abteilung. Wegen ihrer Eloquenz und Mehrsprachigkeit wurde sie 1935 beim 7. Weltkongress der Komintern als Simultandolmetscherin eingesetzt und man bot ihr die sowjetische Staatsbürgerschaft an, die sie jedoch ablehnte.
Indes wurde das politische Klima im Moskau Stalins immer bedrohlicher. Vilim Horvaj ahnte, dass man ihn nicht wieder aus der Sowjetunion ausreisen lassen würde, schaffte es aber, eine Ausreisegenehmigung für Gusti zu erwirken und einen gefälschten Pass und Fahrkarten nach Paris für sie zu besorgen. Doch Gusti besuchte erst einmal ihre Tochter in der Schweiz und versuchte dann vergeblich, die Parteispitze der KP Jugoslawiens zu überreden, Vilim nach Paris zu versetzen, um ihn vor einer möglichen Verhaftung in der Sowjetunion zu schützen, und wurde – offenbar denunziert – in Saarbrücken von der Gestapo verhaftet. Dank ihrer Geistesgegenwart und dem Einfluss Schweizer Freunde kam sie nach sechs Wochen Haft frei, fuhr erst noch nach Prag und dann nach Paris, um sich von dort aus den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg anzuschließen.
Spanien
Gusti Jirku kam im Januar 1937 in Spanien an. Sie wurde als medizinische Assistentin in den Krankenhäusern der Brigaden in Albacete und Murcia eingesetzt und später zur stellvertretenden Chefredakteurin der »Ayuda Médica Internacional« ernannt, dem Organ des medizinischen Zweigs der Internationalen Brigaden. Gusti Stridsberg übernahm den Großteil der journalistischen Arbeit, darunter auch die Berichterstattung von der Front, so in »Pasaremos«, der Zeitschrift der XI. Brigade. 1938 schrieb sie in Barcelona u.a. die Broschüre »Kampf dem Tode. Die Arbeit des Sanitätsdienstes der Internationalen Brigaden«, zu der ihr alter Bekannter Egon Erwin Kisch das Vorwort beitrug.

Es folgte die in Madrid erschienene Broschüre »Wir kämpfen mit! Antifaschistische Frauen vieler Nationen berichten aus Spanien« – einer der wenigen authentischen, zeitgenössischen Berichte über die weiblichen Spanienkämpfer.
Der Chef des Sanitätsdiensts der Brigaden, Major Dr. Oscar Telge, schrieb hier im Vorwort: »(…) Faschismus ist Krieg. Die ganze Welt weiß, dass Städte und Dörfer in Spanien durch faschistische deutsche und italienische Flieger bombardiert werden, dass an Kindern und Frauen die Wirksamkeit der neusten Waffen erprobt wird, die trotz aller »Non-Intervention« an Franko geliefert werden, dass die deutsche Flotte ihre Kanonen auf die Zivilbevölkerung der Stadt Almeria gerichtet hat. Und solange die Herren Diplomaten in ihrer Vogel-Strauß-Politik fortfahren, solange in vielen Parlamenten der alten und neuen Welt Kautschukformeln ersonnen werden, die die doppelte Aufgabe haben sollen, die Faschisten nicht zu beleidigen, gleichzeitig aber die empörte öffentliche Meinung zu betrügen, wird der Faschismus in seinen Verbrechen bestärkt.«
Als Gegenmodell schreibt er dann über die Freiwilligen aus aller Welt, die sich in Spanien den Franco-Truppen entgegen stellten, speziell über die im medizinischen Dienst: »(…) Tausenden von Verwundeten haben unsere Kameraden und Kameradinnen das Leben gerettet, sie haben still und anspruchslos im Feuer der Maschinengewehre, im Bombardement gearbeitet. Sie sind Helden und Heldinnen der Stolz der fortschrittlichen Menschheit. (…) Das Büchlein der Kameradin Gusti soll von ihren Taten erzählen.«
Gusti berichtet hier unter anderem: »In einem der Hospitäler von Murcia sah eine junge Pflegerin – sie war aus der Schweiz gekommen – ein stilles Geschöpf, das mit leidenschaftlichem Ernst jeden großen und kleinsten Dienst tat. Wenn sie den verwundeten Kameraden zulächelte, war in diesem Lächeln ein bezwungener Schmerz. Sie galt für heiter, aber Frauen haben für einander scharfe Augen: ich merkte, dass sie litt. Ich erfuhr, dass ihr Mann vor kurzem an der Jarama-Front gefallen war: eine Granate hatte ihm die Schädeldecke weggerissen. Als die junge Frau mir sein Bild zeigte, liefen ihr Tränen über die Wangen, sie wischte sie rasch fort und sagte: ‚Die Verwundeten dürfen nicht merken, dass ich weine.‘
Die Frauen des Sanitätsdienstes der Internationalen Brigaden, die kämpfend helfen müssen, haben der Schule des Bürgerkriegs viel gelernt, vor allem das schwerste: hart gegen sich selber und schwesterlich weich zu den verwundeten Kameraden sein. Sie haben ihre physische Schwäche unter Disziplin gestellt und ihre Nerven in strenger Zucht: sie wissen, um was es geht und was sie wollen. Anka, Rachel, Evelyn und Anne-Marie – Ihr und alle die andern, die mit heißem Herzen und kühlem Kopf der Sache der Menschheit dient: Ihr habt der Entwicklungsgeschichte der Frau ein neues Kapitel hinzugefügt: das Kapitel von der antifaschistischen Kameradin im Bürgerkrieg! (…)«
Allein aus Österreich gab es etwa 1400 »Voluntarias Internacionales de la Libertad«, darunter etwa zwei Dutzend Frauen, die, weil sie oder ihre Partner bereits vorher antifaschstisch sozialisiert waren oder weil sie verfolgt wurden und emigrieren mussten, nach Spanien gingen – wie Stefanie Bauer, Dora Quinton, Gundl Herrnstadt-Steinmetz, Ilse Barea-Kulcsar, Lisa Gavrič, Gusti Jirku, Marie Langer, Liselotte Matthèy-Guenet, Ruth Tassoni, Eva Korčak und Henriette Wallis. Es waren Studentinnen, Ärztinnen, Krankenschwestern, Pharmazeutinnen, Röntgenassistentinnen, Schneiderinnen, Bankbeamtinnen, Germanistinnen, Musikerinnen oder eben Journalistinnen wie Gusti Jirku.

Noch einmal Gusti Jirku: »(…) Susanne Heck, die Ärztin, die zielbewusst ein Hospital für 500 Verwundete schafft und nach eigenen Plänen zu einem Musterspital machte, wie es seinesgleichen in keinem Kriege gab; die energische kleine Rachel, die belgische Apothekerin und ihre österreichische Adjutantin Renee in der Central-Apotheke, die alle unsere Brigaden, Bataillone, Front- und Hinterlandshospitäler mit Verbandzeug, Medikamenten und Instrumenten versieht; Anka, die kroatische Ärztin, bescheiden und unermüdlich; die blonde Ruth, die viele Nächte am Bahnhof steht, um die Evakuation der Verwundeten zu leiten; Anjuta, die Tschechin, die während der Attacken beim Hilfsplatz der Brigade hinter der Schreibmaschine sitzt und sorgsam, wie an einem beliebigen Schreibtisch, Verwundetenlisten und Befunde schreibt – sie und alle anderen setzen ihre ganze Kraft und manchmal ihr Leben ein. (…)«
Im Sommer 1938 begannen sich die Internationalen Brigaden aufzulösen. Während die Männer in den Demobilisierungslagern in Katalonien festsaßen und sich vergeblich um die Ausreise in andere Länder bemühten, gelang es den meisten Frauen, die Grenze nach Frankreich zu passieren. Doch einige wurden auch interniert oder ermordet. Die Mehrheit der Frauen, die es ins noch freie Frankreich geschafft hatten, ging danach in die Illegalität und den Widerstand, sogar noch nach der Besetzung Südfrankreichs.
Auch Gusti überquerte nach 18 Monaten in Spanien illegal die Grenze nach Frankreich. Sie blieb zunächst in Paris und schrieb Feuilletons für die »Pariser Tageszeitung«. Da sie in Spanien mehrere Schweden kennengelernt hatte, darunter die Journalisten Georg Branting und Sonja Branting-Westerståhl, die dort das Schwedische Hilfskomitee für Spanien vertreten hatten, reiste sie dann weiter nach Kopenhagen (wo sie ein letzter Brief ihres Liebsten Vilim Horvaj erreichte) und kam im März 1939 schließlich in Stockholm an.
Schweden
Die Verbindung mit ihren schwedischen Freunden aus dem Bürgerkrieg führte nun unter anderem zu ihrem Engagement bei »Morgonbris«, dem Organ des Frauenverbands der Sozialdemokratischen Partei Schwedens, für das sie regelmäßig feministische und antinazistischen Beiträge schrieb. Sie etablierte sich sehr schnell in der schwedischen Gesellschaft und im kosmopolitischen Leben Stockholms. Als Ausländerin und politischer Flüchtling musste sie jedoch jederzeit befürchten, ausgewiesen zu werden und ging eine Scheinehe mit dem deutlich jüngeren Spanien-Veteranen Hugo Stridsberg ein, um die schwedische Staatsbürgerschaft zu bekommen (die Ehe wurde 1944 dann auch wieder aufgelöst).
Stockholms Bedeutung als neutraler Außenposten für Journalisten und Geheimdienste wuchs nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 und dem Eintritt der USA in den Krieg. Gusti Stridsberg, geborene Mayer, geschiedene Jirku wurde akkreditierte Korrespondentin des »Toronto Star«. In dieser Funktion traf sie Ende 1941 auf Zoja Jarzeva, Presseattaché und NKWD-Offizierin, die mit der Organisation von Sabotagegruppen in Schweden beauftragt war. Die Jarzeva brauchte Unterstützung und fand vermutlich niemanden mit mehr Erfahrung und einem besseren Deckmantel als die Zeitungskorrespondentin Gusti Stridsberg. Die arbeitete von da an in Stockholm unter dem Decknamen »Klara« für den sowjetischen Geheimdienst, unter anderem für die Militäraufklärung GRU. Ihre Aufgabe war es, geeignete Personen für Sabotageakte zu finden, geheime Informationen zu beschaffen und vor allem die äußerst sensiblen Beziehungen zwischen dem NKWD und der sog. Friedensopposition in Finnland zu managen, deren Ziel es war, das Bündnis zwischen Finnland und Deutschland zu (zer)stören.
Offenbar machte Gusti Stridsberg ihren Job gut; ihre Kontaktpersonen beschrieben sie als äußerst geschickt, effektiv, intelligent und einfallsreich. Sie genoss beim sowjetischen Geheimdienst hohes Ansehen und wurde als wichtigste Agentin in Stockholm angesehen.
1945ff
Nach Kriegsende verlor Stockholm jedoch seine Bedeutung für die internationale Geheimdienstarbeit, und die Sowjets wollten ihr »bestes Pferd« unbedingt nach Jugoslawien versetzen. Gusti bat um Bedenkzeit, während sie mit amerikanischer Hilfe heimlich in die westalliierte Zone in Österreich einreiste, was dazu führte, dass sie als potenzielle Doppelagentin galt und die Sowjets die Beziehungen zu ihr abbrachen. Aus Sicht Gustis erfolgter ihr eigener Bruch mit Moskau vor allem, weil sie erfahren hatte, dass der NKWD ihren Geliebten Vilim Horvay noch vor Kriegsbeginn im Zuge des »Großen Terrors« hingerichtet hatte, und dass man dies vor ihr geheim gehalten hatte (nach Aussagen von Spanien-Veteranen hatten man aber auch sie selbst schon in Spanien 1937/38 wegen Kontakten zu vermeintliche Moskau-abtrünnigen Genossen im Visier).
Gusti Stridsberg ist irgendwie durch die Maschen des an sich sorgfältigen schwedischen Überwachungsapparats der Kriegsjahre geschlüpft. Erst 1954, als zwei KGB-Offiziere – Jevdokia und Vladimir Petrov – nach Australien überliefen, erhielten die verblüfften Schweden Informationen über eine Agentin namens »Klara«. Im September 1955 wurde Gusti Stridsberg vorgeladen und eingehend verhört. Sie gab zu, für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet zu haben, bestritt jedoch, dass ihre Aktivitäten gegen Schweden gerichtet gewesen seien, und weigerte sich auch strikt, zu verraten, wen sie rekrutiert und mit wem sie zusammengearbeitet hatte. Die Kommission kam schließlich zu dem Schluss, dass Stridsbergs Agententätigkeit antifaschistischen Charakter und Schweden keinen Schaden zugefügt hatte. Der Fall wurde, ohne öffentlich geworden zu sein, 1955 zu den Akten gelegt.

Gusti hat unter dem Namen Stridsberg mehrere autobiografische Erinnerungsbücher geschrieben, von denen »Menschen, Mächte und ich« 1961/62 ein Welterfolg war. Sie schildert darin ihr wechselvolles Schicksal in Österreich, Jugoslawien, Sowjetunion, Spanien und Schweden; das Zwischenspiel als Sowjetspionin kommt nicht vor. Gusti Stridsberg hat nie darüber gesprochen. Doch dass sie keine Illusionen über die Sowjetunion mehr hatte, wird klar. Unter anderem schreibt sie hier: »In der Sowjetunion war Haß das Fundament, auf dem das Neue entstehen sollte. Was galt der Mensch dort? Er wurde für eine anonyme Menschheit geopfert. Diese anonyme Menschheit fand Ausdruck in einer machtgierigen, wild gewordenen Diktatur. Haß gegen den Klassenfeind, Haß gegen den sogenannten Verräter, auch gegen den Denkenden, den Aufrechten, den Mutigen, den allzu Begabten … die Luft war von Haß verpestet, und der Haß war ein wesentlicher Motor des Systems. Die Miasmen des Stalinismus hatten das warnherzige, begabte russische Volk vergiftet.«
Ihre Tätigkeit als Spionin wurde erst viele Jahre nach ihrem Tod bekannt, nachdem die amerikanischen National Security Agency 1996 die sowjetischen Geheimdiensttelegramme aus dem Krieg im Rahmen des Venona-Projekts veröffentlicht hat. Dieses Material trug aber auch dazu bei, dass heute in vielen Quellen bis hin zu Wikipedia zu lesen ist, Gusti Jirku-Stridsberg und ihre Tochter seien Agentinnen der Sowjets in San Francisco gewesen. Doch die Decknamen »Klara« und »Tochter« tauchen in den Telegrammen zwischen Moskau und San Francisco nur deshalb auf, weil der NKWD damals regelmäßig Geld über Gustis seit 1942 in Berkeley studierende Tochter Marietta transferiert hat, um Gusti eine legale Einnahmequelle zu verschaffen (Marietta wurde später eine bekannte Parasitologin).
Augustina Franziska Stridsberg, geborene Mayer, geschiedene Jirku, genannt »Gusti«, Deckname »Klara« aus Czenowitz, ist am 13. März 1978 in Lindigö bei Stockholm gestorben – sie war eine talentierte Übersetzerin, eine engagierte Autorin, eine beeindruckende Kosmopolitin und eine der geschicktesten, aber auch unbekanntesten Geheimdienstagentinnen.