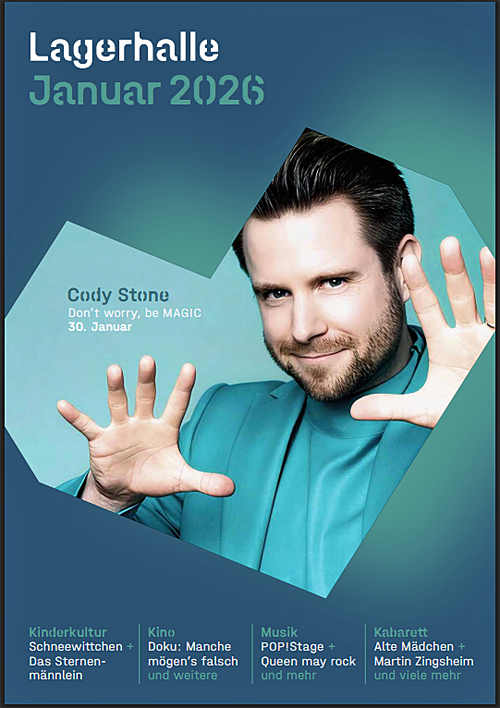Eine tiefgründige Diskussion über die Zeit
Das traditionsreiche philosophische Café im Blue Note feierte am Sonntag, dem 11. Mai, in seiner 154. Ausgabe einen besonderen Anlass: Das 20-jährige Bestehen dieser Veranstaltungsreihe stand im Mittelpunkt. Passend zum Jubiläum widmeten sich die zahlreichen Besucher*innen einem der fundamentalsten und zugleich rätselhaftesten Themen der Philosophie: der Zeit in ihren vielfältigen Dimensionen von Zeitlichkeit und Ewigkeit.
Im Anschluss sprachen wir mit Professor Dr. Arnim Regenbogen. Es war ein lebendiger Austausch über Vergänglichkeit und Unendlichkeit, über Zeitumgang und Zeitmessung. Ein zentraler Punkt war die Spannung zwischen der Notwendigkeit, uns zur Zeit zu verhalten, ohne sie jemals vollständig erfassen zu können. Dabei wurde auf die Begrenztheit unserer Lebenszeit und auf die Flüchtigkeit der Gegenwart hingewiesen.
Die Entwicklung der Zeitmessung wurde von natürlichen, zyklischen Phänomenen (wie Himmelskörpern) hin zu einer zunehmenden Abstraktion und Mechanisierung (wie der Entwicklung der Räderuhr und schließlich der Atomuhr) nachgezeichnet. Diese Entwicklung kulminierte in der Vorstellung von Zeit als etwas von Mensch und Natur unabhängigem.
Zeitlichkeit und Ewigkeit
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der philosophischen Bedeutung von „Zeitlichkeit und Ewigkeit“. Dabei wurde die Schwierigkeit beleuchtet, sich Unendlichkeit und Endlichkeit vorzustellen. Es wurde auch auf Kants Überlegungen verwiesen, der die Frage nach der Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt als zentrales Problem der „Kritik der reinen Vernunft“ sah.
Zeitbewusstsein und Beschleunigung
Die Diskutierenden beschäftigten sich mit dem menschlichen Zeitbewusstsein und dessen Wandel in der Moderne. So wurde etwa besprochen, wie sich das Zeiterleben vom physikalischen Zeitbegriff unterscheidet und wie unser Zeitbewusstsein von Vorstellungen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geprägt ist. Auch das Phänomen der Beschleunigung in der Spätmoderne wurde thematisiert, insbesondere im Zusammenhang mit kapitalistischer Logik und den Auswirkungen auf das Individuum.
Interview mit Professor Dr. Armin Regenbogen
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des philosophischen Cafés haben wir mit Professor Dr. Arnim Regenbogen gesprochen, der die Veranstaltungsreihe seit Beginn begleitet und mitgestaltet. Ihre Gedanken und Einsichten zum Jubiläum und zur Bedeutung des philosophischen Cafés für die Osnabrücker Hochschul- und Kulturszene lesen Sie im folgenden Interview.
Osnabrücker Rundschau: Wie kam es vor 20 Jahren zur Idee des philosophischen Cafés?
Arnim Regenbogen: Damals wurde das „Philosophische Café Osnabrück“ von einem Planungsteam aus vier pensionierten Hochschullehrern der Universität Osnabrück gegründet: Arnim Regenbogen (Philosoph), Reinhold Mokrosch (Ev. Theologe und Religionswissenschaftler), Elk Franke (Kulturwissenschaftler) und Harald Kerber (Soziologe). Ihre Fachgebiete: Philosophie, Theologie, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften. Sie alle hatten sich schon in ihrer Studienzeit mit philosophischen Dissertationsthemen fachphilosophisch ausgewiesen. Doch was sie verband: die öffentlichen Diskussionen über Gesellschaft, Natur und Politik aus einer weltweiten Perspektive. Wir starteten 2005 monatlich mit öffentlichen Diskussionsangeboten an festen Sonntagvormittagen.
Gab es ein konkretes Initialereignis oder eine bestimmte Motivation?
Im Winter 2005 diskutierten Millionen von Menschen die Ursachen und Folgen des „Tsunami“. Wir boten daher eine kontrovers geführte Diskussion unter dem Thema „Naturkatastrophen und Menschheitshandeln“ an. Unsere ersten Erfahrungen: Themen mit aktuellen Weltbezügen – Naturschutz weltweit, Katastrophenschutz regional – fanden ein großes Interesse.
Wie waren die ersten Veranstaltungen?
Das Interesse am Programm war größer als erwartet. Über 100 Interessierte besuchten schon die Eröffnungsveranstaltung. Heute treffen sich in einem Kinocafé regelmäßig bis zu 200 Teilnehmer*innen. Das Programm haben wir seitdem nicht nur auf Themen für im engeren Sinne philosophisch Interessierte, sondern auch auf Probleme individueller Lebensbewältigung und auf Fragen gesellschaftskritischer Art abgestellt.
Gab es unerwartete Herausforderungen oder Erfolge?
Zu einem Thema mit politischen Bezügen luden wir eine Politikerin ein, die ihre Positionen im Stil kontroverser Fernsehtalkshows präsentierte. Ihr ging es vor allem um scharfe Angriffe gegen die für sie unbequemen Positionen. Von Seiten des Publikums wurden wir aktuell und auch nach der Sitzung aufgefordert, künftig nicht mehr polemische Talkshows anzubieten, sondern uns wieder auf die gemeinsame Suche nach wissenschaftlich begründeter Wahrheit zu konzentrieren. Denn wir glaubten zunächst: Je schärfer kontroverse Positionen formuliert werden, desto spannender wird die Diskussion erlebt. Das Publikum hat uns eines Besseren belehrt.
Warum wurde das Blue Note als Veranstaltungsort gewählt?
Wir konnten wegen des starken Interesses nicht in einem kleinen Galerie-Café bleiben. Die Zahl unserer regelmäßig Teilnehmenden erforderte einen Raum mit Getränke- und Frühstücksangeboten für wenigstens 140 Personen, wie im Kinocafé Blue Note.
Welche Bedeutung hat dieser Ort für das philosophische Café?
Wir konnten seit dem Umzug aus einem kleinen Galerie-Café in das größere Kinocafé mit einer größeren Teilnehmerzahl rechnen. Bedienstete vom Blue Note erwiesen sich als kompetent auch im Umgang mit Medien, beispielsweise auch mit Mikrofonen und mit Projektionen an Leinwänden und Schautafeln
Wie haben sich die Themenschwerpunkte im Laufe der 20 Jahre verändert und spiegeln sich die gesellschaftlichen Entwicklungen wider?
Einst stießen die Welt- und Menschenbilder bei antiken Denkern – beispielsweise Sokrates, Aristoteles – sowie bei neuzeitlichen und modernen Textproduzenten – beispielsweise Lessing, Kant, Schiller, Nietzsche, Sartre, Camus – auf starkes Interesse. Heute richtet sich der Blick häufiger auf die Perspektiven gesellschaftlicher Entwicklung. Ursprünglich erreichten wir fast nur Interessierte im fortgeschrittenen Alter mit klassischem Bildungsanspruch. Themen mit Werkbezügen auf Denker aus vergangenen Zeiten wurden in dieser Zeit vom Publikum häufiger gewählt. Doch später wurden auch Jugendliche und junge Erwachsene in größerer Zahl auf uns erst aufmerksam.
Gab es Themen, die in besonders polarisierter Form viele Diskussionen ausgelöst haben?
Es ging vor Jahren um ein politisches Thema. Wir trafen zum Teil auch auf Teilnehmende, die von der Philosophie fertige Rezepte für die Lösung von Menschheitsproblemen erwarten. Diese sind mitunter enttäuscht und blieben künftig fern. Zu oft bleiben Fragen zu definierten Problemen offen. Wir sind geneigt, dem Publikum das Offenhalten von Fragen als Merkmal des Philosophierens nahezulegen. Doch mit der Kultivierung von Kontroversen haben wir auch negative Erfahrungen gesammelt.
Was macht dieses Format so besonders und erfolgreich?
Die Einstellung auf Themen, mit denen auch alltäglich kommuniziert wird, beispielsweise Fragen der Moral, der Politik und der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Welche Vorteile sehen die Veranstalter gegenüber traditionellen philosophischen Vorträgen?
Um es auf eine Formel zu bringen: Philosophische Fachvorträge werden in der Regel an philosophisch Gebildete gerichtet. Unser Cafe richtet sich an eine Öffentlichkeit, die philosophische Argumente auch ohne Rücksicht auf eine fachphilosophische Begründung würdigen kann.
Hat sich das Publikum im Laufe der Zeit verändert?
Jugendliche und junge Erwachsene wurden in größerer Zahl auf unser Programm erst aufmerksam, als wir vor zehn Jahren wegen Überfüllung aus einem kleinen Galeriecafé in das größere Kinocafé umgezogen sind. Das Philo-Café ist seitdem auch im gedruckten Kinoprogramm und im Netz präsent.
Gibt es eine treue Stammgemeinde?
In größerer Zahl werden unsere Angebote von Engagierte aus sozialen Berufen, beispielsweise aus dem Medizinbereich, aus dem Lehrbetrieb, aus der Verwaltung, auch von Freiberuflern wahrgenommen, in geringerer Zahl auch von Azubis, Studierenden und Zuwanderern. Unsere Themenplanung ist an Interessen und am Beurteilungsvermögen eines Publikums orientiert, das von eigenen Arbeits- und Lebensbereichen her in der Lage ist, mit philosophisch relevanten Problemen umzugehen, auch wenn man selbst nur über einen begrenzten Zugang zu wissenschaftstheoretischen Fragestellungen verfügt.
Inwiefern prägt die langjährige wissenschaftliche Erfahrung der Veranstalter die Auswahl der Themen und die Art der Präsentation?
Wie schon erwähnt: Das Planungsteam wurde von pensionierten Hochschullehrern der Universität Osnabrück gegründet. Was sie vereint: langjährige Erfahrung im Umgang mit Verständnisschwierigkeiten bei den Studierenden in ihren Fächern.
Wie gelingt es, komplexe philosophische Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen, ohne sie zu vereinfachen oder zu verfälschen?
Nur durch Rücksicht darauf, dass nicht von allen im Publikum eine exakte philosophische Beweisführung erwartet wird. Wir bevorzugen Bezüge auf philosophische Werke der Vergangenheit, die auch für die damalige Öffentlichkeit in vergangenen Jahrhunderten angeboten wurden, wie zum Beispiel Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ – eine Schrift mit politischen Forderungen – oder Rousseaus Romane „Emile“ zur Erziehungsreform. Wir bemühen uns, komplexe Theorien auch in einer verständlichen Sprache zu präsentieren.
Die Bedeutung der Diskussion: Welchen Stellenwert hat die Diskussion mit dem Publikum?
Teilnehmende, die von der Philosophie fertige Rezepte für die Lösung von Menschheitsproblemen erwarten, sind mitunter von unserem Angebot enttäuscht und bleiben künftig fern. Wir sind geneigt, dem Publikum das Offenhalten von Fragen als Merkmal des Philosophierens nahezulegen.
Gab es besonders denkwürdige oder erkenntnisreiche Diskussionen?
In der jüngsten Vergangenheit: eine Diskussion mit KI-Fachleuten über die Frage, ob philosophische Fragen auch durch „Künstliche Intelligenz“ lösbar sind – natürlich nur an Beispielen für Probleme, die allen zugänglich sein können. Es war das zuletzt am meisten besuchte Thema.
Die Bedeutung des Jubiläums: Was bedeutet dieses 20-jährige Bestehen für Sie persönlich und für die Universität Osnabrück?
Zufriedenheit damit, dass eine problembewusste Öffentlichkeit sich auch philosophische Fragestellungen zutraut. Für die Uni bedeutet es, dass philosophische Fragen sichtbar stärker auch bei Studierenden geweckt werden als früher, wenn man Modelle des Philosophierens auch in der Öffentlichkeit erprobt.
Warum ist es auch heute noch wichtig, philosophische Fragen öffentlich zu diskutieren?
Seit der Aufklärung, beginnend mit dem 18. Jahrhundert, gibt es Foren der Öffentlichkeit – ursprünglich „Gelehrte Gesellschaften“ und Salons. Philosophische Fragen standen schon damals im Zentrum der Debatten. Die heutige Demokratie beansprucht ihren Wählern ein sachgerechtes Urteil über politische und gesellschaftliche Fragen zuzumuten. Dafür sind nicht esoterische Zirkel in der Wissenschaft zuständig, sondern Foren, auf denen tolerant gestritten wird.
Welche Rolle kann ein Format wie das philosophische Café dabei spielen?
Den Anspruch in einer demokratisch verfassten Zivilgesellschaft sowohl die Meinungskontroversen wie auch den Meinungsaustausch als etwas Selbstverständliches akzeptieren zu können.
Warum ist es auch heute noch wichtig, philosophische Fragen öffentlich zu diskutieren?
Fragen der Moral können mit philosophischen Positionen der Ethik leichter bewältigt werden. Oder unser Verhältnis zur Natur und zu den Lebensbedingungen auf der Erde erfordern Ansätze zur Bewältigung von Zukunftsaufgaben, die in den Medien auch gegenwärtig zentral diskutiert werden – wie beispielsweise Umweltschutz, Lebensbedingungen angesichts der Klimakatastrophe und anderes.
Welche Rolle kann ein Format wie das philosophische Café dabei spielen?
Philo-Cafes können Foren für die Diskussion solcher zentralen Themen in unserer zunehmend komplexer werdenden Lebenswelt werden. Sie können Beispiele dafür liefern, wie man kontroverse Themen in einem toleranten Klima des Meinungsaustauschs diskutieren kann.
Wie sehen Sie die Zukunft des philosophischen Cafés?
Entweder durch Ergänzung des Teams durch jüngere Fachkräfte oder auch durch Übertragung der Programmverwaltung an eine Institution der Erwachsenenbildung.
Gibt es neue Ideen oder Pläne für die kommenden Jahre?
Themen werden in der Regel abgestimmt mit dem Publikum: Wir ermitteln die Präferenzen für unsere Themenvorschläge durch schriftliche Befragung von unseren Teilnehmenden, besonders häufig angekreuzt werden. Wir gehen bei der Planung von Themen daher in der Regel davon aus, welche dieser Themenaspekte vom Publikum besonders häufig gewählt werden.
Was wünschen Sie und Ihre Kollegen sich für die weitere Entwicklung des philosophischen Cafés und für die philosophische Auseinandersetzung in der Gesellschaft?
Für das Philo-Cafe: eine hohe Akzeptanz im Umgang mit kontroversen Positionen. Dabei sollten im Zentrum lebensrelevante Fragen stehen. Für die Öffentlichkeit: die Begutachtung von Entscheidungen über die zukünftige Entwicklung der Menschheit durch philosophische Fachleute, wie es sie bereits in öffentlich wirksamen „Ethik-Kommissionen“ gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Anmerkung der Redaktion:
Das nächste Philosophische Café findet am Sonntag, dem 14. September statt und trägt den Titel: “Schafft Recht auch Gerechtigkeit?“ Beginn ist um 11:30 Uhr im Blue Note.