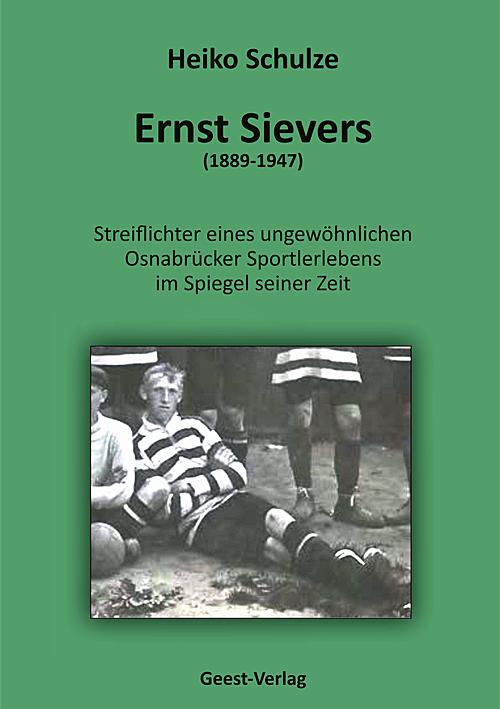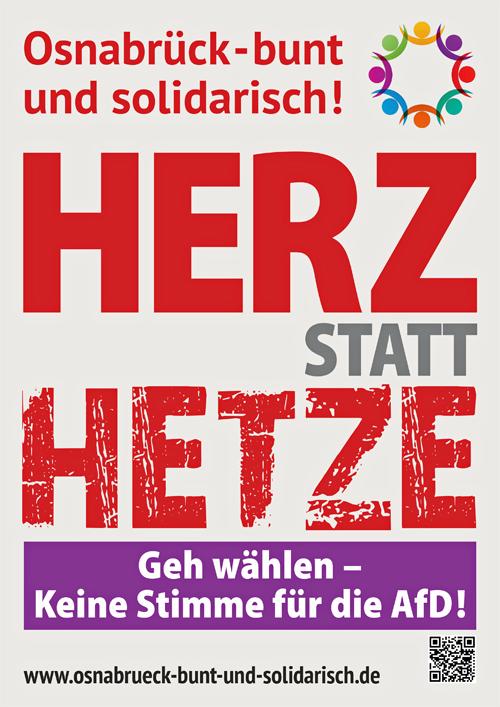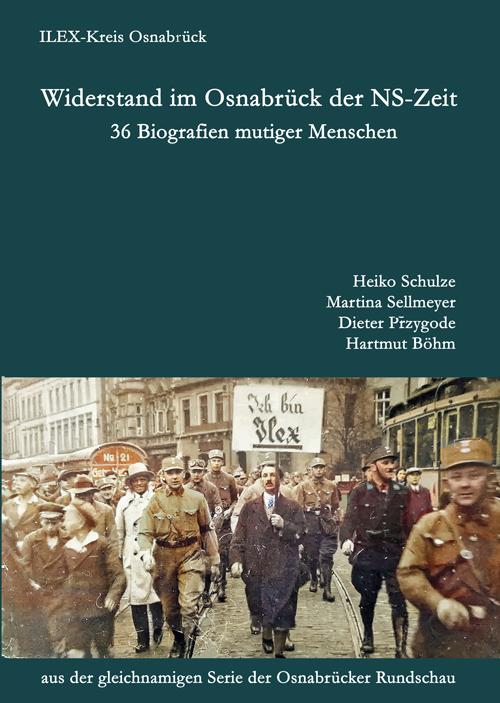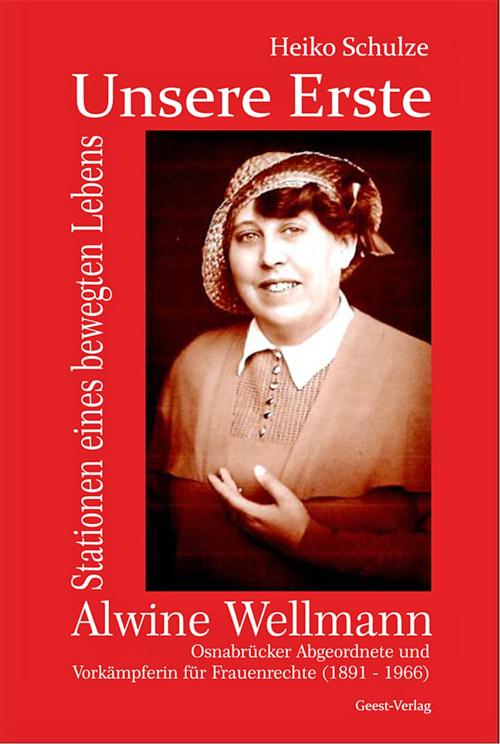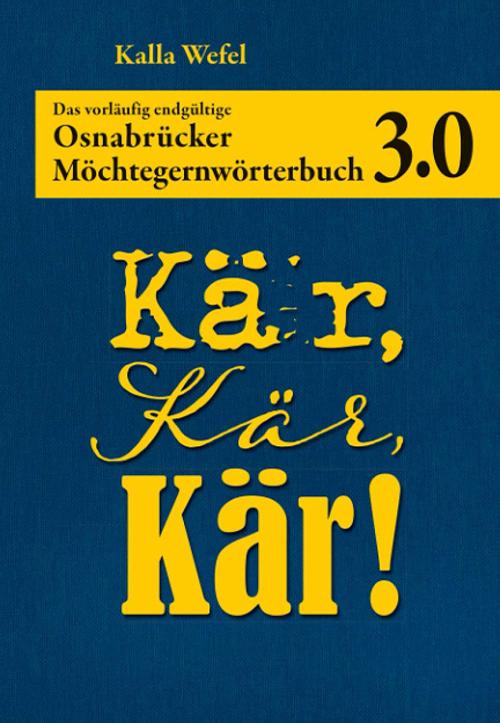Koalitions-Alpträume: Provokative Thesen zum Weiterdenken
Die Wahlen zum Europaparlament am 9. Juni waren weit mehr als ein folgenloser Stimmungstest. Der Vormarsch rechtsextremistischer Parteien und ein breit getragener Bodensatz sogenannter Politikverdrossenheit lassen sich keineswegs als banale Modeerscheinungen abtun. Klimakatastrophe und Kriege verstärken Ohnmacht – oder auch Wut. Wenn wir jetzt nicht allesamt mächtig aufpassen, gerät Demokratie aus den Fugen. Dabei gibt es durchaus Alternativen, um die Demokratie stärker denn je zu machen.
Was kommen dürfte
Blicken wir doch einmal auf den „normalen“ parteipolitischen Alltag unseres Landes. Das vorerst Allerschlimmste dürfte uns da sogar noch bevorstehen: Wenn am 1. und 22. September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt werden, droht alles in Gestalt von (unbestritten nötigen!) Maximal-Koalitionen gegen die AfD noch weiter den berühmten Bach hinunterzugehen. Parteien von Union über FDP, SPD, Grünen und Linken bis zum Fanclub Sarah Wagenknechts sind zur festen Kooperation verdammt, obwohl sie höchstens noch das Bekenntnis zum Grundgesetz zusammenhält. Mehr kommt da in entscheidenden Fragen kaum zusammen.
In Europa ist all dies aktuell noch wesentlich heftiger. Hier stehen Rechtsextreme zunehmend vor der Regierungspforte. In Frankreich dürfte der letzte Rettungsanker gegen Le Pens Rassemblement National eine Kooperation der neoliberalen Macron-Partei mit der vereinigten Linken der – zum Glück – wieder erstarkten linken „Volksfront“ sein. In Italien wäre die gleiche Kooperation die Bedingung, um die Postfaschisten um Frau Meloni endlich auf die Oppositionsbänke zu schicken. Minimalkonsens wird allerorten zur demokratischen Staatsräson.
Regierungsprogramme mit Zielen, die entweder Fans begeistern oder Gegnern Schauer verursachen, werden durch nichtssagende Kompromissprogramme ersetzt. Regierungshandeln der Zukunft scheint eher Regierungsverwaltung als Regierungspolitik zu sein. Sind wir noch zu retten?
Streit-Koalition. Warum eigentlich nicht?
Einer der häufigsten Kritikpunkte an der aktuellen Ampel-Regierung ist der Vorwurf, dass die Koalitionsfraktionen ständig streiten würden und uneinig seien. Stimmt ja auch. Aber im Ernst: Ist das im Spannungsfeld zwischen sozialökologischen Zielen der Rotgrünen und neoliberaler Pfründensicherung Reicher durch ihre FDP tatsächlich anders zu erwarten? Dass massive handwerkliche Fehler wie Habecks „Heizungsgesetz“ oder ein viel zu häufig schweigender, allenfalls nur moderierender wie dauergrinsender Kanzler zum Durchlauferhitzer für Politikverdrossenheit werden, sei eingeräumt. Es geht aber um viel mehr – und das grundsätzlich!
Wie blind muss man eigentlich sein, um nach Neuwahlen Veränderungen dieser Dauerstreitigkeiten zu erwarten? Klar: Ein Kanzler Friedrich Merz und sein Adlatus Linnemann würden im Einvernehmen mit Deutschlands mächtigsten Lobby-Verbänden alles tun, um Umweltstandards zu senken, Aufrüstung forcieren und dem Sozialstaat den Garaus zu machen. SPD wie Grüne würden hier als einzig denkbare Koalitionspartner aber zumindest das Allerschlimmste verhindern. Was bliebe also? Kompromisse zwischen Pest und Hirnhautentzündung, Dauerstreit und Stillstand. Ein Verschwinden der Front Deutscher Pfründensicherer (FDP) aus dem Bundestag würde zum Nebenthema, das kaum berühren würde.
Wenn dies alles aber so ist: Müssen wir uns nicht endlich auf Streit innerhalb von Koalitionsregierungen einstellen? Gäbe es den nicht, würde es an Selbstaufgabe gerade solcher Parteien grenzen, die, wie SPD, Grüne oder Linke, noch sozial-ökologische Visionen in ihren Programmen stehen haben. Würden sie darauf verzichten, wie die SPD in der Schröder-Zeit, machte sich eine solche Formation restlos überflüssig und austauschbar. Selbst nüchtern betrachtet bleibt eigentlich nur noch die Frage, in welchen Bahnen und Formen eine Streitkultur innerhalb von Maximal-Koalitionen ausgetragen wird. Hier wiederum wird es spannend. Folgend einige Vorschläge, die gern debattiert werden dürfen – Streitkultur wach auf! Ich liebe demokratischen Widerspruch.
Mut zu Minderheitsregierungen
Minderheitsregierungen gelten in Deutschland, ohne dass man sie jemals ernsthaft länger ausprobiert hätte, als etwas Ungewolltes. „Klappt nicht!“ schallt dem Befürworter entgegen. Wieso kann eigentlich etwas nicht klappen, das nie erprobt wurde? In Skandinavien, „Volksheim“ der Demokratie, sind derartige Konstellationen seit Jahrzehnten völlig normal. Im Alltag darf das Parlament Streit- wie Kompromisskultur zelebrieren. Ein spannender Prozess. Ist das tatsächlich schlechter als eine Maximal-Koalition mit Formelkompromissen aus Textbausteinen? Ich denke: nein.
Expert*innen-Kabinette aus der Zivilgesellschaft
Beispiel Thüringen: Wenn, wie absehbar, nur eine Riesenkoalition den Faschisten Björn Höcke aus Regierungsämtern fernhalten kann, warum müssen CDU, Linke, SPD und Grüne, meinetwegen auch noch die Wagenknechte, real darüber streiten, welche Partei einen Regierungschef oder die Regierungschefin stellt? Wie wäre es mit einer integren Persönlichkeit aus der demokratischen Zivilgesellschaft? Auch Kabinettsmitglieder lassen sich so denken. Streifen wir doch einmal das breite Angebot von engagierten Menschen, die sich beispielsweise in Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Kultur, Kreativwirtschaft bis hin zu Kirchen tummeln! Wetten, es ginge?

Einführung von Plebisziten
Bislang scheiterte die Legitimierung von Volksabstimmungen im Grundgesetz an der zur Zweidrittelmehrheit nötigen Zustimmung der Unionsparteien. Falls Merz und seine Fans tatsächlich über ihren eigenen Schatten sprängen, ergäben sich für Plebiszite ungeahnte Möglichkeiten, wieder politischen Mitgestaltungswillen zu wecken. Auch demokratische Parteien könnten sich dabei mit ihren Hunderttausenden von Mitgliedern ausgezeichnet engagieren. Natürlich sind Plebiszite gegen die Menschenwürde („Remigration“ oder „Todesstrafe“) auszuklammern. Aber sonst? Demokratie braucht auch Mut. Die Schweiz macht es seit Jahrhunderten vor – und ist nie dadurch gefährdet gewesen.
Mut zum Lager – ohne Abschottungen
Was spricht eigentlich gegen eine Politisierung von sogenannten Vorfeldorganisationen? Es gibt nun einmal unterschiedliche Wertvorstellungen – von der Kultur über Unternehmensprofilen bis hin zum Sportverein. In der Weimarer Republik zählte es nicht zu den schlechtesten Erscheinungen der Demokratie, dass politische Parteien wie die der Arbeiterbewegung im Kultur-, Sport-, Genossenschafts- oder Freizeitbereich eigene Organisationsangebote besaßen, zu denen Millionen engagierter Mitglieder zählten. Kein Mensch braucht heute mehr den klassischen „Arbeitersportverein“. Aber eine politisch gefestigte Plattform aus Social-Media-Aktivst*innen könnte der Debattenkultur fruchtbare Anstöße geben.
Stärkung der Selbstbestimmung im Kleinen
Arbeit, Wohnen wie Freizeit bilden Alltagsbereiche, in denen man dauerhaft für mehr Selbstbestimmung streiten kann. Was spricht gegen umfassende Mit- und Selbstbestimmung im Betrieb? Was spricht gegen Wohngenossenschaften oder zumindest Nachbarschaftsinitiativen, die einen solidarischen Zusammenhalt wahren? All dies können elementare Schulen der Demokratie sein. Eingekleidet in eine kommunale Demokratie, die wesentlich mehr über eigene Belange entscheiden kann als die aktuelle Kommunalpolitik, die am Tropf überregionaler Finanzgeber hängt. Wie wäre es mit Ideenwettbewerben?
Ertüchtigung von Parteien und Zivilgesellschaft
Nichts ist schäbiger als die Verächtlichmachung parlamentarischer Mehrheitsentscheidungen als „Die Politik versagt!“, sie sei gar „ein schmutziges Geschäft“. Sind in Wahrheit nicht wir alle „Politik“ – begonnen von der Wahrnehmung wie auch Verweigerung des Wahlrechts? Parteien wie Organisationen und Initiativen der Zivilgesellschaft bilden das eigentliche Lebenselixier der Demokratie. Werben wir auf allen Ebenen dafür, demokratischen Parteien und Organisationen beizutreten! Es gibt keine Demokratie ohne Demokratinnen und Demokraten, die nicht auch für sie einstehen. Konkreter Vorschlag: Keine Großdemo gegen Rechts ohne den Appell an die noch passiv Teilnehmenden, sich demokratisch zu engagieren. Friedlich um den besten Weg streiten – und trotzdem danach gemeinsam ein Bier oder Lindblütentee trinken zu können, dies sollte zum Grundprinzip lebendiger Demokratie gehören.
Ein lautes Ja zu Visionen
Ideologie ist kein Schimpfwort, sondern sie kann auch einen festen Werte-Kanon umschreiben. Jener wiederum besitzt die einmalige Chance, politische Strömungen anhand unterschiedlicher Wertegerüste unterscheidbar zu machen. Keine politische Partei ist ideologischer als eine, die von sich behauptet, nicht ideologisch zu sein. Schlimmer noch: Nichtideologie ist ein Dogma, ungleich gefährlicher als ein von Normen und Werten getragenes Programm.
Und Visionen? Helmut Schmidt prägte einmal den unseligen Satz: „Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen.“ Der heutige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat diesen Spruch mal auf einem Parteitag in sein exaktes Gegenteil verkehrt. Sinngemäß sagte er: „Es stimmt. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und dann sollte er den Arzt, das Personal und die Menschen im Wartezimmer allesamt von der Vision einer besseren Gesellschaft überzeugen!“
Kurzum: Was spricht dagegen, dass konservative, neoliberale, grüne oder sozialistische Demokrat*innen visionäre Zielvorstellungen jener Gesellschaft in ihr jeweiliges Programm schreiben, die ihnen vorschwebt? Selbst in der Tagespolitik ist dies ein Muss. Wie sonst lässt sich der Kompass stellen? Wie sonst soll sich Richtung und Dynamik entfalten? Wie sonst begeistere ich Gleichgesinnte und mobilisiere sie mit Schaffensfreude für den stinknormalen politischen Alltag?