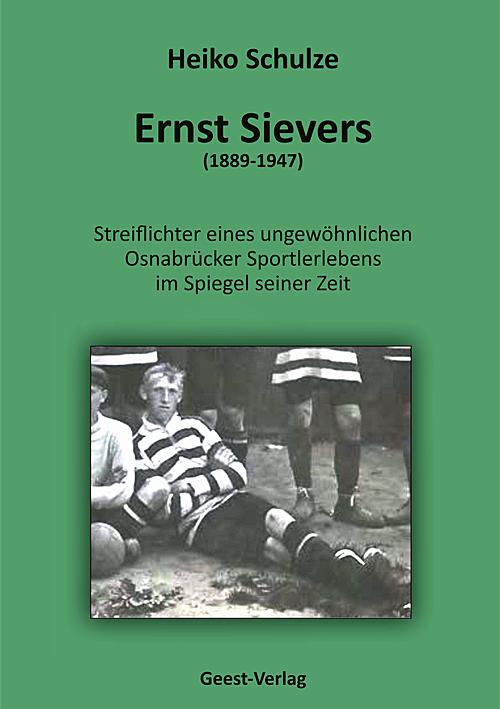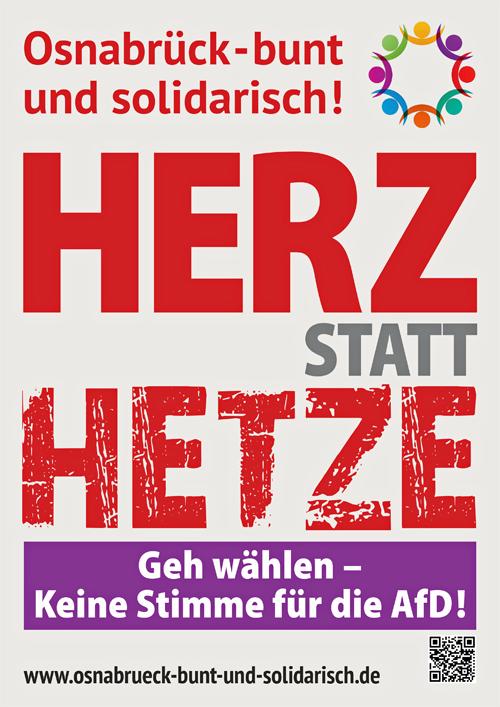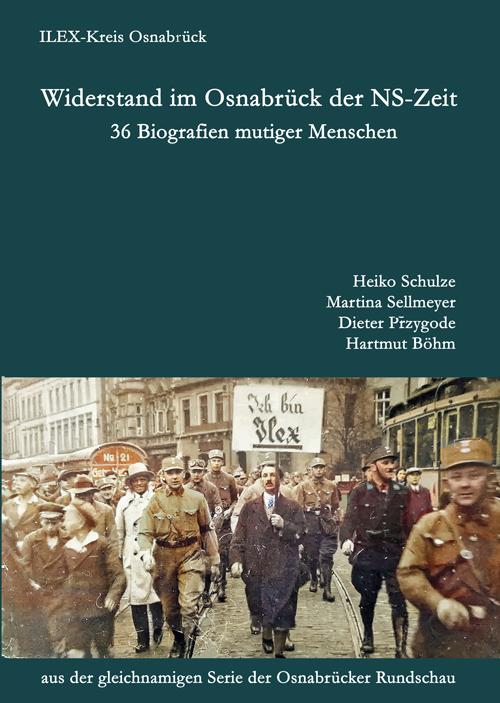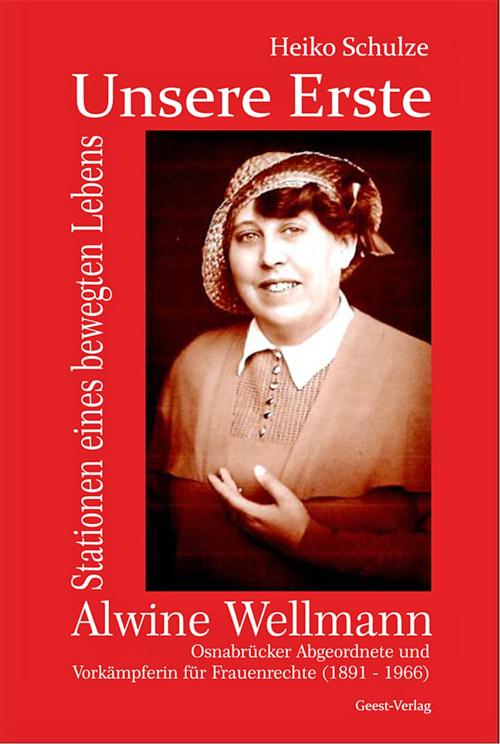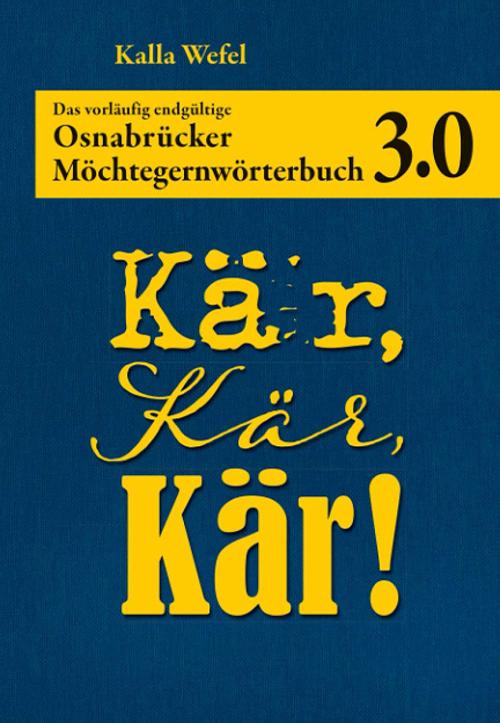Wie weit fällt die SPD noch und was sind die Gründe?
Die älteste Partei Deutschlands, die einstige Fackelträgerin der Demokratie und des sozialen Fortschritts steckt in ihrer tiefsten Krise. Diesmal droht nicht der Feind mit Verbot wie durch Bismarcks Sozialistengesetze oder Zerschlagung und Verfolgung durch die Nazis, keine SED würgt sie in eine Einheitspartei, es droht auch keine Spaltung wie im Ersten Weltkrieg, die ihre Existenz bedroht. Sie ist diesmal nicht das Opfer von Feinden, die sie vernichten wollen, sondern Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen und zugleich auch Täter ihres Sinkfluges. „Mit uns zieht die Zeit“, so eine Zeile der Parteihymne, gilt schon länger nicht mehr, vielmehr scheint die Zeit an ihr vorbeizugehen.
Blickt man auf das Ergebnis der jüngsten Europawahl, dann sind 13,9 % auf Bundesebene für die SPD ein Tiefpunkt, der eigentlich sämtliche Alarmglocken in Bewegung setzen müsste. Aber nicht bei den Sozialdemokraten, zwar fürchten die Bundestagsabgeordneten allmählich um den Erhalt ihrer bislang zahlreichen Sitze, aber an der Parteibasis scheint Friedhofsruhe bzw. nackter Fatalismus zu herrschen.
Es gibt nicht einmal eine parteiinterne Kritik an einem unbegreiflichen Wahlkampf zum EU-Parlament, wo man als „Friedenspartei“ mit einem „Friedenskanzler“ auf ein Thema setzt, dass man nach langem Zögern mit Waffenlieferungen für einen de facto Krieg konterkariert. Dass so etwas auch verstörend auf das Wahlvolk wirken könnte, scheint in den Kommandozentralen keiner bemerkt zu haben. Man könnte die aktuelle Liste des schwer begreiflichen erheblich verlängern, warum sich ein SPD-Kanzler am Nasenring von der FDP vorführen lässt, um seine am Boden liegende „Ampel“ zu retten oder teilt er gar die haarsträubenden Positionen der „Liberalen“ z.B. in der Kontroverse um die Schuldenbremse?
Was die Aktualität des Niedergangs an Fragen aufwirft, wird nur unzureichend beantwortet, wenn man in der Aktualität verharrt. Setzt man den Blick etwas weiter in die Tiefe der Entwicklung, ergibt sich vielleicht ein besseres Verständnis dafür, warum Deutschlands mit Abstand älteste Partei, die im letzten Jahr 160 Jahre alt wurde (wenn man Ferdinand Lassalles „Allgemeine Deutsche Arbeitervereinigung“ als Geburtsjahr nimmt), in einer existenzbedrohenden Krise steckt.
Am Erstaunlichsten ist allerdings, dass die allgemeine Öffentlichkeit dieses Problem mehr zu berühren scheint als das Opfer selbst. Mit stoischer Ruhe lässt die SPD eine Wahlschlappe nach der anderen über sich ergehen und sucht auch noch nach den kleinsten Körnchen Erfolg darin. Erbärmlicher kann man mit seinem Sinkflug kaum umgehen.
Sollte also der deutsche Soziologe und Vordenker des modernen Sozialliberalismus Sir Lord Ralf Dahrendorf am Ende doch Recht behalten mit seiner 1983 formulierten Provokation, das sozialdemokratische Jahrhundert ginge zu Ende? Seine Lordschaft Dahrendorf meinte allerdings, die Sozialdemokratie sterbe an ihren Erfolgen und werde damit ähnlich überflüssig wie Liberale Parteien, weil mittlerweile alle politischen Strömungen den Wesenskern des Liberalismus akzeptierten und dies sei nun auch der Sozialdemokratie gelungen. Dahrendorf feilte an dieser These allerdings paradoxerweise genau zu einem Zeitpunkt, als im Zuge von Thatcher und Reagan das sozialdemokratische Jahrhundert ganz anders beerdigt wurde, allerdings erfolgreicher noch als in Dahrendorfs Vision.
Des Erfolgsmodell
Betrachtet man die Geschichte der SPD, deren Krise ja zugleich eine weltweite Krise der sozialdemokratischen Linken ist, im Längsschnitt, dann fällt natürlich zunächst einmal auf, dass ihr Start als Arbeiterpartei, als Klassenpartei schon frühzeitig die Frage nach einer notwendigen Öffnung für andere Teile des Volkes aufwarf, allein schon um eine demokratische Mehrheit erlangen zu können. Aber mit der rasanten Industrialisierung im Deutschen Reich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts schien der Aufstieg der Sozialdemokratie als Arbeiterpartei ein Selbstläufer zu sein. Mit dem Siegeszug des Kapitalismus stieg auch die Zahl der „freien“ Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen und so gebar er zugleich seine eigenen Totengräber. Die Interessen von Kapital und Arbeit standen und stehen sich diametral entgegen. Aber der Glaube, der Kapitalismus zerbreche an seinem eigenen Siegeszug, erlitt schon um die Jahrhundertwende vor dem Ersten Weltkrieg erste Risse.
Die Frage war, wenn der Kapitalismus nicht einfach von selbst an seinen inneren Widersprüchen, seinen ihm inhärenten Krisen zusammenbrechen würde, wie kann man ihn überwinden? Die Antwort darauf spaltete die Einheit der Interessen in zwei strategische Lager, die sich immer weniger ergänzten, sondern bekämpften. Die eine Seite setzte auf soziale, politische und ökonomische Reformen mit dem Ziel einer anderen, einer solidarischen, sozialistischen Gesellschaftsordnung. Ihr politischer Kopf war Eduard Bernstein, der zudem auf einen friedlichen Übergang durch eine grundlegende Reform des politischen Systems setzte. Im Kaiserreich war das zuallererst die Änderung des diskriminierenden Wahlrechts. Dagegen stand personifiziert in Rosa Luxemburg der Zweifel daran, dass die herrschende Klasse sich auf diesem Wege aus ihrer Herrschaft verabschieden würde und plädierte für die Notwendigkeit einer politischen Revolution für die große soziale und ökonomische Veränderung.
Zwar stieg die Zahl der Industriearbeiter, aber auch die einer neuen Mittelschicht, die White-Collar-Proleten mit eigenem Klassenbewusstsein als Angestellte. Die SPD musste sich, um mehrheitsfähig zu werden, öffnen, denn nicht jeder Arbeiter wählte SPD, lange noch stand die konfessionelle Bindung insbesondere der Katholiken dem im Wege, und zugleich war glücklicherweise nicht jeder Sozialdemokrat auch Arbeiter. Hinzu kam, dass die Bauern bei steigender Produktivität in der Landwirtschaft zwar quantitativ weniger wurden, aber die Menge der kleinen Selbständigen blieben die sichere Bank für die massenhafte Absicherung des Eigentums der großen Grundbesitzer. Auf die „Bauernfrage“ fand die SPD nie eine erfolgversprechende strategische Antwort.
In Ansätzen vollzog sich der Wandel zur Volkspartei in der SPD schon in der Weimarer Zeit, aber der Durchbruch mit starkem Bezug zu der Gesamtheit der lohnabhängig Beschäftigten, die nun (fälschlicherweise) Arbeitnehmer hießen (schließlich nehmen sie ja keine Arbeit, sondern geben ihre Arbeitskraft dem „Arbeitgeber“, der sie dann für seinen Vorteil nimmt), vollzog sich dann in den 1950er Jahren und mündete in dem wegweisenden Godesberger Programm von 1959. Als moderne Arbeitnehmerpartei mit einer modernen Wirtschaftspolitik, die Karl Schiller in der Großen Koalition in der Minikrise 1966 als zeitgemäßen Keynesianismus zelebrierte, gewann die SPD gegen den Übervater Ludwig Erhard überraschend die wirtschaftspolitische Kompetenz, die sie zur Regierungspartei prädestinierte.
Erst hier – Ende der sechziger Jahre – hatte die SPD wieder ein in sich abgerundetes Konzept von Wirtschafts-, Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik, ein genuin sozialdemokratisches Ordnungskonzept gefunden, das auf der Höhe der Zeit zu sein schien. Reformpolitik wurde zu einem Markenzeichen mit einer klaren Botschaft. In Willy Brandts legendären Satz „Wir wollen mehr Demokratie wagen!“ verdichtete sich die Botschaft der Demokratisierung der Gesellschaft, als Mitbestimmungs- und Teilhabegesellschaft aller.
Die antizyklische Globalsteuerung der makroökonomischen Rahmenbedingungen durch staatliche Wirtschaftspolitik sollte a) die Geißel der Arbeitslosigkeit auf alle Ewigkeit beseitigen, b) Konjunkturschwankungen einebnen, c) dauerhaftes Wachstum bei Preisstabilität sichern und vor allem wandelte sich durch John Maynard Keynes‘ Theorie der Lohn vom reinen Kostenfaktor zur kaufkräftigen Nachfrage und wurde so zu einer der wichtigsten makroökonomischen Größe für ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht. „Wohlstand für alle“ wurde nun zur gesamtwirtschaftlichen Rationalität und ersetzte die betriebswirtschaftliche Unternehmensperspektive des Lohns als reinen Kostenfaktor.
Das Ende eines kurzen Traumes der ewigen Prosperität
Dieses Modell war, anders als in Ludwig Erhards West-Deutschland, längst das wirtschaftspolitische Credo der OECD-Länder und Basis des „kurzen Traums von der immerwährenden Prosperität“ des westlichen Nachkriegsbooms. Es verlor seine Anziehungskraft zu jenem Zeitpunkt, als sich in der BRD die SPD auf dem Zenit ihres Erfolges befand. Der Scheitelpunkt hat ein Datum: 1973 / 74. Ein Jahr nach dem atemberaubenden Wahlerfolg Willy Brandts, dem höchsten Stimmenergebnis aller Zeiten mit über 45 % zur stärksten Partei bei über 90 % Wahlbeteiligung und nach dem legendärsten aller Wahlkämpfe endete – zunächst unbemerkt – der sozialdemokratische Siegeszug.
Die Wende begann mit der „Ölkrise“. Im Yom-Kippur-Krieg 1973 setzten die Erdöl exportierenden Staaten, verbunden in der OPEC, ihren kostbaren Rohstoff als politische Waffe ein und erhöhten den Rohstoffpreis. Dieser Akt war der Ausgang einer Weltwirtschaftskrise, nicht aber die alleinige oder gar entscheidende Ursache für die nun folgende Phase der langen Stagnation. Dem abrupten Ende des Traums vom ewigen Wachstum folgte die Renaissance eines krisengeschüttelten Kapitalismus mit kontinuierlich steigender Massenarbeitslosigkeit, die nicht mehr konjunktureller, sondern struktureller Art war und mit jedem Konjunkturzyklus die Zahl der Langzeitarbeitslosen weiterwachsen ließ. Die Folgekosten der Massenarbeitslosigkeit verzehrten die Sozialleistungen und senkten den sozialpolitisch gewünschten Handlungsspielraum ins reine Krisenmanagement. Gegen die Dauerfolgen des kontinuierlichen sozialstrukturellen Wandels, deren schwergewichtigsten Verlierer die mächtigen Pfeiler der klassischen Industriegesellschaft Kohle und Stahl waren, den man später insgesamt als Übergang von der Industrie- zur Dienstleitungsgesellschaft oder zur postindustriellen Gesellschaft diagnostizierte, waren die Instrumente der Keynesschen Krisenentschärfung stumpfe Waffen.
Schlimmer noch war, dass es den Konservativen und Liberalen gelang, diese Krise als Folge sozialdemokratischer Inflationierung des Sozialstaates zu interpretieren. Aus dem Staat als Problemlöser im Keynesschen System wurde er zum Problem erhoben, weil er die selbstregulierenden Kräfte des freien Marktes durch politische Intervention außer Kraft setze. Der nun folgende Siegeszug des Neoliberalismus mit seiner Dreifaltigkeit von Wettbewerb, Privatisierung und Deregulierung in einem Weltfreihandelssystem erfasste nicht nur Großbritannien unter Margret Thatcher und die USA Ronald Reagans, sondern brachte auch die Sozialdemokratie weltweit in die Defensive. Denn dem sozialdemokratischen Reformprozess wurden nun deutlich die systembedingten Grenzen offenbart.
Der Strukturwandel, in Deutschland anders als in Großbritannien keine politisch gewollte Deindustrialisierung, wurde begleitet von einer Fülle sozialer Brüche, neuen Problemen und Herausforderungen, die allesamt keinen Wind in die Segel der Sozialdemokratie bliesen: Die Dezimierung des Industriesektors, forciert durch den freien Weltmarkt, der die „Weltarbeitsteilung“ aus der Kostenperspektive durch neue Profitmöglichkeiten umgestaltete, erreichte schnell auch die Industriearbeiterschaft und ließ die soziale Kernbasis weiter schmelzen. Die Zunahme des Tertiären Sektors schuf andere Arbeitsbedingungen, kreierte einen „Niedriglohnsektor“ und einen anderen Typus von Arbeitnehmer, der kaum noch gewerkschaftlich organisiert war. Der rasante Wandel der Qualifikationsstrukturen ging mit einer weiteren Ausdifferenzierung der abhängig Beschäftigten einher und die ökonomische Dauerkrise führte zu einer zusätzlichen Schwächung der Gewerkschaften, die sich durch einen sinkenden Organisationsgrad noch verschärfte.
Die damals noch umstrittenen ökologischen Herausforderungen erschienen als Frontalangriffe auf das Heiligtum der industriellen Wachstumsgesellschaft. Im Verbund mit den „Neuen Sozialen Bewegungen“, einer Erosion der klassischen Großmilieus sowie begleitet und genährt von einem nachhaltigen Wertewandel zu postmaterialistischen Werteorientierungen mit jeder nachwachsenden Generationskohorte schmolzen die mentalen und kulturellen Ressourcen der alten Arbeiterbewegung wie Butter in der Sonne. Die einen erfuhren die Grenzen des Wachstums primär durch den innerökonomischen Strukturwandel, die anderen thematisierten die erkennbaren ökologischen Grenzen des Wachstums. Die sah man, noch vor der Erkenntnis des Klimawandels, in der ebenfalls wahrgenommenen Endlichkeit der Naturressourcen.
Helmut Schmidt konnte anfangs – auch dank der Alternative Franz-Josef Strauß – den allmählichen Hegemonieverlust der SPD machtpolitisch zunächst noch strecken und als „Krisenmanager“ – verstärkt durch den RAF-Terrorismus – Ansehen einstreichen (auch als guter Kanzler in der falschen Partei), aber über eine neue Erzählung, ein neues sozialdemokratisches Projekt verfügte er nicht. Er schloss dergleichen bekanntlich auch kategorisch als „Vision“ aus. Machbarkeit und Realismus gepaart mit Verantwortung waren seine Alternativen zu „Reformen“, die nun nicht mehr bezahlbar zu Wolkenkuckucksheimen gerieten. In dem siebziger Jahrzehnt, das keinesfalls ein „rotes“ Jahrzehnt war, siegte die Atomenergie über die Förderung der Mikroelektronik, der Wachstumsglaube über den Anschluss an ökologische Herausforderungen.
Erhard Eppler war auch in der Sozialdemokratie zunächst die große Ausnahme, der sich für seine wegweisende Erkenntnis, dass das Zeitalter des Wachstums als Selbstzweck am Ende sei und durch die Idee eines „qualitativen“ Wachstums ersetzt werden müsse, dass sich an umweltverträglichen Bedürfnissen zu orientieren habe, auch bei seinen Genossinnen und Genossen den Vorwurf des „Romantizismus“ anhören musste. Er war ein einsamer Rufer in der Wüste. Ein zurückhaltender Willy Brandt war für diese Erneuerung zwar empfänglich, aber er musste als Parteivorsitzender nur noch den „Laden“ zusammenhalten.
Als Helmut Schmidt 1982 von Kohl durch den Wechsel der Liberalen zur Union aus dem Amt getrieben wurde, da hatte der „Zuchtmeister“ Herbert Wehner mit seiner Prognose, nun drohe 16 Jahre Opposition, leider exakt Recht. Aber er glaubte noch, danach könne es dann wieder von vorne losgehen. Hier irrte er gewaltig, denn die Partei, die dann mit Gerhard Schröder als Kanzler mit den Grünen als Koalitionspartner 1998 die Macht von Kohl übernahm, wollte nun gar nicht alles anders, sondern nur besser machen. Sie war längst vom Bazillus des Neoliberalismus so befallen, dass sie eigentlich gar keine Alternativen mehr hatte, die es laut Thatcher gegen die Macht der Ökonomie und deren Gesetze des Marktes ohnehin nicht gab.
Die programmatische Krise oder der Machtgewinn ohne Idee
Die Antwort der SPD war geboten realistisch, jedenfalls in der Schröderschen Variante, die Lafontaine noch mit einer anderen bis zu seinem Abgang in der Schwebe hielt: Man könne gegen „die Wirtschaft“ zwar Wahlen gewinnen, aber nicht gegen sie regieren, so die Parole Schröders. Für ihn gab es keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, sondern nur richtige und falsche. Und richtig war eine an der Betriebswirtschaftslehre und damit unternehmerische Rationalität ansetzende Wirtschaftspolitik an Stelle einer Makroökonomie wie sie sein eigentlicher Widerpart Lafontaine vertrat, der sogar den Sumpf des international entfesselten Finanzkapitalismus mit seinem französischen Amtskollegen Strauss-Kahn trockenlegen wollte. Dass er damit im Lichte der globalen Finanzkrise zehn Jahre später genauso richtig lag wie mit seiner früheren Kritik an dem ökonomischen Einigungsprozess in Deutschland, war gut für sein Ego, aber schlecht für die Welt und auch für die SPD.
Sozialpolitisch hatte das rot-grüne Projekt wenige eindrucksvolle Reformen hinterlassen. Es ging um Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Deutschland nach dem Muster der Angebotspolitik, und um die Meisterung der Kosten der deutschen Einheit, die man so nicht nennen durfte und doch sozialpolitische Auswirkungen hatten. Die Erfolge lagen in Politikbereichen, die den kleinen Leuten nicht viel sagten wie Atomausstieg, Frauenförderung und sozialpolitisches Neuland wie die Riester-Rente, die aus heutiger Sicht vermutlich mehr zur Stärkung des Finanzkapitalismus beitrug als zur Sicherung der Altersversorgung. Der Kanzler und Genosse der Bosse kokettierte zwar mit seiner Herkunft, aber als Anwalt der kleinen Leute trat er eigentlich nicht hervor. Seine Heldentat war es, den Amis im Irak-Krieg den Stinkefinger zu zeigen. Andernfalls wäre wohl schon seine Wiederwahl entfallen.
Allgemeine und spezielle Gründe für den Niedergang der Sozialdemokratie und die „Politikverdrossenheit“
Der Niedergang der SPD? Wer daran zweifeln sollte, dem sollen nur hier Zahlen helfen: Mitgliederschwund: Von 1 Mio. Mitte der 1970er und über 900 tsd. 1989 liegt sie heute bei 400 tsd. Allein seit 1998 verlor sie über 300 tsd. Mitglieder. Zugleich ist die Zahl der über 60jährigen auf 50 % gestiegen. Die soziale Zusammensetzung entspricht dem Erfolg der Bildungsexpansion, mehr als ein Drittel haben mittlerweile Hochschulreife, dagegen 50 % Haupt- bzw. Realschule. Der jugendliche Nachwuchs rekrutiert sich ganz überwiegend aus den Jungakademikern, was sich auch als Späterfolg der Bildungsreformen der siebziger Jahre feiern lässt.
Dass auch die CDU Einbrüche in der Mitgliedschaft zu verzeichnen hat, ist ein wichtiger Hinweis und verweist auf das Faktum, dass sich der Mitgliederschwund einbetten lässt in einen allgemeinen Trend seit den 1980er Jahren, den der Soziologe Ulrich Beck schon 1985 als Erosion der sozialen Milieus und ihrer Großorganisationen diagnostizierte. Es gibt für den Niedergang der SPD, der sich ja schleichend vollzog, mehrere Gründe und Erklärungen.
Ein Teil der Gründe für die Talfahrt der SPD lässt sich in der Tat in allgemeinen gesellschaftlichen Wandlungen verbuchen, die eher den Charakter eines sozialen Tsunamies haben und kaum konterkariert werden können. Da ist zunächst einmal der allgemeine Niedergang der großen Volksparteien mit ihrer sinkenden Integrationskraft als Ausdruck einer sich vermehrenden Pluralisierung der Arbeits- und Lebenswelten und einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft. Die unaufhaltsam fortschreitende Auflösung integrierender Großmilieus wie Kirchen und Gewerkschaften, die spätestens in den 1980er Jahren erkennbar wurden und sich parallel zum sozialstrukturellen Wandel der Gesellschaft von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft vollzog. Vom Wandel zeugen die Wechsel der Leitthemen der Neuen Sozialen Bewegungen wie Frauen-, Friedens- und vor allem die Umweltbewegung, die nun zunehmend die gesellschaftlichen Diskurse bestimmten. Themen wie Ökologie, Frauenbewegung, Lebensqualität und neue Lebensformen wie auch Problemfelder von bisherigen Minderheiten wurden von einem Wertepluralismus begleitet, der auch manche gelebte Sicherheit schwer erschütterte.
Der Wertewandel vom Materialismus, d.h. hier Streben nach mehr materiellen Wohlstand oder philosophischer des „Habens“ gegenüber dem „Sein“, also zum Postmaterialismus, traf die SPD schon in den 1970er Jahren ins Mark, denn ohne Öffnung zu den „Neuen Sozialen Bewegungen“ gab es keine machtpolitische Zukunft, aber zugleich drohte auch die Gefahr, die klassische Stammwählerschaft kulturell, mental und ökonomisch materiell zu verlieren. Die klassischen Industriearbeiter konnten überwiegend mit Umweltschutz recht wenig anfangen, von anderen Lebensformen ganz zu schweigen. In diesem Sinne verkörperte die Arbeiterschaft in Eintracht mit dem unternehmerischen Widerpart oder die klassischen bürgerlichen Parteien einen Industrie- und Wirtschaftsblock, dem Wachstum längst zum Selbstzweck geworden war und wer davor warnte, galt als Spätgeburt der Steinzeit. Erhard Eppler und Oscar Lafontaine wurden nicht nur von der konservativen „Springer-Presse“ als „Steinzeitsozialisten“ niedergeschrieben. Was die SPD nicht mehr integrieren konnte und teilweise auch nicht wollte, bildete in Gestalt der „Grünen“ ihre eigene politische Konkurrenzformation.
In diese Zeit der 1980er Jahre, in der die Grünen sich zu etablieren begannen, fällt aber auch eine gegenläufige, veränderte Einstellung nachwachsender Jahrgangskohorten zur Politik, die später als „Generation Golf“, so der Titel des dafür als Etikett wesentlichen Buches von Florian Illies, einen grundlegenden Wandel zum Bürgerschaftlichen Engagement insgesamt einläutete. Weg von Großorganisationen und hin zu kleineren überschaubaren Einheiten mit projekthaften Engagement, war schon eine Veränderung noch innerhalb des Engagements, die zu Lasten der Großorganisationen wie Kirchen, Gewerkschaften und Volksparteien gingen. Die Abkehr vom klassischen Ehrenamt und Verbindung mit Spaß veränderten diese Form gesellschaftlicher Teilhabe nachhaltig. Die Probleme, um die herum die kleineren und vielfältigeren Vereine kreisen, werden kleiner und die Gesellschaft glich immer mehr einem lose verbundenen Flickenteppich, wo „Szenerien“ nicht zufällig zu Ortsbestimmungen werden, die aber das Ganze nicht mehr erreichen und auch nicht mehr erreichen wollen. Immer mehr kreiseln in immer mehr kleiner werdenden Zirkeln um sich selbst mit Themen, die immer weniger immer mehr interessieren.
Aber der Wandel des Engagements ist noch die bessere Seite einer Entwicklung, deren Spitze auf deren Verzicht insgesamt zielte. Sich zu engagieren und dann gar noch politisch wurde im Übergang zu den neunziger Jahren in der „Generation Golf“, die sich dadurch auszeichnete, dass „Marken“ und privater Lebens- und Wohlstandgenuss das A und O des (post-)modernen Life Styles wurde, als ein Fall von Altertum angesehen, etwas für „Latzhosen“, Teeküchen mit „Räucherstäbchen, wo man seine „Betroffenheiten“ austauschte.
Woher kam diese Abkehr von der Politik, die sich in stetig sinkender Wahlbeteiligung niederschlug und niederschlägt und die man als „Politikverdrossenheit“ registrierte? Durch Zunahme der Skandale? Gebrochener Wahlversprechen? Nichts davon erklärt das.
Der Glaube an die Gestaltung der Gesellschaft durch die Politik schmilzt ab den 1980er Jahren parallel zum Aufstieg des Managers, insbesondere des „Bankers“ als dem „Master oft he World“. Politiker sind eigentlich überflüssige Figuren. Es entsteht der Eindruck, die Mächtigen werden nicht gewählt und die Gewählten haben gar keine Macht. Überhaupt zeigt sich ein Primat der Ökonomie, das sich weniger in der Herrschaft der Wirtschaft, wenngleich die zunehmende Bedeutung des Finanzkapitals nicht unterschätzt werden darf, als vielmehr als Form des Denkens äußert. Ökonomische Kategorien ersetzen soziale und politische: Effektivität, Effizienz und Wettbewerb wird zur neuen Dreifaltigkeit einer Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Es ist die Sternstunde der BWL als Leitwissenschaft. Demokratie als Korrektur von Marktergebnissen im Sinne von Gerechtigkeit ist Ausfluss ökonomischen Unsinns mit negativen Folgen. Das geistige Oberhaupt des Neoliberalismus Friedrich August von Hayek feiert seinen späten Triumpf.
Hier liegt der eigentliche Siegeszug des Neoliberalismus und in welchem Umfang er auch die Hirne der Linken bzw. der Sozialdemokratie erobert hat, davon zeugt die Politik der 90er Jahre.
Die eigenen Beschleuniger des Falls
Das alles erklärt aber noch nicht, warum es die SPD so viel schlimmer als z.B. die CDU getroffen hat, deren sozialen Vorhöfe ja ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Was den Eigenanteil der Partei an ihrem Sinkflug angeht, so wird man nicht daran vorbeikommen, dass eine der umstrittensten Reformen der Schröder-Ära geradezu symbolisch dafürsteht. Ihr Name ist Hartz IV. Und wenn diese Reform eine ökonomische Notwendigkeit gewesen sein sollte, wozu diente dann die Senkung des Spitzensteuersatzes um 10 % und die Abschaffung der Vermögenssteuer? Man kommt unabhängig vom ökonomischen Fluch oder Segen dieser und anderer Entscheidungen um das fatale Echo dieser „Reformen“ im Ergebnis, jedenfalls in der Wahrnehmung eines erheblichen Teiles der Wählerschaft nicht um die Erkenntnis herum: Auf dem Altar der Modernisierung und des „Standortwettbewerbs“ opferte die SPD ihre Rolle als „Schutzmacht der kleinen Leute“, wie sie Johannes Rau stets als Markenkern der Sozialdemokratie proklamierte.
Wem das zu pauschal ist, dem sei daran erinnert, bei der Bundestagswahl 2013 ergab die DIMAP-Wahlanalyse, dass 62 % aller Wähler und 54 % der SPD-Wähler der Aussage zustimmten, mit Hartz IV und der Rente 67 habe die SPD ihre Prinzipien aufgegeben. Die SPD verlor in ihrer Regierungszeit bis 2009 bei den Arbeitslosen 21 % und bei den Arbeitern 25 % der Stimmen, während 1998 noch jeder zweite Arbeiter SPD wählte, war es 2009 nur noch jeder vierte.
Wo nach der ersten Phase der Bildungsexpansion Jungakademiker noch Kümmerer für die Probleme der kleinen Leute waren, traten in der Agendapolitik neue Macher mit der Parole der Selbstverantwortung auf. Programmatisch hatte die (internationale) Sozialdemokratie keine Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung gefunden, außer einer vermeintlich gemäßigten Variante des Neoliberalismus. Die drückte sich in dem so genannten „Dritten Weg“ aus, der darin bestand, die Erfordernisse der Globalisierung „sozial“ abzufedern. Allein selbst davon blieb nicht allzu viel übrig. Nicht nur sozialpolitische Opfer wurden auf dem Altar der Globalisierung erbracht, es folgten gesellschaftspolitische Umstrukturierungen, wo selbst Bereiche, die bis dahin der „Daseinsvorsorge“ zugerechnet wurden, der Ökonomisierung geöffnet und der Privatisierung übergeben wurden. Der kommunale Ausverkauf von Wohnungsbaugenossenschaften zwecks Sicherung bezahlbaren Wohnraums für kleinen Leute wurde leider auch in sozialdemokratisch geführten Gemeinden zum Modernisierungszeichen. Realismus hieß Anpassung und das lief unter der Flagge des „Pragmatismus“ und heraus kam eine politische Technokratie, die sich dann wunderte, warum immer weniger überhaupt noch wählen und den abwegigen Eindruck verfielen, zu wählen gäbe es eigentlich auch nichts. Wie viel Basis hier auch schon für den rechten Populismus geschaffen wurde, bedarf noch genauer Untersuchungen.
Damit fungierten die Demokratie und die Politik nicht mehr als Widerpart zur privaten ökonomischen Macht, sondern degenerierte zum technokratischen Vollzug vermeintlicher ökonomischer Imperative. Politik wurde zum verlängerten Arm einer Ökonomie, die selbst nicht mehr Gegenstand von Auseinandersetzungen war. Was in der Schlangengrube der neoliberalen Konkurrenzgesellschaft der sozialdemokratische Grundwert der Solidarität für eine Rolle spielen sollte, wurde immer rätselhafter und landete schließlich in der Antiquitätenkammer. Wohlstand für alle geriet zum leeren Versprechen, dass sich immer mehr teilte in jene, die sich als „Global Player“ zu den Profiteuren der Globalisierung zählen durften und den „Losern“, die das Pech haben, für die teilweise gleiche Arbeit in der falschen Branche tätig zu sein.
Ungleichheit wird heute zwar sogar wieder als Risiko und Nachteil für Wirtschaftswachstum gesehen, zwischenzeitlich aber war sie die Basis neuen Wohlstandes, denn Lohnspreizung galt als unvermeidbare Begleiterscheinung der Dienstleistungsgesellschaft und zudem als Leistungsanreiz für soziale Hängemattenbewohner. Hier ist die Crux, denn die Erzählung, wir säßen alle in einem Boot der Wettbewerbsfähigkeit in dem man erfolgreich das Boot und damit alle Insassen zum Steigen bringe, war ein übles Märchen. Die Erfahrung lehrte etwas anderes, in dem Boot sitzen in jedem Land Gewinner und Verlierer. Schon das Schröder – Blair Papier von 1999 glich einer Kapitulationsurkunde gegenüber dem neoliberalen Mainstream und erfreute nicht zufällig besonders den Herrn Westerwelle von der neoliberal gestrickten FDP als Beginn der Läuterung der SPD. Dieser „Dritte Weg“ in die „Neue Mitte“ war nicht die schlimmste Sackgasse, es war der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit der europäischen und globalen Sozialdemokratie. Wozu brauchte wer eine solche Sozialdemokratie?
Die Krise der repräsentativen Demokratie trifft vor allem die SPD und gebiert eine neue Rechte
Mittlerweile haben die politischen Folgen des Neoliberalismus auch die Demokratie selbst in ihrem Bestand gefährdet. Der auffälligste Indikator war die kontinuierlich sinkende Wahlbeteiligung. Es galt unter Wahlforschern lange als ausgemacht, dass darunter alle politischen Lager und Parteien mehr oder weniger gleichmäßig leiden und es sich dabei um ein Phänomen handele, dass sich als Mix aus Parteien- und Politikverdrossenheit hinreichend erklären ließe.
Schon ein Blick auf die Stimmbezirke mit den geringsten Wahlbeteiligungen öffnete zugleich den Blick auf offenkundige soziale Schieflagen. Man fand sie – vor Ort gesprochen – im Schinkel und nicht am Westerberg. Eine verdienstvolle Studie des damaligen an der Osnabrücker Universität lehrenden Politikwissenschaftlers Armin Schäfer „Der Verlust politischer Gleichheit“ hat auf der Basis von Wahldaten aus 23 OECD-Ländern seit den 1980er Jahren einen signifikanten Zusammenhang der Zunahme von Einkommensungleichheiten und sinkender Wahlbeteiligung herausgefunden. Die Nichtwähler stammen überwiegend aus schwächeren Sozialschichten und waren vor allem Wähler der SPD bzw. Linker Parteien. Es handelt sich um jene „neuen Unterschichten“, die schon vor der Finanzkrise in einer Studie der Friedrich -Ebert-Stiftung erkannt und vom damaligen SPD-Vorsitzende Kurt Beck zum Entsetzen der Öffentlichkeit auch so benannt wurden. Das Besondere an Schäfers Wahlanalyse ist allerdings darüber hinaus, dass die verbreitete Einschätzung, die Wahlentscheidungen seien heute unabhängiger von der Klassenzugehörigkeit, keinesfalls falsch sei.
„Wie man wählt, hängt heute weniger eng mit der Klassenlage als in der Vergangenheit zusammen, aber ob man wählt dafür umso stärker.“
Es sind jene „Abgehängten“, als Prekariat bezeichneten desillusionierten Schichten von „Überflüssigen“ (so der Soziologe Heinz Bude), die in der Gesellschaft weder vorkommen noch das Gefühl haben, dort überhaupt gebraucht und geachtet zu werden. Als abqualifizierte „Kostgänger“ der Allgemeinheit haben sie sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und machten mittlerweile ca. ein Drittel der Gesellschaft aus. Womit sich die von Peter Glotz, dem früheren SPD-Bundesgeschäftsführer, schon in den 80er Jahren prognostizierte Zweidrittel-Gesellschaft bewahrheitet.
Da diese „Abgehängten“ sich als kaum reaktivierbar erwiesen, konzentrierte sich die Politik vorzugsweise auf eine andere Wählerbasis, auf die sogenannte Mitte. Auch die Mittelschicht als Leistungsträger der Gesellschaft ist gemäßigt für den Sozialstaat, allerdings vorzugsweise in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Pflege, wo man selber Leistungsempfänger werden kann, aber nicht bei Kosten der Arbeitslosigkeit und Armutsbekämpfung oder der sozialen Integration. Eine zunehmend von Abstiegsängsten getriebene Mitte ist aber keine sozialintegrative Kraft. Sie vagabundiert als flexible Wählerschaft zwischen den Parteien, ist „ideologiefrei“ und in ihrem pragmatischen und technokratischen Politikverständnis lediglich am eigenen Wohlergehen orientiert. Sie bilden den Klassiker des nutzenmaximierenden Wechselwählers.
Die Depravierten dagegen blieben lange Zeit im Verborgenen, sie fehlten der Linken bzw. den sozialdemokratischen Parteien, verhielten sich stumm solange sie sich nirgends artikulieren konnten, aber dann entluden sich Proteste zum Entsetzen der Arrivierten mit auch nationalen Parolen, die die „Mitte“ gerne als „Populisten“ und als die großen Vereinfacher disqualifizieren.
Wie kommt es, dass nicht nur die Unterschicht – wenn überhaupt –, sondern auch Arbeiter plötzlich ihre neoliberalen Todfeinde in nationalistischem Kostüm wählen, als Front National und auch AfD und all den anderen Gewächsen, die sich mittlerweile global breit machen? Dass bei uns wohlgenährte Globalisierungsgewinnerbranchen eine CDU wählende Arbeiterschaft hervorbringen, überrascht weniger, denn „größer werdende kleine Leute“ vergessen auch gerne ihre Herkunft. Aber eine rechtsnationale Partei?
Die Antwort ist vielleicht einfacher als man denkt. Nationalismus wird zur einzigen Antwort auf die nicht erfüllten Versprechungen der Globalisierung. Wenn Globalisierung, Modernisierung etc. für die Betroffenen mehr Bedrohung als Gewinn ist und Internationalität mit der früheren „internationalen Solidarität“ nichts mehr gemein hat, sondern nur noch Wettbewerb zu eigenem Lasten ist, dann bleibt als einzige Schutzmacht gegen diesen Konkurrenzkampf, als politisches Korrektiv gegen den Terror der Ökonomie, nur noch die „Nation“. Jedenfalls bietet sich eine modernisierte und globalisierte Sozialdemokratie nicht mehr als Anwalt an. Sie verspricht zwar noch, die Globalisierung sozial gestalten zu wollen, was weder programmatisch noch machtpolitisch die geringste Plausibilität an sich hat. Zumal es ihr nicht einmal gelungen ist, den EU-Binnenmarkt sozial zu gestalten. Bei dieser Konstellation sind die Nationalisten die einzig denkbaren Schutzpanzer gegen die Fluten von außen. Das mag illusionär sein, ist aber nicht irrational.
Hier findet sich auch der Grund für die Distanz zur EU in den Sphären der „sozial Schwachen“, denn für die „einfachen Leute“ war das immer nur ein Elitenprojekt. Ein „soziales Europa“ war einmal der Traum Jacques Delors‘, ansonsten regierte der Binnenmarkt als Leitbild für die Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Konkurrenzkampf. Der Primat, das Diktat der Ökonomie ist quasi der Kernelement der EU incl. ihrer Erweiterungen, allen sonntäglichen Wertegemeinschaftsgerede zum Trotz. Wer heute aber glaubt, die EU produziere für ihn mehr Übel und Probleme als Wohltaten, der wird parteipolitisch zur Rechten gedrängt.
Das gilt übrigens leider auch für die Migrations- und Flüchtlingsfrage. Nicht jedem begegnen sie als Bereicherung unserer kulturellen Vielfalt, sondern auch oder vor allem als reale oder potenzielle Konkurrenten auf den Arbeits- und Wohnungsmärkten. In diesem Revier ist die SPD mittlerweile vielleicht irreversibel verloren, sie hat ihr gesamtes Vertrauenskapitel hier komplett verspielt bzw. auf dem Altar einer Modernisierung geopfert für die Rettung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Wenn das der Preis war, dann muss die Partei allerdings auch hinzufügen, in dieser wettbewerbsfähigen Ökonomie gehören Einkommensspreizung, ein neues Dienstleistungsproletariat mit Niedriglohnsektor zur Erfolgsstory, aber das hat mit allem, was der Sozialdemokratie mal lieb und teuer war, nichts mehr zu tun. Daran hat auch die verdienstvolle Einführung des Mindestlohnes bekanntlich nichts geändert.
Zur kompletten Wahrheit gehört allerdings auch, dass die SPD mit dem Drang in die Mitte die sozialen Ränder verlor, aber ohne die Mitte auch ihre Gestaltungskraft verliert. Und es ist diese Mitte, die sich vor allem durch Heterogenität auszeichnet, anfällig für Wohlstandsverluste und Abstiegsängste ist, also ein auf Bewahrung, Sicherheit und nicht auf Veränderung eingestelltes breitgefächertes Wählerreservoir darstellt, die die SPD ebenfalls braucht, um noch gestaltend wirken zu können. Ob sie jemals ihren Status als „Volkspartei“ wieder erlangt oder erlangen kann, ist wohl zu bezweifeln. Mehr denn je scheint sich die politische Attraktivität auf den Faktor der Personalisierung zu verlagern.
Was ist zu tun?
Sicherlich ist die gegenwärtige Krise der SPD auch bedingt durch einen Mangel an überzeugendem Personal. Sie wird repräsentiert von einem Smilie, der nichts erklärt, aber viel verspricht. Er ist nicht einmal ein Krisenmanager seiner Koalition, deren produktivstes Element der Streit untereinander zu sein scheint, wo die stärkste Partei, die SPD sich in der Rolle des Zuschauers suhlt. Dass sie zumindest momentan nicht mit verheißungsvollem Personal aufwarten kann, ergänzt nur die inhaltliche Leere. Beschaut man sich die gesamte Ministerriege, weiß man wie Krise aussieht. Aber eine Verengung auf den Faktor Personal wäre eine gefährliche Verkürzung, dahinter lauert die Gefahr des Messias-Effektes. Hinzu kommt, dass Charisma nicht gezüchtet wird.
Kern ihres Problems ist, dass die Partei intellektuell völlig ausgezehrt ist. In kritischen Intellektuellenkreisen ist sie kein Hoffnungsschimmer mehr, sondern ein hoffnungsloser Fall. Sie ist ein harmonischer Verein ohne Flügelkämpfe, eigentlich für Wahlen wegen des inneren Friedens und vermeintlicher Einheit bestens aufgestellt. Was aber offensichtlich von der Wählerschaft nicht so erkannt oder nicht honoriert wird. Das neue Problem ist, dass die sonst übliche „Zerrissenheit“ einer gähnenden Langeweile gewichen ist. Die Partei ist flügellahm, denn es gibt sie – die Flügel – nicht mehr, da die Parteirechte in Gestalt des „Seeheimer Kreises“ in der Mitte der Partei sitzt, rechts davon ist die Wand und eine Linke scheint es nur noch draußen zu geben. Die Partei ist in den Händen und dominiert von einem Pragmatismus, der Ideenlosigkeit für Realismus hält und mangels Alternativen zur Realität Politik zum technokratischen Geschäft ohne Seele verkommen lässt. Ein Programm ohne Gesicht ist so gut wie nichts wert, aber Gesichter ohne Programm sind noch weniger wert.
Versuche durch konkrete Wahlversprechen heterogene soziale Interessen zu bündeln, ist nicht erfolgversprechend, sie sind zwar konkret, sie verdecken nur das eigentliche Manko. Was fehlt ist ein Kompass, ein programmatisches Konzept in einer Zeit voller Krisen und Ungewissheiten oder das, was man neuerdings ein „Narrativ“ nennt. Es ist eine politische Antwort auf die außerordentlichen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. In DIE ZEIT v. 24. Juni 2024 hat Bernd Ulrich unter dem Titel War’s das jetzt, Genossen? das Elend der SPD auf den Punkt gebracht: „Offenbar hat die SPD ihre Rolle in diesem Jahrhundert noch nicht verstanden.“ Dabei sei die SPD nicht nur im Kanzleramt, sondern auch noch im Bundespräsidialamt an der Macht, aber überall der gleiche Eindruck: Man arbeite sich maximal an der eigenen nun in die Kritik geratene aaußenpolitische Vergangenheit ab, aber kommt nicht zum Begriff dessen, was die Zukunft von uns eigentlich verlangt.
In der Tat stehen wir vor der Herausforderung, dass was Scholz als die „Zeitenwende“ in Bezug auf die europäische Sicherheitslage durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgerufen hat, mit erweitertem Blick auf die Weltlage und dem Zustand unseres Planeten in noch ganz anderen Dimensionen weiter zu denken: Wir stehen am Ende einer siebzig Jahre währenden Vorherrschaft des Westens, wo wir im Windschatten der amerikanischen Macht und Hegemonie mitsegeln konnten. Diese goldene Ära der gesicherten Wohlstandmehrung ist am Ende.
Erstens verändern sich die globalen Machtstrukturen zum Nachteil des „Westens“, den zu definieren nebenbei auch immer schwieriger wird. Die globale Machtstruktur wird aller Wahrscheinlichkeit nach multipolar von fünf Großmächten in mehr oder weniger gefestigten Konkurrenzverhältnissen geprägt. Die USA, China, Indien, Russland und die EU, wenn sie denn in Zukunft als Einheit dazu in der Lage ist. Andernfalls versinkt Europa in die Bedeutungslosigkeit. Welche Sicherheitsarchitektur sich in dieser neuen Konstellation entwickelt, ist keinesfalls entschieden. Ebenso wenig entschieden ist, welche künftige Weltwirtschaftsordnung daraus entsteht. Wer hier dauerhaft mit wem wie kooperiert ist keinesfalls in Stein gemeißelt.
Sicherer ist dagegen, dass unser bisheriges Wohlstandmodell nicht nur theoretisch, sondern zunehmend faktisch durch den sich schon vollziehenden Klimawandel verändern wird. Die Kosten allein für die jetzt schon auftretenden Folgekosten der nicht vollzogenen Maßnahmen gegen den Klimawandel steigen mit jeder Unwetterkatastrophe und sie sind nichts anderes als Wohlstandverluste, auch wenn Versicherungen für sie aufkommen. Die Bilanz von vorläufigen Wohlstandsgewinnen durch Unterlassen oder Aufschub von klimaschonenden Maßnahmen (Stichwort Verbrennungsmotor) zu den steigenden Folgekosten wird immer schneller erfahrbar und werden den Druck auf den erforderlichen Wandel erhöhen.
Da sich die bislang von der SPD favorisierte Problemlösung durch technologische Innovation mit erneuten Wachstums- und Wohlstandseffekten als unzureichend erweisen wird, steht der Partei zusätzlich ein Kampf um Werte und Lebensformen ins Haus, für den sie nicht gerade geschaffen ist und den sie zu Recht befürchten muss. Denn auf Wachstum war die gesamte reformistische Strategie angelegt, es ging nicht um Strukturveränderungen, also Eingriffe in die Besitz- und Eigentumsverhältnisse, nicht um die Veränderung der Herrschaftsverhältnisse, sondern um die „gerechtere“ Verteilung des materiellen Wachstums. Und die Verteilungskämpfe verlaufen bekanntlich friedlicher, wenn der zu verteilende Kuchen wächst.
Verbindet man diese absehbaren „Kosten“ mit denen, die eine veränderte internationale Sicherheitsstruktur mit sich bringen wird (Verteidigungskosten), dann wird erkennbar, was die „Zeitenwende“ wirklich bedeutet. Die Konservativen und Liberalen verstecken sich vor der Flut dieser Herausforderungen. Deren „Weiter so…“ ist keine Antwort auf die Probleme, sondern eine Verlängerung des Weges in eine Sackgasse der Vertagung des Notwendigen. Hier liegen die Aufgaben und Chancen der Sozialdemokratie. Veränderungen sind notwendig. Die reale Herausforderung lautet: die sieben fetten Jahrzehnte sind vorüber und für ein tragfähiges Zukunftsprojekt müssen radikale Konsequenzen gezogen werden, denn radikal sein heißt, einer Sache an die Wurzel gehen und das ist etwas, was die pragmatische SPD völlig verlernt hat. Entweder sie erinnert sich produktiv dieser Tugend, die sie einst groß und stark gemacht hat, oder sie wird still und leise einfach dahinsiechen und irgendwann nur noch als Erinnerung existieren.