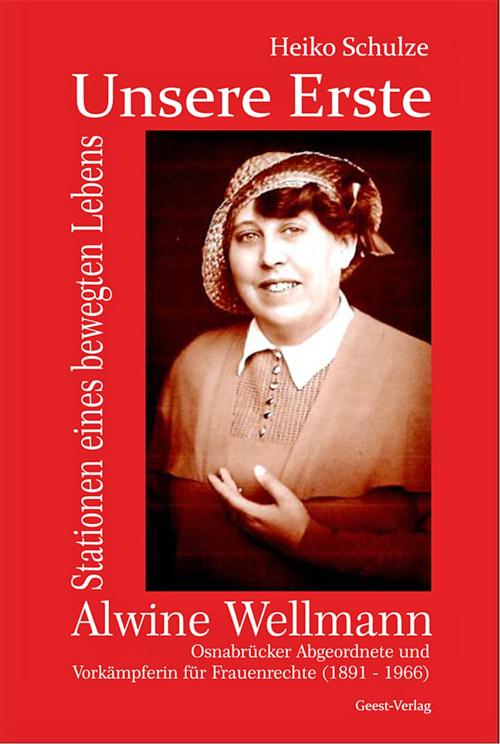Versuch einer Darstellung und Würdigung seines Werkes
(Erster von fünf Teilen)
Kants Lebensweg und Schaffen oder das Werk als Leben
„Immanuel Kant ist der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, die Kritik der reinen Vernunft ein Meilenstein der Geistesgeschichte. Seit Platon und Aristoteles hat niemand über so viele und unterschiedliche Themen tiefer und innovativer nachgedacht als Kant. Er „zermalmte“ die traditionelle Metaphysik – und begründete eine neue. Er erklärte die Entstehung unseres Planetensystems und formulierte den kategorischen Imperativ. Er war der Wegbereiter des Kosmopolitismus und der modernen Idee der Menschenwürde. Sein Denken hat nicht nur die Philosophie und Wissenschaft, sondern auch das deutsche Grundgesetz und die Vereinten Nationen geprägt.“
Mit dieser Würdigung eröffnet Marcus Willaschek seine viel gelobte Kant-Biografie, die anlässlich des dreihundertsten Geburtstags von Kant im letzten Jahr erschien. Für einen Grund, sich mit diesem außergewöhnlichen Menschen zu beschäftigen, ist damit eigentlich fast alles gesagt. Aber es gab und gibt auch andere Urteile über Kant. Bertrand Russell beispielsweise galt Kant „nicht als der größte moderne Philosoph.“ Rühmt ihn aber als Anhänger der Demokratie und als „religiös liberal.“ (Russell, 715)
Wir können hier weder die Lektüre der Werke des Jubilars ersetzen noch eine angemessene Biografie liefern, hier soll lediglich der (riskante) Versuch unternommen werden, einem breiteren Interessentenkreis einen Zugang zu diesem Werk und seinem Autor zu bereiten und nebenbei auch kritische Elemente zur Sprache zu bringen.
Unser Jubilar wurde am 22. April 1724 in Königsberg (heute Kaliningrad) geboren. Dort lebte, wirkte er und starb dort am 12. Februar 1804, kurz vor seinem 80. Geburtstag, friedlich an Altersschwäche. Königsberg, die einst mächtige Handelsstadt Preußens im Südosten der Ostsee, ist heute fast nur noch durch ihren großen Sohn als „Kant-Stadt“ bekannt. Man hatte sich daran gewöhnt, sein Leben damit hinreichend beschrieben zu haben und den Menschen ganz in seinem Werk aufgehen zu lassen. Er gilt als einer der Denkriesen auf deren Schultern wir Nachkommenden als Zwerge weiterschauen können und als der Philosoph der Aufklärung, an den niemand vorbeikommt.
So unspektakulär sein Leben dahinglitt, zum Verständnis seines Werkes ist es nicht so unwichtig, wie es oft vermittelt wird. Der frühe Kantkritiker und prominente Philosoph Johann Gottlieb Fichte „deduzierte“ in einer seiner zahlreichen „Wissenschaftslehren“, was für eine Philosophie man wähle, hänge davon ab, was für ein Mensch man sei. (Fichte, 434) Aber wenn das allmächtige „Ich“ (in diesem Falle nicht das transzendentale, sondern das empirische) seine Philosophie wählt, wählt das dann philosophisch gewordene Ich nicht auch, was für ein Mensch man sein oder werden will? Kants Entscheidung, sich der Philosophie zu widmen, fiel früh. Ob sein Werk mehr von seiner Persönlichkeit oder diese von seinem Werk bestimmt wurde, dürfen wir hier offenlassen. Jedenfalls ist das eine vom anderen nicht zu trennen und damit ist die Person hinter dem Werk nicht zu vernachlässigen.
Der Lebensweg eines Mannes mit Eigenschaften
Kant wurde als viertes von neun Kindern des Riemermeisters Johann Georg Kant und seiner Ehefrau Anna Regina in bescheidenen Verhältnissen geboren, die ihn für sein gesamtes Leben begleitet und geprägt haben. Bescheidenheit war nicht nur durch die streng pietistische Erziehung seiner Mutter seine vorzügliche Tugend. Zum Teil auch aus Not, aber auch dann noch, als diese sie nicht mehr erzwang. Zufall und Glück bescherten den körperlich nicht sehr tüchtigen Jungen eine schulische Förderung seiner früh erkannten intellektuellen Gaben. Sie ermöglichen ihm mit sechzehn Jahren den Wechsel auf die Universität von Königsberg, wo er sich in Mathematik und Philosophie immatrikuliert. Die Naturwissenschaften, die auf der Schule nicht unterrichtet wurden, interessiert ihn am meisten.
Den ersten, langen Abschnitt seines sich daran anschließenden Gelehrtenlebens widmet Kant nahezu ausschließlich naturwissenschaftlichen Themen und Problemen. Er war kein Erfinder, kein Bastler mit praktischen Folgen, die das Leben der Menschen erleichtern und verbessern. Er grübelt über grundsätzliche Fragen der Natur, die vorzugweise der Physik und der Mathematik zuzuordnen sind. Hier steht er unter dem Einfluss des bis dahin bedeutendsten deutschen Philosophen: Gottfried Wilhelm Leibniz. An ihm und dem ihm zugeordneten Christian Wolff und seiner Schule arbeitet sich Kant zunächst ab. Wenn man Leibniz zum letzten Universalgelehrten erhebt, der noch in allen Gebieten und Disziplinen zu Hause war, dann könnte man unserem Jubilar damit Unrecht antun.
Erstaunlich ist der publizistische Einstieg. Mit 22 Jahren wirft er 1746 auf 15 Bögen eine Schrift mit dem Titel Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte auf den Markt, die schon deshalb beeindruckt, weil Naturwissenschaft und Mathematik für ihn absolutes Neuland waren. Aber an der Königsberger Universität wurde von einem Professor namens Martin Kuntzen seine Begabung dafür entdeckt und sein Interesse daran gefördert. Er versorgte ihn aus seiner Privatbibliothek unter anderen mit den Schriften Isaac Newtons, der fortan zum wichtigsten Bezugspunkt des Interesses Kants und zu seinem Leitbild wurde.
Das Erstlingswerk widmete sich der für die mechanische Physik zentralen Frage, „ob die Größe der bewegenden Kraft dem Produkt der Masse mit der einfachen Geschwindigkeit (Descartes) oder deren Quadrat (Leibniz) gleich sei.“ (Vorländer I., 56) Zwar war sein Lösungsvorschlag nicht korrekt, auch nicht auf der Höhe des damaligen Stands der Forschung, den er nicht genau kannte, aber entscheidend war, dass sich hier jemand mit einem außerordentlichen Scharfsinn und einer strengen Beweisführung zu Wort meldete, der große Erwartungen weckte.
Neun Jahre später hätte er unter günstigeren Umständen sein außerordentliches Talent schon bestätigen und zur öffentlichen Anerkennung bringen können. Seine Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt hatte er dem Preußenkönig Friedrich II. in devoter Manier gewidmet. Dieses Werk hätte eigentlich schon zum Eintritt in die Ruhmeshalle der Wissenschaft gereicht, denn die hier entwickelte These von der Weltentstehung brachte den Gedanken der Entwicklung in die anorganische Natur und damit erhielt die Natur selbst eine Geschichte.
Wenn Bücher ihre Schicksale haben, dann gilt das für dieses in besonderer Weise. Es wurde zunächst anonym gedruckt und im Katalog der Leipziger Ostermesse im März 1755 angekündigt. Doch während des Druckes ging der Königsberger Verleger bankrott. Ein Jahr später wurde es dann unter Kants Namen als Verfasser zum Verkauf angeboten, aber ihm blieb die erhoffte Verbreitung und Anerkennung zunächst versagt, die sich erst einige Zeit später einstellte.
Seine kühne Theorie der Entstehung des Weltgebäudes und der Planetenbewegung basiert auf Newtons Erkenntnis des Einflusses der Gravitation auf die Bewegung der Himmelskörper, die Kant in einen Zusammenhang mit der Entstehung des Sonnensystems und des Weltalls bringt. Was Newton noch als unerklärbar dem unerforschlichen Willen Gottes übergab, erklärt Kant mit der konsequenten Anwendung der Gravitationsgesetze. Der Schöpfungsakt ist ein Naturgesetz, es bedarf keiner „übernatürlichen Kräfte“, um die Entwicklung vom Chaos des Anfangs zum harmonischen Weltganzen zu erklären. Das klingt zwar nach Atheismus, aber die Entstehung von Materie sowie Raum und Zeit delegierte auch Kant noch an einen „Schöpfer“.
Kant beherrschte das damalige Wissen über die Physik, Astronomie, Geographie und andere Wissenschaften seiner Zeit. Er lehrte und vermittelte es an der Universität so vorzüglich, dass die Studenten von seinen geistreichen und auch humorvoll-witzigen Vorlesungen schwärmten. Die Philosophie, für die er eigentlich bezahlt wurde und sich bei ihm auf die Logik konzentrierte, geriet zu seinem größten Hobby. Seine Maxime war dabei stets, dass er nicht Philosophie, sondern seinen Studenten das Philosophieren lehren wolle.
Bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr waren Themen aus dem Spektrum der Naturwissenschaften, vorzüglich der Physik sein Schwerpunkt. Doch zu Beginn der 1860er Jahre wurde die Lektüre des Emile von Jean-Jacques Rousseau sein prägendes Bildungserlebnis, das sein Denken grundlegend änderte, weil er durch dieses Erziehungswerk ein anderes Bild vom Menschen erhielt. Rousseau öffnete ihm den Blick auf die „unverstellte Menschennatur“. Das war eine andere Welt, als die von Gesetzen bestimmte Weltordnung Newtons. Hier herrschte „Mannigfaltigkeit“, aber im Unterschied zum „synthetisch“ verfahrenden Rousseau, der vom „natürlichen Menschen“ ausgehe, verfahre er „analytisch“ und gehe vom „gesitteten Menschen“ aus.
Neben der Begegnung mit Rousseaus Werk fiel in diese Zeit ein weiteres Bildungserlebnis. Der Engländer David Hume hatte ihn mit seinen erkenntniskritischen Beiträgen aus einen „dogmatischen Schlummer“ geweckt. Humes entschiedener Skeptizismus, der in der Bezweiflung des Kausalgesetzes mündete, weil dieses nicht auf Erfahrung beruhen könne, beflügelte Kant, sich grundsätzlich neu mit den Grundlagen unserer Erkenntnis zu beschäftigen. Er verkündete, auf die zentrale Frage „wie etwas aus etwas anderem“ notwendig folgen könne, „dereinst“ eine Antwort liefern zu wollen. Aus dem „Dereinst“ wurden acchtzehn Jahre, denn erst im Jahre 1781 erschien mit der Kritik der reinen Vernunft endlich die Antwort. Dabei war ein grundlegender Gedanke schon in den 1766 erschienen Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik formuliert, als er forderte, der Metaphysik müssten „Grenzen durch die menschliche Vernunft“ auf dem „Boden der Erfahrung“ gesetzt werden, die den „gemeinen Verstand“ nicht verlasse. (I. 982)
Sein Weg zu der angestrebten akademischen Karriere, einer festen Professur, war langwierig und entbehrungsreich. Zwar wurde er überall als großes Talent gehandelt, drohte aber als ein „ewiges“ zu enden. Er war längst ein weithin anerkannter Gelehrter, als er an der Königsberger Universität Semester für Semester sein reichhaltiges Vorlesungsprogramm absolvierte. So fit und rege sein Verstand, so geschwächt war seine körperliche Konstitution. Der kleine, nur 150 cm große Mann mit der eingefallenen Brust, die ihm zuweilen mangelnde Luftzufuhr bescherte, war auf Zeichnungen immer leicht gebückt festgehalten worden, Er hatte in Relation zu seinem schmächtigen Körper einen relativ großen Kopf. An dem faszinierte nicht nur der Inhalt, sondern seine Zeitgenossen hoben neben den blonden Haaren die lebhaft funkelnden blauen Augen hervor. Wenn die Augen das Fenster zur Seele eines Menschen sind, dann waren sie im Falle Kant das besonders Einnehmende an seinem Äußeren. Der immer etwas kränkliche Mann war am Ende seiner Lebenszeit altersschwach, sonst aber nie ernsthaft erkrankt, was er, wissend um seine physischen Schwächen, einer eisernen Selbstdisziplin in jeder Hinsicht verdankte.
Dennoch war er alles andere als ein Stubengelehrter. Er war bekannt als ein geselliger, geistreicher und charmanter Mensch, der gern Billard spielte, mit Vorliebe um Geld pokerte und gern mit Menschen außerhalb der Universität tafelte, um sich zu unterhalten und zu amüsieren. Diese Seite seines Charakters und Lebens stand allerdings überwiegend im Schatten seiner hochdisziplinierten Lebensführung, von der kolportiert wurde, dass der präzise programmierte Tagesablauf so verlässlich war, dass man in Königsberg nach den Spaziergängen des Professor Kant die Uhren stellte.
Der Professor und sein Meisterwerk
Zu der ersehnten Professur für Logik und Metaphysik an der heimischen Universität gelangte er dann 1770 doch noch, nachdem er gut bezahlte Rufe nach Jena und Erlangen aus „Anhänglichkeit an meine Vaterstadt“ abgelehnt hatte. In aller Ruhe arbeitete er nun im Verborgenen an seinem großen Wurf, von dem nur er etwas wusste. Aber die Arbeit dauerte länger als geplant. Das Werk wird in die Geschichte eingehen und die Geisteswelt revolutionieren. Es war zwar von langer Hand vorbereitet, aber seine Fertigstellung erforderte mehr Kraft und Geduld als geplant, obwohl die Niederschrift dann in nur wenigen Monaten erfolgte.
Wer sich nur ein wenig mit Kultur- und Geistes- oder – weniger belastet – Ideengeschichte oder gar Philosophie beschäftigt oder als WissenschaftlerIn über die Grundlagen der jeweiligen Disziplinen reflektiert, kommt an Immanuel Kant nur schwer vorbei. Es gibt keine Geschichte der Philosophie, in der sein Name nicht in herausragender Weise vorkommt. Warum ist das so?
Grund dafür ist jedenfalls nicht, dass er leichte, gefällige Kost servierte. Seine Texte zu lesen, ist keinesfalls ein literarischer Genuss, was nicht nur daran liegt, dass sein Sprachduktus einer anderen Zeit angehört. Als sperrig galten seine Texte schon seinen Zeitgenossen. Seine häufig verschachtelten, nie enden wollenden Sätze sind aber die Folge seines strengen, begrifflich präzisen Denkens und Argumentierens, des Unterscheidens und Differenzierens. Eingeführte Begriffe werden weiter unterteilt, Einschränkungen in Klammern gesetzt und zuweilen verliert man schon bei geringer Abnahme der Konzentration den roten Faden und muss manche Sätze mehrfach lesen. Aber dennoch ist Kants Sprache nicht die trockene Sprache vieler anderer Philosophen, wo die Paragrafenform nicht nur Einteilung des Stoffes, sondern der sprachliche Sendbote eines grausigen Juristen- und Bürokratendeutsches ist. Von vielen seiner Zunftgenossen unterscheidet sich Kants Sprache nicht nur durch die Präzision, sondern auch dadurch, dass sie den Gedankenstoff „erzählend“ vermittelt und er dort seine feinen ironischen Anmerkungen einstreut. Letztlich ist es der ungeheure Gedankenreichtum, der Kants Werke zu einer besonders schweren Kost macht. Hat man den erfasst, wird daraus ein Gastmahl, dass Appetit auf mehr macht.
Mit Blick auf das Gesamtwerk fällt ein Wandel seines Sprachstils auf. In seinen frühen naturphilosophischen Arbeiten dominieren eine gewisse Schwere und Behäbigkeit seiner Sprache, die das Lesen extrem mühsam gestalten. Einen deutlichen Wandel erfährt sein Stil in den sechziger Jahren, markant in den auch thematisch ganz aus dem Rahmen fallenden Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen von 1764. Diese geistreichen, aber teilweise auch kuriosen und problematischen Betrachtungen über Völker und Nationen finden sich stilistisch zwar in der Kritik der reinen Vernunft weniger wieder, aber in den zahlreichen kleineren Aufsätzen und Abhandlungen, insbesondere in den von ihm bevorzugten Berlinischen Monatsheften, werden sie später stilbildend sein Markenzeichen.
Kants Ruhm gründet sich nicht auf einem „Geniestreich“ seiner Jugend. Er hatte nicht früh sein intellektuelles Pulver verschossen, im Gegenteil war er in seinem Werdegang, jedenfalls im Nachhinein, eher ein Spätzünder. Denn alles, was ihm die Unsterblichkeit und ewigen Ruhm eingebracht hat, entstand erst, als er schon 57 Jahre alt war. Hätte er die Welt in einem Alter wie viele seiner berühmten Zeitgenossen, wie z.B. Lessing und Schiller, verlassen, wäre von Kant nicht mehr als eine Fußnote in der Philosophiegeschichte übriggeblieben. Er wäre als ein wichtiger Autor in die Galerie bedeutender Exponenten der deutschen Aufklärung eingereiht, aber nicht als der Höhepunkt und der Abschluss oder gar Vollender der Aufklärung auf einen einsamen Sockel gehoben worden.
Mit der Kritik der reinen Vernunft wird Kant zu einem unbestrittenen Bezugspunkt der Philosophie. Nicht sofort, aber dann umso nachhaltiger. Das Mammutwerk von ca. achthundert Seiten wurde zu einem Paukenschlag und fand dann mit der überarbeiteten zweiten Auflage 1787 eine Resonanz ohnegleichen. „Bis zu Kants Tod behandelten rund siebenhundert Autoren in über zweitausend Büchern und Aufsätzen die neue Philosophie“. (Martus, 837) Nach der Vollendung dieses Meisterwerkes, an dem sich nun Generationen die Zähne ausbeißen werden, meldete er sich nach zehn Jahren publizistischer Abstinenz in der „räsonierenden Öffentlichkeit“ mit einer Produktivität zurück, die ihresgleichen sucht.
Die Kritik der reinen Vernunft ist nicht nur ein umfangreiches und gedankenreiches, es ist auch eines der schwierigsten Werke der Philosophiegeschichte. Ich persönlich halte es für das Schwierigste überhaupt. Unbestritten ist es eines der bedeutendsten Werke. Dem Autor selbst war das bei aller Bescheidenheit klar, als er darin die „Kopernikanische Wende“ der Philosophie verkündete. Der Erkenntnis, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ ist die kritische Prüfung und Selbstbefragung der menschlichen Vernunfterkenntnis vorgeschaltet und dem Siegeszug der Naturwissenschaft folgt die selbstkritische Frage, wie ist Wissenschaft (und Erkenntnis überhaupt) möglich. Kant vollzieht damit die Wende der Philosophie von den Erkenntnisobjekten hin zu den Erkenntnissubjekten und deren Bedingungen und Leistungsfähigkeiten. Der naiven Vorstellung von der Erkennbarkeit der Welt, wie sie ist, folgt nun die Ernüchterung, dass wir die Welt nur so erkennen, wie sie uns mit unserem Erkenntnisapparat erscheint.
Mit Kant ist die Philosophie zunächst Erkenntnistheorie und die kritische Grundlegung der Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft. Über die Welt wissen wir nur so viel, wie wir über unser Erkenntnisvermögen wissen. Wie Fischer ihre Netze in den See oder das Meer werfen und dadurch nur das fischen, was in die Netze geht, so werfen wir unser Erkenntnisvermögen in die Welt und fangen nur das ein, was in dieses passt. Die Dinge an sich erkennen wir nie. Damit wird am Ende der Aufklärung von dem größten Philosophen der Aufklärung der Herrschaft der allmächtigen Vernunft eine selbstkritische Grenze ihres Leistungsvermögens gesetzt. Aber zugleich bleibt sie gerade deshalb das höchste und vornehmste Vermögen der Menschheit.
Entgegen dem ersten Eindruck war die Erkenntniskritik nicht das Ganze und auch nicht das höchste Ziel seines Philosophierens. Sie war die notwendige Vorarbeit für das eigentliche Hauptstück. Denn nachdem die Feststellung der Grenzen der reinen theoretischen Vernunft uns Auskunft darüber gibt, was wir wissen können, bleibt noch der „weitere Versuch übrig: ob nämlich auch reine Vernunft im praktischen Gebrauche anzutreffen sei“. (II, 676) Und damit finden sich die vielzitierten drei großen Fragen, um die es letztlich geht:
- Was kann ich wissen?
- Was soll ich tun?
- Was darf ich hoffen? (II. 677)
In der erst 1800 publizierten Logik, einem Handbuch zu seinen Vorlesungen, fügte er als vierte Frage hinzu: Was ist der Mensch? (III. 448) Die praktischen Folgen für das Handeln der Menschen und ihrem Zusammenleben waren für Kant jene Fragen, die das Herzstück seines Philosophierens überhaupt ausmachen und fortan seine ungebremste Produktivität bestimmen.
Produktivität in neuen Gefilden der Kritik
Die Kritik der reinen Vernunft ist in der Werkbiografie Kants die Scheidelinie, die den „vorkritischen“ von dem „eigentlichen Kant“ trennt. Nach der Kritik der reinen Vernunft von 1781 folgen in kurzen Abständen die beiden weiteren großen „Kritiken“, 1788 die Kritik der praktischen Vernunft und 1790 die Kritik der Urteilskraft. Ergänzend dazu die „populären“ Darstellungen: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können 1783 sowie Die Grundlegung der Metaphysik der Sitten 1785, die der Kritik der praktischen Vernunft als „populäre“ Darstellung vorausging.
Parallel entstehen die kleineren vielgelesenen und intensiv diskutierten Werke, die überwiegend in der renommierten Berlinischen Monatsschrift erschienen. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht; Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?; Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis alle 1784; Was heißt sich im Denken orientieren?1786; und die dann noch folgenden größeren Abhandlungen: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 1793; Zum ewigen Frieden 1795; Die Metaphysik der Sitten in zwey Theilen 1797; Der Streit der Fakultäten 1798. Abschließend seien noch die Vorlesungsscripten zur Logik sowie die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht und Über Pädagogik erwähnt.
Bekannt ist, dass er ein auch an Tagesfragen interessierter politischer Mensch war, obwohl der siebenjährige Krieg, der von 1756 bis 1763 immerhin in die Mitte seines Lebens fällt, bei ihm keine besondere Erwähnung findet. Er begrüßte die amerikanische Unabhängigkeit und ebenso die Französische Revolution, aber zu aktuellen politischen Fragen äußerte er sich öffentlich nicht. Dennoch verfolgte er mit großer Aufmerksamkeit die Ereignisse in Frankreich und selbst die von ihm verabscheute Enthauptung des Königs und die „Schreckensherrschaft“ des „Wohlfahrtsausschusses“ änderte nichts daran, dass er die Revolution selbst verteidigte, weil sie das zum Durchbruch und auf den Weg brachte, was ihm am wichtigsten war: die Freiheit und deren Sicherung durch die Herrschaft des Rechts und die Teilung der Gewalten. Deren theoretische Begründung liefert er in einem Werk mit dem ganz und gar nicht revolutionären Titel Metaphysik der Sitten. Außer seinem Traktat Zum ewigen Frieden findet sich in seinen Werken keines mit expliziter politischer Ausrichtung
Wie in seinem Denken, war Kant auch hier im Kopf ein anderer als in seinem Naturell. Heinrich Heine hat in seiner Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland 1835 als erster die Kritik der reinen Vernunft mit dem 14. Juli 1789 verglichen. Damit beginne in Deutschland „eine geistige Revolution, die mit der materiellen Revolution in Frankreich die sonderbarsten Analogien bietet“. Der gleiche Bruch mit der Vergangenheit auf beiden Seiten des Rheins, hier mit dem Königtum, dem Ende der alten Ordnung und dort stürzt der „Deismus, der Schlußstein des geistigen alten Regimes.“ (Heine, 473 f.) Kant entsprach dem durchaus. Erkannte der Kopf keine Autoritäten an, so war der ganze Mensch habituell alles andere als ein Revolutionär. Veränderungen, vor allem abrupte, liebte er ganz und gar nicht. Das belegt nicht nur seine Sesshaftigkeit. Er schätzt das Räsonieren wie der von ihm hoch geschätzte König, sein Landesvater Friedrich II., hält aber von öffentlichem Aufruhr wie dieser nichts, sondern folgt aufrichtig dessen Befehl: Räsonniert, aber gehorcht!
Kant geriet nur einmal in seinem Leben in ernsthaften Konflikt mit seiner Obrigkeit. Das war als der duldsame Friedrich II. 1786 die Erde verließ und sein stramm gläubiger, zur Mystik neigende Nachfolger auf dem Preußenthron Friedrich Wilhelm II. auch das Räsonnieren verbot. Da erhielt er eine königliche Mahnung zur Achtung der christlichen Religion, der Kant sogleich Folge leistete und versprach, sich zu diesen Themen nicht mehr öffentlich zu äußern.
Ansonsten war Kant im Geiste ein Weltbürger, der überzeugt war, mit der weltoffenen Hafen- und Handelsstadt Königsberg so viel Kontakt zur weiten Welt zu haben, dass er unmittelbare eigene Reiseerfahrungen zur Kenntnis über andere Völker und Nationen nicht benötige, um sich „weltmännisch“ in seinen Vorlesungen über „Physikalische Geographie“ sowie insbesondere in seinen Vorlesungen zur Anthropologie und kleineren Schriften zum Thema Rasse über die Eigenarten eben dieser Menschenteile qualifizierend äußern zu dürfen. Für diese Teile seiner Schriften bedarf es streckenweise einer besonderen Form von Humor, um ihnen Komik abzugewinnen. Zu seinen Lebzeiten – und weit darüber hinaus – tat das Kants enormen Ansehen in der Welt und daheim keinen Abbruch.
Um die Jahrhundertwende verlassen ihn zunehmend die Kräfte. Er stellt seine Lehrtätigkeit ein, verlässt im November 1801 endgültig die Universität und nur noch selten sein Haus. Besucher wurden rar. Seine Altersschwäche wird publik, er lebt zunehmend in Dämmerzuständen. Er erblindet, wird taub, nimmt keine Nahrung mehr auf und am 12. Februar 1804 um 11 Uhr wird er von den Übeln seines Körpers erlöst.
Sein letzter Wille für eine bescheidene Beerdigung stammte aus dem Jahre 1799. Eine widerspenstige Öffentlichkeit gehorchte seinem letzten Willen nicht. Sechzehn Tage lang wurde er aufgebahrt, die ganze Stadt nahm Abschied von einem „gewöhnlich Sterblichen“ im gesicherten Wissen einen „Unsterblichen“ eine Beerdigung zu bescheren, die keinem anderen wieder zu Teil wurde. Uund kein Geistlicher sprach. Seine letzte Ruhestätte oder seinen „ewigen Frieden“ fand er an der Nordseite des Doms, im „Professorengewölbe“.
Die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte
Die Tatsache, dass Kant in keinem Geschichtsbuch der Philosophie fehlt, heißt nicht, dass seinem Werk immer die gleiche Bedeutung und Aufmerksamkeit zu Teil wurde. Seine „Aktualität“ unterlag durchaus Konjunkturen und es war nicht immer der „ganze“ Kant, der auf erneutes Interesse stieß. Die erste Welle der Aneignung und Auseinandersetzung konzentrierte sich zwar nicht allein, aber doch vornehmlich auf die Erkenntnistheorie und somit auf den engeren Kreis der gelehrten Philosophen. Sie wird dominiert von dem Dreigestirn Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Schelling und als Abschluss Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die zugleich den Kreis bilden, den die Philosophiegeschichte den „deutschen Idealismus“ taufte.
Vor allem Hegel entwickelte sich früh zum Antipoden zu Kant. Er startete den Frontalangriff auf Kants System, indem er dem Primat der Erkenntnistheorie seine Phänomenologie des Geistes und später seine Wissenschaft der Logik entgegensetzte. Wie vor ihm Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Schelling, der sich von der Vernunft als Leitprinzip der Wahrheit und Erkenntnis zugunsten der Kunst und der Mythologie als dem Weg zum Absoluten ganz verabschiedete, sah Hegel wie Fichte und Schelling die Hauptprobleme in Kants Trennung der Welt in eine der „Erscheinungen“, die allein der Erkenntnis zugänglich sind, und einer Welt der „Dinge an sich“.
Hegel setzte dem die Fähigkeit der Erkenntnis des Absoluten entgegen. Das sei freilich ein Prozess der dialektisch erfolgenden Selbstentfaltung des Geistes in der Geschichte, die Widersprüche als Motor entdeckt und dadurch eine ganz andere Bedeutung erfahren als bei Kant. Die Welt Hegels trennt sich in Wesen und Erscheinung, aber die Erkenntnis des Wesens einer Sache sei Aufgabe und Ziel der Vernunft und möglich. Das Ganze als System ist am Ende das Wahre, zu dem man nicht dadurch gelange, dass man dem Denken eine „Trockenübung“ über die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens vorschalte. Da man doch dabei immer schon denke und erkenne, begibt sich Hegel gleich ins Wasser und beginnt zu schwimmen, d.h. mit der Analyse der Formen der Erkenntnis als einen dialektischen Entwicklungsprozess. Am Ende steht ein weiteres gigantisches umfassendes System und die Nachwelt wird streiten, welches das größere und der Wahrheit entsprechende ist. Hegels Problem ist dann, dass es nach ihm eigentlich nichts mehr zu sagen, geschweige denn zu erkennen gibt. Der „Weltgeist“ hat sich zwar auf den Begriff gebracht, aber das Denken geht weiter seine Wege und die Geschichte sagt frei nach Friedrich Schillers Fiesco: „Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen“.
Gegen die mit Hegel verbundenen Absolutheitsansprüche finden auf der einen Seite Widerspruch durch eine Relativierung (Schopenhauer) und einer Zurückweisung aller Ansprüche der Vernunft (Nietzsche), auf der anderen Seite erlebt Kant im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine Rehabilitierung durch die deutsche Universitätsphilosophie. Als Neukantianer, deren Häupter Hermann Cohen und Paul Natorp fast nur noch Fachgelehrten bekannt sind, bestimmen sie bis ins 20. Jahrhundert hinein das philosophische Denken in Deutschland mit einem Schwerpunkt auf die Erkenntnis- und nun verstärkt auch Wissenschaftstheorie sowie der Ethik.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Sir Karl R. Popper als der einflussreichste Vertreter der modernen Wissenschaftstheorie des „kritischen Rationalismus“ versuchen, Kant aus der „Gefangenschaft“ des deutschen Idealismus zu befreien und ihn als „letzten Vorkämpfer der Aufklärung“ zur Galionsfigur der Freiheit und eines Liberalismus gegen die Versuchungen des Nationalismus und Totalitarismus zu machen. Kant wird bei Popper zum Widerpart gegen Hegel und Marx.
Für die Gesamtwürdigung ist hier noch erwähnenswert, dass Kants Beiträge zur politischen Philosophie, auch sie werden später im Zusammenhang mit der Darstellung der Beiträge Kants zu diesem Themenfeld betrachtet, lange Zeit ein Schattendasein führten. Mit Ausnahme seines kontrovers rezipierten Traktats Zum ewigen Frieden fanden seine in die Politik wirkenden Betrachtungen lange Zeit keine nennenswerte Beachtung.
Das änderte sich seit den1970er Jahren. In den USA bezog sich der sozial-liberale Begründer eines normativen Liberalismus, John Rawls, in seiner Begründung einer Theorie der Gerechtigkeit explizit auf Kant. In Deutschland ist es vor allem Jürgen Habermas, der seine „Diskurstheorie“ politisch und normativ auf Kants Ethik und Theorie des Rechtsstaats stützt.
Nachlese: Kant ein „Rassist“?
Scharfe Kritik erfuhr der Humanist und Kosmopolit Kant in jüngster Zeit aus dem Lager der „Identitären“ und des „Postkolonialismus“. Deren Fundamentalkritik reicht zu dem Vorwurf des „Rassismus“ und „Kolonialismus“. Letzteres hatte Kant anlässlich der Freude über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung zwar schon abgelehnt und in seinem Traktat Zum ewigen Frieden wird Kolonialismus ausdrücklich verurteilt. Aber darum geht es der Kritik weniger. Schwerwiegender sind die von den postkolonialistischen Kritikern vorgelegten rassistischen Zitate und die treffen einen wunden Punkt.
Zitaten aus den Vorlesungen zur Physischen Geographie kann man formal entgegenhalten, dass dieser Text für die Publikation nicht von Kant autorisiert ist. Es handelt sich um eine zusammengestellte Vorlesungsnachschrift, die 1802 erschien, als Kant altersbedingt selbst nichts mehr publizierte. Von ihm publizierte, aus der Mitte seines Lebens stammende Aussagen, finden sich in den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabene aus dem Jahre 1764. Äußerungen über „die Negers in Afrika“, sie hätten „von der Natur her kein Gefühl, welches über das Läppische stiege“ sind nur ein Beispiel für andere Fehlleistungen. Ob der Verweis darauf, dieses entstamme seiner „vorkritischen Phase“, als Entlastung ausreicht, ist fraglich.
Nimmt man seine späteren beiden Beiträge aus der Mitte der achtziger Jahre über das Thema „Menschenrasse“ in der renommierten Berlinischen Monatsschrift hinzu, dann muss man feststellen, dass Kant hier ganz als Kind seiner Zeit von einer an der Hautfarbe festzumachenden Einteilung der Menschheit in verschiedene Rassen ausgeht. Allerderdings mit einem gemeinsamen Ursprung, weil sie sich untereinander fortpflanzen können. Ausgerechnet das wirft ihm Georg Forster1786 im Teutschen Merkur in seiner Kritik vor, die aber ihren eigentlichen Kern in einem prinzipiellen Punkt findet. Was dem damals 32-jährigen berühmten Reiseschriftsteller mit dem Ruf eines guten Ethnologen und aktiven Jakobiners besonders in Harnisch versetzte, war die Nonchalance mit der hier ein großer Geist sich über Dinge, wie andere Völker auslasse, von denen er – gelinde ausgedrückt – keine Ahnung durch eigene Anschauung habe. In Kants Kategorien ausgedrückt waren das Werturteile a priori.
Dass Forster diese unbestreitbar richtige Feststellung zugleich mit einem Generalangriff auf Kants gesamte Transzendentalphilosophie aus dem Geist des Empirismus verband, gab dem Ganzen den Anstrich eines philosophischen Streits, der sich daraus aber nicht ergab. So blieb es bei dem Vorwurf der empirischen Unkenntnis eines anerkannten Weltreisenden gegen einen allseits anerkannten Philosophen, der über ihm völlig unbekannte Menschengruppen und Völker, beruhend wohl auf recht einseitige Reiseliteratur, hier gänzlich unreflektiert eine „Weltläufigkeit“ zelebriert, die diesen Kosmopoliten des Kopfes als bornierten Provinzler zurechtstutzten. Auch wenn Königsberg eine weltoffene und nicht gerade unbedeutende Hafen- und Handelsstadt war, wo die Welt zu den Bürgern kam, reichte das nicht, um so weltumspannende „Völkerkunde“ mit Werturteilen vom Katheder ins Publikum zu senden, wie es Kant passieren ließ. Es waren schlimmstenfalls Erfahrungen aus zweiter Hand, die hier zu wissenschaftlich legitimierten Weisheiten erhoben wurden.
Kant, der Forster sehr schätzte, antwortete ihm im Teutschen Merkur 1786 mit der Schrift Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie. Ins Zentrum stellte er dabei aber allein die von Forster bestrittene These, dass die Menschheit auf einen Stammbaum zurückzuführen sei. Kant hatte diese Idee schon früh so sehr fasziniert, dass sie ihn 1775 zu seiner ersten Abhandlung Von den verschiedenen Rassen der Menschen trieb. Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil er damit seine intensive Arbeit an seiner Kritik der reinen Vernunft unterbrach.
Kants Ansehen und Ruf hat weder damals noch später unter Forsters Kritik gelitten. Die Frage ist, ob sich das nun ändern muss. Dass heute nicht mehr von Menschenrassen die Rede ist und dies auch wissenschaftlicher Standard ist, ergab sich konsensual erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern wäre es unfair, Kant daraus einen Vorwurf zu machen. Da Kant die Erkenntnisse aus den einzelnen Wissenschaften über die philosophischen Reflexionen stellte, denn die Philosophie fragt „nur“ nach den Bedingungen der Möglichkeit dieser Wissenschaften, darf man davon ausgehen, dass spätere Erkenntnisse über „Menschenrassen“ und die damit verbunden natürlichen Ungleichheiten von ihm akzeptiert worden wären.
Wo Kant Ansätze einer Rassenhierarchie erkennen lässt, gerät er in Widerspruch zu seinen universalistischen Moralprinzipien.
Der kategorische Imperativ wie die unteilbare „Würde“ des Menschen gilt explizit für alle „vernunftbegabten Wesen“, also für alle Menschen jenseits ihrer „Rasse“ oder „Nationalität“. Anders ließe sich das „Weltbürgerrecht“ auch gar nicht begründen. Genau darauf hat Marcus Willaschek in seiner Kant-Biografie, die den Rassismus-Vorwurf ausführlich behandelt, verwiesen. Kant habe in den 1790er Jahren, definitiv erkennbar in Zum ewigen Frieden, seine Einstellung zum Kolonialismus, von dem er sich zuvor nicht eindeutig distanziert hätte, geändert. Aber wie Omri Boehm jüngst dargelegt hat, messen seine postkolonialistischen Kritiker ihn nicht als Kind seiner Zeit an seinen eigenen Idealen und damit als „Verräter“ daran, sondern der Vorwurf, er sei eigentlich ein Rassist, verwandelt sich dahin, die Aufklärung mitsamt ihrem Universalismus der Werte seien rassistische Ideologien von und für „privilegierte weiße Männer“.
Kant war und ist kein Heiliger, er gehört auf keinen Sockel, der ihn der Kritik enthebt und berechtigter Kritik wäre er wohl kaum ausgewichen. Er lehrte nach seinem Selbstverständnis das Philosophieren und keine Philosophie. Selber zu denken, das war der Beginn des Ausstiegs aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit. Er war ein Wegweisender, aber er verkündete keine Dogmen oder gab Ziele vor, die der kritischen Überprüfung unterliegen. Sein moralischer Universalismus, der ihn gegenwärtig in den globalen Debatten über Identitäten und das Partikulare gegen die universelle Gültigkeit von Normen, Werten und Rechten zu einen hilfreichen Argumentationslieferanten macht, ist ein Teil seiner moralischen Autorität, trotz alledem.
Sein Hauptbetätigungsfeld war die Kritik. Kritik, im Sinne von „scheiden“ und beurteilen“ und Vernunft waren seine Hauptbegriffe. Seine Kritik der Vernunft lehrt uns über unsere Gegenwart hinaus, dass die Kritik stets nur das Werk der Vernunft selbst sein kann. Was, außer der Vernunft selbst, sollte in der Lage sein, sie zu überprüfen und zu kritisieren? Sie wird Angeklagte und ist Richterin zugleich. Gewaltenteilung gibt es hier nicht. Alle Versuche, die Vernunft von außerhalb anzugreifen und vor einen externen Richterstuhl zu zitieren, bedienen sich eines Mittels, das nichts Gutes verheißt. Die Vernunft ist nicht das jüngste, wohl aber das höchste Gericht.
Um die Vernunft zur Entfaltung zu bringen. bedarf es einer freien Gesellschaft mit freier Kommunikation. Das war und ist das Projekt der Aufklärung, das keiner präziser als Kant formulierte: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ (VI, 53)
Zit. Literatur:
Omri Boehm; Radikaler Universalismus. Jenseits der Identität. Berlin 2022
Omri Boehm; Sie wollen ihn stürzen sehen, in: Die Zeit v. 26. November 2020
Fichte, Johann Gottlieb; Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre. (1797), in: ders. Fichtes Werke I. Band, Hg. Immanuel Hermann Fichte. Berlin 1971, S.417 – 449
Jürgen Habermas; Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt a.M. 1992
Jürgen Habermas; Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt a.M. 1991
Heine, Heinrich; Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. In ders. Sämtliche Werke Bd. III., Düsseldorf – Zürich 2006, 4. Aufl. (1992, S. 395 – 520
Popper, Karl R.; Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. II. Falsche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen. Bern 1958
John Rawls; A Theory of Justice 1971, dt. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M. 1975
Russell, Bertrand; Philosophie des Abendlandes. Ihr Zusammenhang mit der politischen und der sozialen Entwicklung. Wien 1975 (1950)
Karl Vorländer; Immanuel Kant. Der Mann und das Werk. I. u. II., Hamburg 1992 (1924)
Marcus Willaschek; Kant. Die Revolution des Denkens. München 2023
Schriften von Kant:
Kant, Immanuel: Kant Werke. Hg. Wilhelm Weischedel, Bde. I. bis VI. Frankfurt a.M. 1964, römische Ziffern ist die Bandangabe, arabische Ziffern die Seitenzahlen. Die gleiche Seitenangabe findet sich jeweils in zwei Halbbände unterteilt in der 12 Bände umfassenden Ausgabe im Suhrkamp Verlag in der „stw“ Reihe, nach der hier zitierten Ausgabe gilt dann Band I. = 1. und 2, Band II. = 3. und 4. etc.
Gedanken über die wahre Schätzung der lebendigen Kräfte (1746 / 1749), I. 7 – 218
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755), I. 219 – 400
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764), I. 821 – 884
Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), I. 919 – 990
Kritik der reinen Vernunft (1781 / 1787), II. 9 – 712
Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783), III. 109 – 264
Was heißt sich im Denken orientieren? (1786), III. 265 – 284
Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie (1796), III. 403 – 416
Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen (1800), III. 417 – 582
Grundlegung der Metaphysik der Sitten (1785), IV. 7 – 102
Kritik der praktischen Vernunft (1788), IV. 103 – 302
Die Metaphysik der Sitten (1797), IV. 303 – 634
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), IV. 645 – 879
Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie (1788). V. 139 – 170
Kritik der Urteilskraft (1790), V. 235 – 620
Von den verschiedenen Rassen der Menschen (1775), VI.; 7 – 30
Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), VI. 31 – 50
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784), VI. 51 – 62
Bestimmung des Begriffs einer Menschenrasse (1785), VI. 63 – 82
Mutmaßlicher Anfang des Menschengeschichte (1786), VI. 83 -102
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793), VI. 125-172
Zum ewigen Frieden (1795/6), VI. 191 – 252
Streit der Fakultäten (1798), VI. 261 – 394
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht /1798 /1800), VI. 395 – 690
Über Pädagogik (1803), VI. 691 – 761
Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, VI. 779 – 806