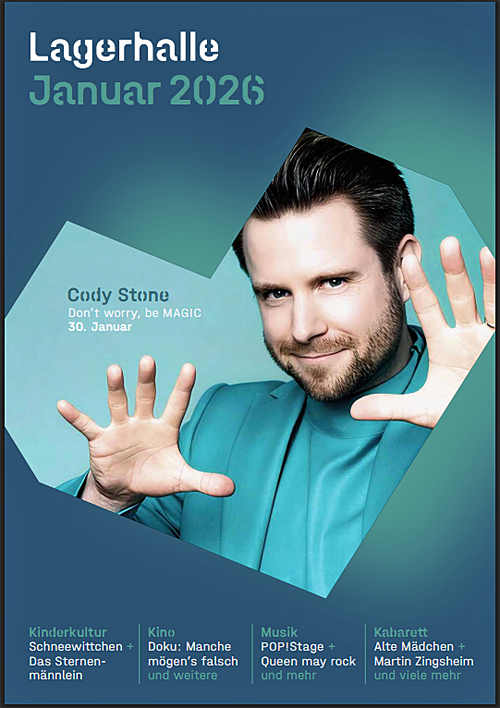Anmerkungen zum „Ende“ des Ukrainekrieges
Nach mittlerweile drei Jahren Krieg Russlands gegen die Ukraine ist der Ruf nach einem Waffenstillstand, sogar nach Friedensverhandlungen kein Unwort mehr. Jahrelang galt einesolche Forderung entweder als unrealistisch oder als Dolchstoß in den Rücken der Ukraine. Aber da hatten noch jene westlichen Militärexperten die Deutungshoheit, die einemmöglichen militärische Sieg der Ukraine in Aussicht stellten. Vorausgesetzt der Westen würde „liefern“, vor allem die „richtigen Waffen“. Heute ist Ernüchterung eingekehrt.
Keines der von der Ukraine und ihren Unterstützern geforderten und gelieferten oder auch nicht gelieferten Waffensysteme hätte – früher oder später – den Kriegsverlauf entscheidend geändert. Der Ruf nach Frieden verliert den Beigeschmack des Defaitismus. Zum einen, weil US-Präsident Trump mit seinem Amtsantritt einen sofortigen „Deal“ zur Beendigung des Krieges mit Putin in Aussicht stellte. Zum andern, weil der ukrainische Präsident Selenskyj sich dieser Forderung anschloss, wenn auch mit der Bevorzugung eines sofortigen Waffenstillstandes.
Selenskyj muss nicht nur den drohenden Entzug der entscheidenden amerikanischen Militärhilfe zur Kenntnis nehmen, sondern auch die zunehmende Schwächung seiner Manpower und eine offensichtlich dramatisch wachsende Kriegsmüdigkeit der leidgeplagten Bevölkerung. Putins Drohnen-Terror gegen zivile und relevante infrastrukturelle Einrichtungen und sein Zermürbungskrieg gegen die Zivilbevölkerung zeigen ihre Wirkung. Laut einer Gallup-Umfrage im Frühjahr wünschen sich fast 70 Prozent der Ukrainer ein sofortiges Kriegsende durch Verhandlungen. Dagegen erscheinen die Durchhalteparolen beispielsweise der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas mit erwartbaren militärischen Erfolgen der Ukraine wie eine Mischung aus Realitätsverweigerung und Zynismus. Sie ist ein Lehrbeispiel dafür, dass Hass und Feindschaft auch blind machen kann.
Ukrainische Hoffnungen, die USA würden als ihr militärischer Helfer und politischer Anwalt Putin letztlich in die Schranken weisen, erfüllen sich ganz und gar nicht. Noch vor ein paar Wochen drohte der US-Präsident, gewohnt großmaulig, Putin mit „schweren Konsequenzen“, sollte er einer „bedingungslosen Waffenruhe“ nicht zustimmen. Die Konsequenz war dann die Einladung Putins nach Alaska und die Liquidierung der Idee der Waffenruhe als untaugliches Element eines Friedensschlusses. Anders als Joe Biden ist Donald Trump nicht mehr der militärische Unterstützer, nicht einmal mehr politischer Anwalt der Ukraine. Er entpuppt sich seit seinem Amtsantritt nicht einmal als Vermittler zwischen Putin und der Ukraine, er ist vielmehr „Putins Unterhändler“, wie DER SPIEGEL ihn korrekt nennt.
Die Gipfel von Alaska und Washington
Das war die Ausganglage für die dann folgende „Gipfeldiplomatie“. Sie ging von Trump aus, weil Putin ihm so lange die kalte Schulter zeigte, bis der ihm nicht nur den prestigeträchtigen „roten Teppich“ zu seiner Rückkehr auf die Bühne der Weltpolitik in Alaska ausrollte. Flankierend hatte Trumps Entourage zuvor in Sachen Ukraine wesentliche Vorleistungen wie keine Nato-Mitgliedschaft sowie „Gebietsaustausch“ zugunsten Putins verkünden lassen. Die vor allem von Selenskyj geforderte und von den meisten EU-Staaten unterstützte sofortige Waffenruhe kassierte Trump dann beim Alaska-Gipfel auch noch.
Putin durfte mit seiner Rückkehr in die Weltpolitik durch Trump zufrieden sein. Von Beginn des Krieges an hatte er stets darauf bestanden, nur mit dem amerikanischen Präsidenten auf Augenhöhe zu verhandeln. Mit Biden hätte er die Europäer sehr wahrscheinlich nicht an den erwünschten Katzentisch gedrängt. Aber in Sachen EU liegen Putin und Trump nicht weit auseinander. Auch der anschließende Gipfel in Washington verlief diesbezüglich ganz im Sinne Putins. Wie Trump die hohe Garde der Vertreter Europas, durch den Briten Steimer wurde die EU erweitert, während seines Gipfels mit Selenskyj ins Wartezimmer verfrachtete, war sicherlich nach Putins Geschmack. Dass das Ausbleiben eines weiteren Eklats wie bei Selenskyjs ersten Besuch im Weißen Haus vor einem halben Jahr von Teilen der Politik und der Presse schon als Erfolg gefeiert wird, spricht Bände nicht nur für die internationale politische Kultur durch Trump, sondern auch für das transatlantische Verhältnis.
Aber solange die Europäer sich an die Schimäre einer transatlantischen Gemeinschaft und an das nicht mehr garantierte amerikanische Schutzschirmversprechen klammern, sind sie mehr oder weniger gezwungen, dem Wüterich im Weißen Haus mit hochpeinlichen Schmeicheleien zu umgarnen, die nicht nur im Falle des Nato-Generalsekretärs Rutte mit „Schleimer“ noch zurückhaltend bezeichnet werden. Was diese Abordnung, die sich auch noch geschichtsträchtig als „Koalition der Willigen“ bezeichnet, über sich ergehen ließ, grenzt an eine unerträgliche Zumutung. Zur Erinnerung: Die „Koalition der Willigen“ erfand G. W. Bush 2003 für seine Gefolgschaft für den völkerrechtswidrigen und auf Lügen gebauten Krieg gegen den Irak. Eine solche zweifelhafte wörtliche Anleihe in der Ukraine-Mission zu wählen, sagt viel über den politischen Zustand Europas aus.
Die Ergebnisse des Washingtoner Gipfels
Nun streiten die Politik und die Presse, ob diese nach außen eher als Demütigung der Europäer erscheinende Vorstellung in Washington nicht doch ein Erfolg war. Das gilt natürlich zuvörderst dann, wenn man angesichts der Unkalkulierbarkeit Trumps auch mit dem Schlimmsten (was immer das dann sei) rechnen musste. Das aktuell dringendste Anliegen, ein sofortiger Waffenstillstand, den Bundeskanzler Merz dann vortrug, wurde von Trump ohne Diskussion (was mit diesem Herrn wohl ohnehin völlig unmöglich ist) beiseite gewischt. Er beteuerte schon zuvor gegenüber Selenskyj seine plötzliche Abneigung gegenüber „Waffenstillständen“ mit dem kühnen Argument, er habe sechs Kriege ohne dieses Instrument beendet. Welche sechs Krieg er beendet haben will, die ihm unter Androhung von Zöllen gegen Norwegen den ersehnten Friedensnobelpreis einbringen sollen, weiß höchstens er selbst.
Da die Frage eines Waffenstillstandes nun auch gegenüber den europäischen Anwälten der Ukraine weggewischt wurde, verbleiben zwei weitere schwierige Probleme bei den nun unverzüglich von Trump in Aussicht gestellten Friedensverhandlungen zwischen Selenskyj und Putin. Während Trump dann hinzukommen soll, ist die Rolle Europas in diesem Prozess völlig unklar, obwohl die beiden Themen eines „Gebietstausches“ bzw. Gebietsabtretungen und das noch zentralere Thema der Sicherheitsgarantien Europa unmittelbar betreffen.
Zum Gebietstausch halten sich die Europäer zurück, da dies eine rein ukrainische Entscheidung ist. Sie bestehen aber prinzipiell darauf, dass völkerrechtlich in der europäischen Sicherheitsarchitektur gewaltsame Gebietsveränderungen unzulässig sind. Hier ist bislang unklar, was genau Putins Vorstellungen sind. Die Krimfrage wird wohl kaum neu aufgerollt, aber ob er über Donezk und Luhansk, Gebiete, die Russland gegenwärtig nur zum Teil kontrolliert, hinaus weitere Gebiete für sich reklamiert, ist nicht bekannt, aber zu befürchten. Ein formelles Problem ist, dass Russland einige Gebiete schon in seine Verfassung eingegliedert hat, die nach der ukrainischen Verfassung unveräußerlich sind. Völkerrechtlich gilt nach wie vor der Unabhängigkeitsvertrag der Ukraine von 1991.
Problematisch wird vor allem die Frage der Sicherheitsgarantien für einen eventuellen Friedensvertrag. Hier feiern die Europäer es als ihren großen Erfolg, Trump dazu bewegt zu haben, dass die USA sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen werden. Welcher Art und in welchem Umfang das geschehen soll, ist dagegen völlig unklar. Sicher ist nur, dass es amerikanische Truppen in der Ukraine nicht geben wird. Von Rutte ins Spiel gebrachte Analogien zum Artikel 5 des Nato-Vertrages ziehen nicht, weil dabei unterschlagen wird, dass es sich hierbei um keinen Beistandsautomatismus handelt, sondern dass jedes Land nach dem erfolgten Angriff für sich darüber entscheidet, wie es reagiert.
Was die USA für sich schon ausgeschlossen haben, also eine Truppenpräsenz in der Ukraine, wird nun in Europa befeuert mit der Bereitschaft europäischer Kontingente. CDU-Politiker wie Kiesewetter haben auch schon die Beteiligung deutscher Soldaten in die Debatte eingebracht. Aber das ist eine reine Geisterdebatte, wo noch nicht einmal geklärt ist, ob es überhaupt zu Friedensverhandlungen kommt. Außerdem hat Putins Außenminister Lawrow, keinesfalls überraschend, schon verlauten lassen, dass wir uns solche Debatten ersparen können, denn Soldaten aus Nato-Staaten werde Russland niemals akzeptieren.
Welche Chancen und Lehren gibt es?
Und hier liegt die Crux. Was die Europäer mit oder gegenüber Trump vielleicht als gemeinsame Position abgestimmt haben, ist nicht einmal ein Etappensieg. Zum einen weiß man bekanntlich nie, was Trump sich davon letztlich wirklich zu eigen macht und bislang werden alle Friedensvertragsrechnungen ohne den Wirt gemacht. Und der heißt Putin. Der nicht mehr existente Westen hat nichts in der Hand, was den Kremlherrn zwingen könnte, auf Forderungen der Ukraine, der Europäer oder Trumps einzugehen. Die militärische Lage vor Ort ist eindeutig. Die Ukrainer brauchen einen Waffenstillstand sofort und einen Frieden. Putin braucht weder das eine noch das andere. Nur die USA könnte bei einem Schwenk auf Konfrontation das Blatt zuungunsten Putins wenden. Aber dafür fehlt das Interesse. Für „America first“ ist die Ukraine zu unwichtig.
Trump hat die USA in die revisionistischen Mächte eingereiht, die die bestehende Weltordnung der Gleichberechtigung aller Staaten aus den Angeln heben wollen. Da ist er sich mit Russland und auch China einig. Da aber China als die größere Bedrohung der amerikanischen Weltmachtposition, vor allem ökonomisch, erscheint, sucht Trump nach gemeinsamen Geschäftsinteressen mit Russland, um die Allianz Putins mit China aufzuweichen. Als Exportländer von fossiler Energie haben sie ein gemeinsames Interesse, den ökologischen „Klimawandelwahn“ mit seinen negativen Folgen für die Energiewirtschaft auszubremsen. Und als Anrainer des (vom Eise befreiten) Nordpols mit seinen Mengen wichtiger Rohstoffe bieten sich da großartige Perspektiven für echte „deals“ zu beiderseitigem Nutzen.
Europa lebt zwar in der Rolle eines wesentlichen Finanziers des Ukraine-Krieges und wohl auch des Wiederaufbaus des Landes, spielt aber im Friedensprozess gerade einmal die Rolle eines Zaungastes. Europa erlebt gerade dramatisch seine politische Ohnmacht. Wenn die Europäer ihre Sicherheitsarchitektur und die damit verbundene Weltordnung verteidigen wollen – und darum ging und geht es im Ukrainekrieg letztlich auch oder vor allem -, dann müssen sie sich nach neuen globalen Verbündeten umschauen.
Sie müssen einem Trump Paroli bieten, statt ihm gegenüber das zu betreiben, was man mit der Vorliebe für problematische historische Parallelen auch als eine Appeasement-Politik gegenüber dem Autokraten Trump, der die Demokratie verachtet und beseitigen will, bezeichnen könnte. Europas Verbündete für eine Weltordnung auf der Basis gleicher Rechte für alle sind die USA nicht (mehr), sondern sie finden Unterstützer am ehesten unter den aufstrebenden und hilfsbedürftigen Ländern des „globalen Südens“.
Es ist ein schwieriger Lernprozess nach dem Ende der Kooperation mit Russland nun auch noch die andere und lange befreundete Weltmacht als Partner zu verlieren. Aber darauf zu hoffen, das könne sich doch schon bald alles wieder ändern, dürfte sich als eine gefährliche Illusion erweisen. Aber bis zu dieser Einsicht wird wahrscheinlich noch viel Grausames passieren müssen. Dazu gehört naheliegend die Ungewissheit, ob der der Ukrainekrieg wirklich dem Ende entgegengeht oder Putin ihn gar eskaliert.