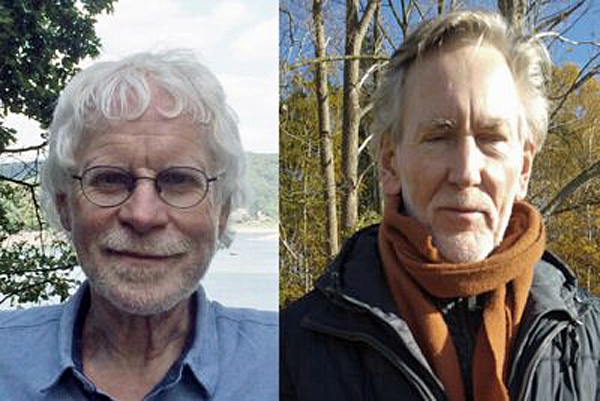Günther Grunert / Walter Tobergte
Die Allgegenwärtigkeit neoliberaler Mythen – Teil 2
Dies ist Teil 2 unserer Serie über weitverbreitete Mythen des Neoliberalismus, einer Kritik auf Basis der „Modern Monetary Theory“ (MMT), der unserer Ansicht nach weitreichendsten und überzeugendsten Kritik an der herrschenden neoliberalen Lehre. Heute geht es um die angebliche Schädlichkeit staatlicher Haushaltsdefizite und den daraus abgeleiteten Sparzwang.
Mythos Nr. 2:
„(…) wenn die Regierung Mittel aufnimmt, um das Budgetdefizit zu finanzieren, so reduziert sie damit das Angebot an Kreditmitteln, die den Haushalten und Unternehmen zur Finanzierung ihrer Investitionsvorhaben zur Verfügung stehen.“
Dieses Zitat stammt aus dem Lehrbuch „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre“ von N. G. Mankiw und M. P. Taylor (neueste deutsche Ausgabe 2018, S. 756). Das ist kein x-beliebiges, vielleicht gar nicht repräsentatives Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre (VWL). Vielmehr handelt es sich um das „mit Abstand wichtigste Lehrbuch im Bereich der Volkswirtschaftslehre allgemein“, wie E. Egerer und C. Rebhan (Universität Siegen) in einer Untersuchung der Frage, welche Lehrbücher im VWL-Studium am häufigsten verwendet werden, feststellen. Und dies nicht nur in Deutschland: „Im nationalen sowie internationalen Kontext wird das Lehrbuch im Bereich der allgemeinen VWL überall als der Marktführer angeführt“ (hier). Dieses Buch macht also einen Großteil der Studierenden mit den „Geheimnissen der Ökonomie“ vertraut.
Haushaltsdefizite in neoliberaler Sicht
Aber was bedeutet nun das oben angeführte Zitat konkret? Die dahintersteckende Logik und die weitreichenden Konsequenzen sind recht einfach zu verstehen: Ein staatliches Haushaltsdefizit (auch „Budgetdefizit“ genannt) bedeutet – so die Argumentation –, dass der Staat mehr ausgibt, als er an Steuern einnimmt, und zum Ausgleich dieser Differenz Kredite aufnimmt. Durch sein Budgetdefizit senkt er damit das Angebot an verleihbaren Geldmitteln, d.h. die gesamtwirtschaftliche Ersparnis. Der Zinssatz, der durch das Angebot an und die Nachfrage nach Geldmitteln bestimmt wird, steigt und so werden Unternehmen und private Haushalte verdrängt, die ansonsten Kreditmittel für private Investitionszwecke (neue Fabrikanlagen, neue Häuser etc.) aufgenommen hätten. Wenn der Staat also durch ein Haushaltsdefizit die Ersparnis reduziert, gehen mit einem steigenden Zinssatz die privaten Investitionen zurück. Da diese Investitionen von entscheidender Bedeutung für das langfristige Wachstum sind, vermindern staatliche Haushaltsdefizite damit die Wachstumsrate der Volkswirtschaft. Und das ist schlecht, denn Wachstum bedeutet Wohlstand und ist daher wünschenswert.
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Je mehr der Staat von den vorhandenen knappen Ersparnissen für sich beansprucht, desto weniger bleibt für die Privatinvestoren übrig. Folglich besteht die beste Fiskalpolitik darin, die staatlichen Ausgaben mittels einer strikten Sparpolitik möglichst stark zu begrenzen, um damit vor allem den privaten Unternehmen höhere Investitionen zu niedrigeren Finanzierungskosten zu ermöglichen. Ein ausgeglichener Staatshaushalt (die „schwarze Null“) wird in dieser Logik zum Ausweis einer soliden und nachhaltigen Finanzpolitik.
Die Rolle der Banken
Um besser zu verstehen, warum die Behauptung, dass die Kreditaufnahme des Staates das gesamtwirtschaftliche Sparen verringere und damit private Investitionen verdränge, nicht haltbar ist, erscheint es hilfreich, noch einmal auf den ersten Teil dieser Serie über neoliberale Mythen zurückzukommen.
Dort haben wir gezeigt, dass Banken keine Geldvermittler zwischen Sparern und Investoren sind, die bestehende Bankeinlagen an Darlehensnehmer ausleihen. Vielmehr schafft eine Bank bei der Kreditvergabe Geld „aus dem Nichts“, indem sie auf der Aktivseite ihrer Bilanz ein Darlehen einbucht und auf der Passivseite auf dem Girokonto des Darlehensnehmers eine betragsmäßig gleich hohe Gutschrift. Mit anderen Worten: Es kommt durch die Kreditvergabe der Bank zu Geldschöpfung.
Vor nicht allzu langer Zeit war dies noch eine absolute Außenseiterposition und wir erhielten eine Vielzahl wenig schmeichelhafter Mails, als zum Beispiel einer von uns im Jahr 2013 (Grunert 2013) und vor allem 2015 (zusammen mit Paul Steinhardt, Steinhardt/Grunert 2015a und 2015b) diesen theoretischen Ansatz darstellte. Von „ökonomischem Schwachsinn“, „Voodoo-Ökonomie“, „Spinnereien“ und Ähnlichem war da die Rede. Dies begann sich erst zu ändern, als nach der „Bank of England“, der britischen Zentralbank, auch die Deutsche Bundesbank in einer „aufsehenerregende(n) Bundesbank-Publikation“ – so Norbert Häring, Wirtschaftsjournalist beim „Handelsblatt“ – ganz offiziell auf diese Minderheitenlinie umschwenkte (siehe ihren Monatsbericht vom April 2017). Die Bundesbank schreibt dort vollkommen richtig:
„Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, verbucht sie die damit verbundene Gutschrift für den Kunden als dessen Sichteinlage und somit als eine Verbindlichkeit auf der Passivseite ihrer Bilanz. Dies widerlegt einen weitverbreiteten Irrtum, wonach die Bank im Augenblick der Kreditvergabe nur als Intermediär auftritt, also Kredite lediglich mit Mitteln vergeben kann, die sie zuvor als Einlage von anderen Kunden erhalten hat“ (S. 19f).
Noch deutlicher wird die Deutsche Bundesbank in ihrer Publikation Häufig gestellte Fragen zum Thema Geldschöpfung:
„Tatsächlich wird bei der Kreditvergabe durch eine Bank stets zusätzliches Buchgeld geschaffen. Die weitverbreitete Vorstellung, dass eine Bank ‚auch altes, schon früher geschöpftes Buchgeld, z.B. Spareinlagen, weiterreichen‘ (könne), […] trifft nicht zu.“
Ein vorsichtiger Umdenkungsprozess
Die Mehrheit der deutschen Medien reagierte auf den Monatsbericht der Bundesbank zunächst mit Unverständnis und Fassungslosigkeit: „Darum rüttelt die Bundesbank jetzt an unserem Geldsystem“ titelte etwa die Welt und schreckte nicht davor zurück, die von ihr ansonsten hochgeschätzte, konservative Deutsche Bundesbank in die Nähe von Verschwörungstheoretikern zu rücken. Was natürlich allein deshalb unsinnig ist, weil die Aufklärung über die Funktionsweise unseres Geldsystems nicht bedeutet, an diesem System zu rütteln.
Immerhin aber scheint mit der genannten Bundesbank-Publikation ein vorsichtiger Umdenkungsprozess eingeleitet worden zu sein, so dass die hier vertretene Kreditschöpfungstheorie zwar immer noch eine Minderheiten-, aber nicht mehr eine krasse Außenseiterposition einnimmt.
Hilfreich war hier sicherlich auch eine empirische Untersuchung von Richard Werner, Professor für Bankwesen in Southampton, der erstmalig exakt und detailliert prüfte und dokumentierte, was in einer Bank und ihren Büchern geschieht, wenn ein Kredit vergeben wird. Das Ergebnis des empirischen Tests steht im Einklang mit der Kreditschöpfungsthese: Die einzelnen Banken verleihen kein bereits existierendes Geld, sondern schaffen neues Geld „aus dem Nichts“.
Dennoch: Die herrschende neoliberale Lehre wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die neuen Einsichten und hält verbissen an ihrer Betrachtung der Banken als reine Geldvermittler fest. Warum eigentlich? Das wird schnell klar, wenn man genauer über den oben genannten Mythos Nr. 2 und dessen Voraussetzungen nachdenkt.
Die Mär vom Spartopf
Letztendlich wird hier nämlich unterstellt, dass es so etwas wie einen volkswirtschaftlichen „Spartopf“ gibt, der für Investitionen und Budgetdefizite verwendet wird, und dass die staatlichen und die privaten Kreditnehmer um dieses feste, begrenzte Sparmittel-Aufkommen konkurrieren. Tatsächlich aber ist die Annahme, dass der Staat den Unternehmen und Haushalten mit Budgetdefiziten das Geld wegnimmt, grandioser Unsinn.
Denn der Verkauf von Staatsanleihen an die Banken (bei einer Verschuldung des Staates) verringert nicht im Mindesten die Fähigkeit der Banken, ihren Privatkunden Darlehen zu gewähren. Banken suchen nach kreditwürdigen Kunden und schaffen dann Kredite, die wiederum Bankeinlagen erzeugen. Wenn sie knapp an Zentralbankgeld sind, das sie für den Zahlungsausgleich untereinander benötigen, leihen sie sich dies auf dem Interbankenmarkt von anderen Banken oder von der Zentralbank, was immer möglich ist. Banken sind eben keine bloßen Geldvermittler zwischen Sparern und Schuldnern, die Geld wieder ausleihen, das sie vorher erhalten haben, und die keine Kredite mehr vergeben können, wenn ihnen das Geld ausgeht.
Es kann deshalb keine Rede davon sein, dass es zu einer Konkurrenz zwischen staatlichen und privaten Kreditnehmern um begrenzte ausleihbare Geldmittel kommt und dass für die Privatinvestoren umso weniger von diesen knappen Mitteln übrig bleibt, je mehr der Staat davon für sich beansprucht, um seine Haushaltsdefizite zu decken.
Anders gesagt: Sobald man zur Kenntnis nimmt, dass Geschäftsbanken in der Lage sind, zusätzliche private Investitionen durch neu geschaffenes Giralgeld, d.h. durch Kredite „aus dem Nichts“, zu finanzieren, ist es offenkundig unsinnig anzunehmen, dass ein staatliches Budgetdefizit private Investitionen verdrängt, weil es das zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehende Angebot an Kreditmitteln vermindert. Es gibt diesen Verdrängungseffekt nicht, weil Finanzmittel keine begrenzte Ressource sind beziehungsweise nicht auf Ersparnis basieren.
Damit aber bricht die gesamte neoliberale Argumentation von den schädlichen Budgetdefiziten, die letztendlich zu Wachstums- und Wohlstandseinbußen führen, in sich zusammen. Die Notwendigkeit einer rigiden Sparpolitik oder einer „schwarzen Null“ lässt sich dann nicht mehr schlüssig begründen – jedenfalls nicht auf die beschriebene Weise.
Wer bestimmt die Zinssätze?
Aber was ist eigentlich mit den (langfristigen) Zinssätzen? Steigen die nicht trotzdem, wenn der Staat zu viele Mittel zur Deckung seines Haushaltsdefizits aufnimmt, und entmutigen so private Nachfrager nach Kreditmitteln? Steigen die Zinsen dann nicht allein – bei schwindendem Vertrauen – aufgrund von Risikoerwägungen der Banken bzw. des Kapitalmarktes? Nach neoliberaler Auffassung sind die Zinsen – wie oben bereits angedeutet – ein reines Marktergebnis: Auf dem Markt für ausleihbare Mittel legen danach Sparer ihre Ersparnisse an und Schuldner wenden sich dorthin, um Kredite zu erlangen. Durch Angebot und Nachfrage für Kreditmittel werde der Zinssatz bestimmt: „Der Zinssatz passt sich an, um das Angebot an und die Nachfrage nach Kreditmitteln in einer Volkswirtschaft in Übereinstimmung zu bringen“ (Mankiw/Taylor 2018, S. 751).
Das ist eine Fiktion: In der realen Welt setzt die Zentralbank mit dem sogenannten Leitzins das kurzfristige Zinsniveau und bestimmt den langfristigen Zins entscheidend mit. Selbst wenn die Zentralbank nicht an den Anleihemärkten interveniert, folgt unter normalen Umständen der langfristige Zins weitestgehend dem von ihr festgesetzten kurzfristigen Zins.
Warum ist das so? Der enge Zusammenhang zwischen kurz- und langfristigen Zinsen ist Folge der Substitutionsmöglichkeiten, die zwischen beiden bestehen. Wächst zum Beispiel die Spanne zwischen lang- und kurzfristigen Zinssätzen, weil die kurzfristigen (aber nicht die langfristigen) Zinsen fallen, so werden viele Anleger kurzfristige Mittel zu längeren Fristen verlagern, weil dort nun im Vergleich höhere Zinsen zu erzielen sind. Umgekehrt finanzieren sich jetzt Kreditnehmer zunehmend kurzfristig. Geschäftsbanken können und werden zudem den Kauf langfristiger Staatsanleihen durch eine kurzfristige Kreditaufnahme bei „ihrer“ Zentralbank refinanzieren. All dies führt tendenziell zu sinkenden Zinsen am langen Ende; der Abstand zwischen lang- und kurzfristigen Zinssätzen schrumpft wieder. Auch empirisch lässt sich zeigen, dass der langfristige eng am kurzfristigen Zins hängt.
Sollte die Zentralbank dennoch der Ansicht sein, dass die langfristigen Zinsen zu hoch sind, kauft sie Staatsanleihen am Sekundärmarkt auf (dem Markt, auf dem bereits emittierte Anleihen gehandelt werden) und senkt auf diese Weise das Zinsniveau. Das Umgekehrte gilt, wenn sie die langfristigen Zinsen für zu niedrig hält: In diesem Fall verkauft sie Staatsanleihen.
Die maßgebliche Rolle, die der Zentralbank in der Bestimmung sowohl des kurzfristigen als auch des langfristigen Zinssatzes zukommt, muss von neoliberalen Theoretikern schlicht geleugnet werden. Denn in ihrer Sicht wird ja der (langfristige) Zins aus Angebot und Nachfrage für Kreditmittel auf dem Finanzmarkt (dem Markt für ausleihbare Mittel) gebildet, also gänzlich außerhalb des Einflussbereiches der Notenbanken. Das ist ein abstruses Konstrukt, das in keiner Weise erklären kann, warum den Zinsentscheidungen der Notenbanken ein solch großes öffentliches Interesse im Wirtschaftsgeschehen zukommt.
Die Empirie spricht eine andere Sprache
Auch die Empirie widerspricht dieser neoliberalen Sichtweise vollständig. Das vielleicht eindrucksvollste Beispiel ist Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach BIP. Japan weist eine sich inzwischen über drei Jahrzehnte erstreckende Phase einer kontinuierlich und rasant wachsenden Staatsschuldenquote (Staatsverschuldung in Relation zum BIP) auf.
Die Staatsschuldenquote Japans betrug im Jahr 1991 nur 62,2 Prozent und stieg in der Folgezeit auf zuletzt (2020) 256,2 Prozent. Anhaltende, teilweise sehr hohe Budgetdefizite seit dem Jahr 1993 (in mehreren Jahren über 8 Prozent des BIP) ließen die Staatsschulden von Jahr zu Jahr anwachsen und Japan zum Land mit der aktuell dritthöchsten Staatsschuldenquote der Welt – nach Venezuela und dem Sudan – werden. (Zum Vergleich: Nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, in dem sich die Euroländer zu einer „soliden Haushaltsführung“ verpflichten, darf die Staatsschuldenquote 60 Prozent und das jährliche Haushaltsdefizit 3 Prozent des BIP nicht überschreiten.) Entsprechend müssten in Japan nach neoliberaler Vorstellung die langfristigen Zinsen durch die Decke gegangen sein. Prüfen lässt sich dies an der Entwicklung des Kapitalmarktzinses, also des Zinses für langfristige Kredite oder – enger gefasst – für langlaufende Wertpapiere.
Tatsächlich weist der Kapitalmarktzins (gemessen an der Rendite langfristiger staatlicher Schuldverschreibungen) in Japan seit 1993 einen klaren Abwärtstrend auf und seit dem Jahr 2007 ist ein fast durchgängig sinkender Kapitalmarktzinssatz zu beobachten. Betrug der japanische Kapitalmarktzins 1993 noch 4,35 Prozent, so lag er 2020 bei 0 Prozent. Japan ist damit aus neoliberaler Sicht ein Land, das es gar nicht geben kann.
Haushaltsdefizite stimulieren Wachstum und Ersparnisse
Wir können im Rahmen dieses kurzen Beitrages nicht auf alle Denkfehler eingehen, die in der Theorie der Verdrängung privater Investitionen durch staatliche Budgetdefizite stecken. Ein weiterer Punkt sei aber noch genannt. So gilt allgemein, dass die Ersparnisse eine Funktion des Einkommens sind. Wenn also das Einkommen als Folge einer fiskalischen Expansion oder auch von Unternehmensinvestitionen, zunehmenden Exporteinnahmen oder Konsumausgaben der privaten Haushalte wächst, dann wächst auch die Ersparnis. Ein steigendes Staatsdefizit erhöht also nicht nur das Volkseinkommen, sondern es steigen damit auch die privaten Ersparnisse.
Von einem festen, begrenzten Sparmittel-Aufkommen, von dem die Verdrängungsthese ausgeht und auf dem ihre gesamte Argumentation aufbaut, kann also keine Rede sein.
Fazit
Wie schon erwähnt, behaupten Mankiw/Taylor in ihrem Lehrbuch-Bestseller, dass ein staatliches Haushaltsdefizit über den daraus resultierenden Rückgang der Investitionen auch das Wachstum des BIP verringert. Sie schreiben weiter:
„Aus diesem Grund sind viele Staaten darum bemüht, ihre Kreditaufnahme zu begrenzen. Beispielhaft dafür stehen die europäischen Länder, die im Zuge der europäischen Schuldenkrise eine strikte Sparpolitik zur Ausgabenbegrenzung und Schuldenreduktion eingeführt haben“ (S. 759).
Die Bearbeiter der deutschen Auflage des Lehrbuchs, die Ökonomen M. Herrmann, C. Müller und D. Püplichhuysen, haben der deutschen Ausgabe bezeichnenderweise einen Abschnitt „Die schwarze Null“ (S. 758f) hinzugefügt, in dem sie feststellen, dass auch unter den Politikern weitgehende Einigkeit darüber bestehe, dass anhaltende Haushaltsdefizite „ein ernstes wirtschaftspolitisches Problem“ seien. Dissens gebe es nur in der Frage, auf welche Weise das Budgetdefizit am besten verringert werden könne.
Wir widersprechen entschieden: Weder halten wir die von der herrschenden Lehre behaupteten Auswirkungen staatlicher Budgetdefizite auf Zinssätze, private Investitionen und Wirtschaftswachstum für richtig, noch glauben wir, dass die daraus abgeleiteten Forderungen einer Reduzierung dieser Defizite und/oder des Anstrebens einer „schwarzen Null“ ein in irgendeiner Weise sinnvolles wirtschaftspolitisches Ziel darstellen.
Für diejenigen, die sich für mehr Einzelheiten und/oder zusätzliche Informationen interessieren, hier einige weiterführende Beiträge, die im Online-Magazin Makroskop erschienen sind:
Mythen über Budgetdefizite und Staatsverschuldung – 1