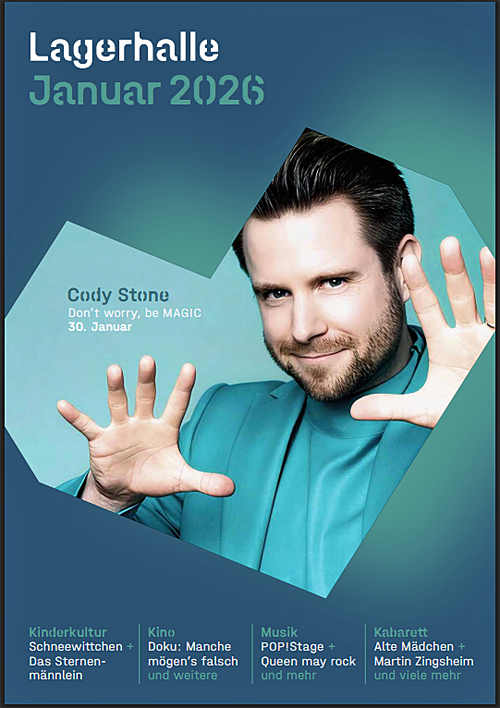80 Jahre nach dem Einsatz der Atombombe in Hiroshima und Nagasaki
Was vor achtzig Jahren am Morgen des 6. August 1945 in der japanischen Stadt Hiroshima passierte, ist so unbeschreiblich wie unbegreifbar. Die Menschen hatten gefrühstückt und waren auf dem Weg zu ihren Arbeitsstätten, als kurz nach 8 Uhr Fliegeralarm ertönte, der aber gleich wieder eingestellt wurde, da nur ein einziges Flugzeug am Himmel geortet wurde.
Der einsame Flieger trug eine Last von der man nur den Namen kannte: Atombombe. Sie explodierte wie geplant in ca. 540 Meter Höhe und löschte in einem Umkreis von anderthalb Kilometern des Hypozentrums sofort alles Leben aus. Um die 100.000 Menschen starben sofort in dieser unvorstellbaren Hitzewelle, deren Zentrum fünfmal heißer war als die Sonnenoberfläche. In den folgenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren starben noch einmal so viele Menschen qualvoll an den Folgen der todbringenden Strahlungen. Über 90 Prozent der Stadt wurden sofort zerstört, die Hitzewelle verhinderte den Transport von Toten und Verletzten.
Von anderen japanischen Städten kannte man seit 1943 Feuerbrände, die von der amerikanischen Luftwaffe gezielt zur Zerstörung der Infrastruktur entfacht wurden. Die enormen Verluste an Menschenleben wurden billigend in Kauf genommen. Tokio wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. März 1945 ein herausragendes Opfer des Einsatzes amerikanischer Brandbomben, die genau berechnet einen unkontrollierbaren Brand auslösten und weite Teile der Stadt innerhalb weniger Stunden zerstörten und über hunderttausend Menschen in den Tod rissen.
Diese schon unvorstellbare Wucht der Zerstörung, die in Deutschlands Erinnerung mit Hamburg und Dresden verbunden wird, erlebte in Hiroshima noch eine Steigerung. Wer die Bilder und Beschreibungen dieser Hölle auf Erden zur Kenntnis nahm, die der gerade öffentlich bekannt gewordenen Hölle der Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis ein weiteres Superlativ des Grauens hinzufügten, stellte sich die Frage, wozu das alles? Die Bombe war die „Krönung des sogenannten Manhattan-Projekte“. (Overy 2023, 584)
Seit drei Jahren arbeitete eine Heerschar von Wissenschaftlern mit Helfern streng geheim in der im Eilverfahren gegründete Retortenstadt Los Alamos in der abgeschiedenen Wildnis New Mexicos am Bau einer Atombombe. Die gesamte Elite der in den USA tätigen Atomphysiker entwickelte hier unter der Leitung Robert J. Oppenheimers in einem vermeintlichen Wettlauf der Zeit mit den Nazis den Bau einer Bombe, die absolute Macht und damit den Sieg im Weltkrieg versprach. Die große Befürchtung war, dass die deutsche Gruppe um Werner Heisenberg, in der das geballte Wissen der Atomphysik versammelt war, ebenfalls am Bau der Bombe arbeite. Dass die Amerikaner hier einem Irrtum aufsaßen, stellte sich erst später heraus. Die Führung der Nazis präferierte bei der Suche nach der Superwaffe nicht Nuklearwaffen, sondern die Raketentechnik.
Der Bau einer Atomwaffe verlangte nicht nur enormes Wissen, sondern verschlang auch ungeheure industrielle Ressourcen, die sich ökonomisch damals wohl nur die USA leisten konnten. Das Manhattan-Projekt entwickelte zwei Bombenmodelle. „Das eine basierte auf angereichertem Uran, das andere auf Plutonium, einem künstlichen Element, das aus dem Uranisotop U 239 entwickelt worden war. Hätte Deutschland nicht im Mai 1945 kapituliert, wäre die erste Atombombe womöglich auf Europa niedergegangen; so hatten es die Briten ursprünglich geplant. Die Vereinigten US-Stabschefs waren uneins bei der Frage, ob man die Waffe überhaupt einsetzen solle, aber am Ende wurde die Entscheidung politisch, nicht militärisch gefällt. Ende Juli waren genau zwei Bomben einsatzbereit, eine von jedem Modell, und Truman bereitete sich mit Churchills Zustimmung darauf vor, beide über japanischen Städten zu erproben, die als mögliche Ziele vom Flächenbombardement bislang bewusst ausgenommen waren.“ (Overy 2023, 585) Die erste Variante fiel auf Hiroshima, die zweite drei Tage später am 9. August auf Nagasaki.
Der politische Zweck war und ist umstritten
Was waren nun die politischen Gründe für Trumans Einsatzbefehl zum Abwurf von „Little Boy“, wie man dieses Vernichtungsinstrument zynischerweise taufte? Harry S. Truman wurde als Vize-Präsident der Nachfolger des am 12. April 1945 verstorbenen Franklin D. Roosevelt. Er begründete den Einsatz dieser Monsterwaffe nach dem Abwurf über Nagasaki mit der militärischen Notwendigkeit Japan zur „bedingungslosen Kapitulation“ zu zwingen und so weitere amerikanische Kriegsopfer zu minimieren. Richtig daran war, dass Japans Führung sich der amerikanischen Forderung nach einer „bedingungslosen Kapitulation“ nicht beugen wollte. Die USA dagegen drängten auf ein schnellstmögliches Ende der Kampfhandlungen.
Aus europäischer Perspektive stellt sich der zweite Weltkrieg anders da: Er beginnt mit Hitlers Überfall auf Polen am 1. September 1939 und endete mit der „bedingungslosen Kapitulation“ Nazi-Deutschlands am 8. Mai 1945. Aus einer globalen Perspektive, dies ist die Sichtweise des monumentalen Werkes des britischen Historikers Richard Overy (Overy 2023), beginnt der Zweite Weltkrieg mit der japanischen Besetzung der Mandschurei 1931 und endet zeitversetzt in China bis zum Nahen Osten im Jahrzehnt nach 1945.
Die Kapitulation der dritten „Achsenmacht“ Japan spielt aus der Sicht der USA eine ganz zentrale Rolle, denn für diese neue Weltmacht ist der pazifische Krieg genauso wichtig wie der atlantisch-europäische. Japans Weigerung die „bedingungslose Kapitulation“, die gegenüber Japan unklarer definiert war als gegenüber Nazi-Deutschland, zu akzeptieren, war ein Problem, das auch die Potsdamer Konferenz, deren Schwerpunkt eigentlich die Neuordnung Deutschlands und Europas war, am Rande beschäftigte. Die Sowjetunion stand noch in keinem Kriegszustand mit Japan. Stalin hatte lediglich zugesagt, sich an die Abmachung von Jalta zu halten, neunzig Tage nach Beendigung der Kampfhandlungen mit Deutschland auch in den Krieg mit Japan einzutreten. Diese Frist lief nun zwar ab, aber sie spielte beim Aufbau einer verschärften Drohkulisse der USA gegenüber Japan, die in die Zeit der Potsdamer Konferenz fiel, keine entscheidende Rolle.
Von den „Großen Drei“ der vorhergehenden Konferenzen war nur noch Stalin übriggeblieben. Truman ersetzte Roosevelt und Churchill wurde während der Konferenz nach seiner Wahlniederlage am 5. Juli von dem neuen Premierminister Clement Attlee von der siegreichen Labourpartei abgelöst. Truman sandte von Potsdam aus zwar Botschaften an Japan, aber sie waren kein integraler Beratungspunkt der Konferenz.
Da das amerikanische Nuklearprogramm zeitlich um diese Konferenz herum angelegt war (der erste erfolgreiche Atombombentest der USA in New Mexico erfolgte am 16. Juli, also einen Tag vor der Eröffnung der Potsdamer Konferenz und der Abwurf der ersten Atombombe erfolgte vier Tage nach dem Ende der Potsdamer Konferenz) entstand im Lichte des folgenden Kalten Kriegs der Verdacht, dass diese Demonstrationen amerikanischer Militärmacht sich (unnötigerweise) zwar gegen Japan richteten, politisch aber an den künftigen Rivalen Stalin adressiert waren. Da Japan militärisch längst „am Boden lag“, galten diese Einsätze militärisch als nicht nötig und nicht begründbar, also rein politische Machtdemonstrationen und die konnten sich nur an Stalin richten, der nicht mehr als Koalitionspartner behandelt wurde.
Dem steht entgegen, dass Japans Führung die Bedeutung des Einsatzes der neuen Waffentechnik in Hiroshima gar nicht zu Kenntnis nahm. Sie erschien hier lediglich als eine weitere Variante der schon vertrauten Brandbombeneinsätze der USA, die in 66 Städten zu ähnlichen Schäden führten. Die fortgesetzte Weigerung der japanischen Führung, die „bedingungslose Kapitulation“ zu akzeptieren, die dann am 22. September 1945 endlich erfolgte, spricht nicht dafür, dass es gar keinen Grund für den Einsatz gegeben habe. Ob hier allerdings die „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ gewahrt blieb und ob die Luftkriegführung insgesamt als Kriegsverbrechen wegen der Zivilopfer einzustufen ist, ist eine andere Frage.
Die Stärke der USA kann man daran ablesen, dass weder Hiroshima noch Nagasaki als Kriegsverbrechen behandelt wurden. Hätte das faschistische Deutschland oder die kommunistische Sowjetunion derartiges vollbracht, in unserem Geschichtsunterricht wären wir belehrt worden, dass nur Nazis oder Kommunisten, aber nicht Demokratien zum Einsatz solcher Massenvernichtungsmittel fähig seien. Da die Fakten nun aber anders sind, kann der Abschreckungseffekt damit gestärkt werden, dass die Bereitschaft zum Einsatz keine Eventualität sei, sondern faktisch schon demonstriert wurde und die Willensstärke der Demokratie bezeuge.
Das Leben mit der Bombe
Doch abseits solcher Rechtfertigungskünste ist die Welt seit diesen grausamen Ereignissen eine andere. Zugleich gilt es zu bedenken, dass die ganzen katastrophalen Spätfolgen dieser neuen Waffentechnik, die radioaktiven Strahlungen und ihre desaströsen Langzeitfolgen erst später ins Bewusstsein drangen. Und zu erinnern ist daran, dass trotz der bekannten Fakten vor allem aus dem Einsatz in Hiroshima noch in den sechziger Jahren in den Schulen gelehrt wurde, bei einem Atombombenangriff solle man sich auf den Boden werfen, die Augen zu halten und möglichst bleihaltiges Papier (am besten die BILD-Zeitung) schützend vor sich halten.
Nach dem Einsatz der Atomwaffen gab es sehr schnell eine Diskussion unter den Wissenschaftlern über die Gefahren ihrer Entdeckungen und Erfindungen. So sehr das Projekt angesichts der Sorge um diese Waffe in den Händen der Nazis, das zentrale Argument für Albert Einstein, dem Unternehmen zuzustimmen, noch Unterstützung fand, änderte sich das in den fünfziger Jahren. Plädoyers für eine rein friedliche Nutzung der Kernenergie verbanden sich mit Grundsatzfragen der ethischen Verantwortung der Wissenschaftler und der „verlorenen Unschuld“ der Wissenschaft schlechthin.
Fest stand, dass die Menschheit mit ihrer Intelligenz an einen Punkt gekommen war, wo sie sich in die Lage versetzt, sich mit ihren eigenen Erfindungen und Schöpfungen zu vernichten. (Jaspers 1958) Die Bombe ist in der Welt und mit diesem Wissen ist sie aus ihr nicht mehr zu vertreiben, sondern bestenfalls ist dieses Ungetüm zu bändigen.
Und damit wird die Atombombe zu einem Politikum erster Klasse. Die einfachste Lösung wäre ihre Ächtung und ein allgemeines Verbot ihrer Herstellung. Die Bedenken sind schnell parat: Wer soll das durchsetzen und kontrollieren? Die UNO? Wäre das nicht eine Überforderung, zudem lebt sie von der Zustimmung aller. Wäre der Monopolist USA oder weitere Atommächte überhaupt bereit auf diese Machtmittel im Interesse der Menschheit zu verzichten?
In den USA ist die Neigung dazu gering, die Sorge ist zunächst vielmehr, wie man das Monopol sichern kann und es sogar noch ausbaut. Die Furcht ist Geheimnisverrat vor allem an den neuen Hauptgegner im ausbrechenden Kalten Krieg. Spionageverdacht wird flächendeckend, McCarthy nimmt seine Arbeit auf, der Verdacht der „fellow traveller“ des Kommunismus ist allgegenwärtig. Er erreicht sogar den Schöpfer des Ungetüms. Robert J. Oppenheimer, dem nach dem Einsatz Skrupel überkommen, wird öffentlich demontiert und des Verrats bezichtigt.
Seine Schöpfung wird von anderen noch als steigerungsfähig angesehen. Edward Teller träumt von einer Wasserstoffbombe. Sie sei billiger und erreiche zudem die vielfache Spreng- und Vernichtungskraft der Hiroshima-Bombe, die dagegen wie ein Baby wirke. Im Wettlauf um die größtmögliche Vernichtungskraft ist die Wasserstoffbombe der absolute Favorit. Aber hier bewegen wir uns schon in einer anderen Welt, in den 1950er Jahren und da ist das Monopol der USA seit 1949 gebrochen, denn nun hat der weltpolitische Rivale Sowjetunion auch seine erste Bombe getestet.
Das US-Monopol ist zwar gebrochen, aber deshalb gibt es noch keinen Gleichstand. Anders als den USA fehlen den Sowjets vorerst die unabdingbaren Transportmittel, genauer ermangelt es an Langstreckenbombern. Vorerst befinden sich die beiden Atommächte in einem Zustand asymmetrischer Konfliktszenarien. Die USA können mit ihren Langstreckenbombern die Sowjetunion direkt bedrohen und zusätzlich indirekt von Europa aus. Die Sowjets können lediglich die Europäer im Westen direkt bedrohen und so als Geiseln nehmen, aber nicht die USA direkt. Amerikas Verbündete setzen als Kompensation für die angebliche konventionelle Überlegenheit der Sowjets allein auf die abschreckende Wirkung des amerikanischen Nuklearschirms. Diese Verlagerung des Verteidigungsschwerpunktes auf die Nuklearkapazitäten innerhalb der westlichen Allianz ist ein dem Bündnis inhärenter Konflikt der Sicherheitsinteressen. Denn die Amerikaner sind nicht an einem allzu schnellen Einsatz ihrer Nuklearpotenziale interessiert und halten es aus Gründen ein– und damit erst abschreckend – ist. Diesem Umstand verdankte Westdeutschland seine Wiederbewaffnung in den fünfziger Jahren und dann 1955 seine überraschende Mitgliedschaft in der Nato, woran die Franzosen mit ihrer Zurückweisung einer deutschen Mitgliedschaft in einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) maßgeblichen Anteil hatten.
Das Gleichgewicht des Schreckens
Mit der sich anbahnenden Struktur eines nuklearen Patts in der Mitte der fünfziger Jahre vollzieht sich dann in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre ein dramatischer Wandel. Die komfortable Sicherheitslage der USA, im Westen wie Osten die schützenden Ozeane und im Norden wie Süden Nachbarn ohne sicherheitsrelevantes Gefahrenpotenzial, geht ihrem Ende entgegen. Das Schicksalsjahr ist 1957, als die Sowjetunion ihre erste Interkontinentalrakete in den Weltraum sendet. Damit ist das Zeitalter der Unverwundbarkeit für die USA Vergangenheit, denn sowjetische Raketen können nun jeden Punkt in den USA direkt erreichen. Noch gibt es für diese neue Situation eine aufschiebende Hürde, denn die Sowjets müssen die nuklearen Sprengköpfe auf die Interkontinentalraketen setzen. Doch das ist nur eine Frage der Zeit.
In den USA läuten mit diesem „Sputnikschock“ („Sputnik“ war der Name der sowjetischen Rakete) die Alarmglocken. Erstmals demonstrieren die Sowjets eine technologische Überlegenheit, die sich in der Eroberung des Weltraums durch bemannte Weltraumflüge anschließend noch ausweitet. Die Kennedy-Administration macht eine Umkehrung dieses Verhältnisses zu ihrer zentralen Aufgabe. Es bleibt aber nicht bei einem „nur“ technologischen Wettlauf. Die Kuba-Krise im Oktober 1962 signalisiert ein strategisches Patt. Mit der möglichen Stationierung von nuklear bestückten Mittelstreckensystemen von Kuba aus neutralisiert die Sowjetunion den strategischen Eskalationsvorteil der USA mit ihren Mittelstreckensystemen, die von Westeuropa und der Türkei aus, das Territorium der UdSSR unterhalb der strategischen Bomberflotte und späterer Interkontinentalraketen in einem Konfliktfall direkt bedrohen könnten.
Die elegante Lösung der Kuba-Krise bestand darin, dass die Sowjets ihre Mittelstreckenraketen aus Kuba zurückholten, die USA die Unverletzlichkeit Kubas akzeptierten (was trotz des Scheiterns der Invasion in der Schweinebucht ein Jahr zuvor als ein Erfolg der Sowjets gewertet werden konnte) und zugleich unterhalb öffentlicher Bekanntgabe den Abbau der Mittelstreckensysteme in Westeuropa und der Türkei in Aussicht stellten. Damit war auf niedriger Stufe die strategische Symmetrie hergestellt. In der Öffentlichkeit erschien Kennedy zwar als der Sieger, aber die Sowjets feierten intern den Abzug der Mittelstreckensysteme der USA aus Europa als großen Erfolg, unwissend, dass deren Abzug längst beschlossen war. Sie sollten wegen ihrer Verwundbarkeit auf U-Boote verlagert werden.
Die Kuba-Krise, jene 13 Tage, die die Welt am Abgrund einer nuklearen Katastrophe brachte, war der Höhe- und Wendepunkt des atomaren Supermachtkonfliktes. Das gemeinsame Erlebnis eines Tanzes auf dem Vulkan schärfte das gemeinsame Interesse am Überleben. Die politischen Einflusssphären waren schon mit dem Berliner Mauerbau 1961 in Europa abgesteckt. Eine Veränderung des Status quo in Europa durch Gewalt war durch das nukleare Patt definitiv ausgeschlossen. Was für die BRD Adenauers hieß, dass eine Wiedervereinigung auf der Basis einer Überlegenheit des Westens (also der USA) nicht mehr realistisch war. Militärstrategische Vorteile jenseits der beiderseitig gesicherten Vernichtung nach dem Motto, „Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter!“ waren für beide Seiten außer Sicht. Man lebte in einer Welt der „mutual assured destruction“, dessen Abkürzung „mad“ diese absurde Situation auf den Begriff des „Verrückten“ brachte.
Das gemeinsame Interesse am Überleben schuf für heikle Situationen, v.a. gegen einen „Krieg aus Versehen“, das berühmte „rote Telefon“ und die Idee eines Nichtverbreitungsvertrages von Nuklearwaffen, auch „Atomwaffensperrvertrag“ genannt. Ein immer noch gültiges Abkommen mit den meisten Mitgliedsstaaten, das 1968 angestoßen wurde. Politisch gesellte sich zum militärischen Patt die Ära der Entspannung, die Nato definierte Sicherheit nicht mehr allein durch militärisches Gleichgewicht und Abschreckung, sondern ergänzte die militärische Seite um die politische Komponente der Entspannung, also die friedliche Beilegung von Konflikten. In diese Neudefinition von Sicherheit fügte sich die spätere Ost- und Entspannungspolitik unter Bundeskanzler Willy Brandt ein. In den siebziger Jahren folgten diverse Rüstungskontrollverhandlungen und Vereinbarungen zwischen den beiden nuklearen Supermächten. Sie bezogen sich aber ausschließlich auf die strategischen Waffen, also die interkontinentalen Reichweiten der Raketensysteme. Aufrüstungen unterhalb dieser Ebene blieben außen vor. Das erregte den Unwillen des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der auch auf dieser Ebene ein Gleichgewicht forderte. Das mündete bekanntlich in dem umstrittenen Nato-Doppelbeschluss von 1979 und den massenhaften Protesten in weiten Teilen der westdeutschen Bevölkerung dagegen.
Was bedeuten die Nuklearwaffen für die Politik?
Was ist nach den Erfahrungen der entsetzlichen Folgen des Einsatzes von Nuklearwaffen eigentlich ihre politische Bedeutung? Sie verleihen in Relation zu konventionellen Waffen eine ungeheure Macht, aber wozu ist sie brauchbar? Nuklearwaffen sind zuallererst Vernichtungswaffen, mit ihrer gigantischen Zerstörungskraft sind sie für klassische Eroberungen denkbar ungeeignet, weil sie das zerstören, was man gewinnen will. Unabdingbar und zwar auf Dauer werden durch die radioaktiven Strahlungen Räume unbenutzbar und unbewohnbar. Wie chemische oder biologische Waffen laufen sie Gefahr, den Absender genauso zu treffen wie den Adressaten und ergeben so keinen strategischen Sinn.
Sie sind selbst als Drohkulisse keine gesicherte Kraft, denn wer ließe sich von einer Atommacht wegen eines relativ minimalen Konfliktes mit dem Einsatz von A-Waffen einschüchtern? Vieles spricht dafür, dass A-Waffen vor allem der Abschreckung sowohl gegen konventionelle Angriffe als Ultima ratio im Falle einer drohenden Niederlage dienen als auch zu allererst als abschreckendes Gegengewicht gegen andere A-Waffen. Und in diesem Falle sind beide oder alle Parteien darauf angewiesen, dass alle auf die gleiche Rationalität setzen, denn Abschreckung läuft immer als ein Verhalten der anderen ab. Man könnte mit Henry Kissinger sagen, dass im Atomwaffenzeitalter selbst „Feindschaft kompliziert wird“. Bei allen Feindschaften zwischen den Supermächten vertrauten beide Seiten letztlich auf eine gemeinsame Rationalität und zumindest auf ein gemeinsames Interesse am Überleben.
Dennoch sind einige Mutmaßungen über die Folgen der Nuklearwaffen für den Verkehr der Staaten untereinander nicht in Erfüllung gegangen. Die Hoffnung, die drohende Katastrophe bringe den Krieg überhaupt wegen des zu befürchtenden Endes der Eskalationsspirale an sein Ende, erfüllte sich nicht. Auch unter dem drohenden Nuklearschirm der Supermächte entfalteten sich Konflikte zu Kriegen, Aber es gab auch eine deeskalierende Wirkung, denn wenn die Supermächte in einen regionalen Konflikt hineingezogen wurden oder sich aktiv einmischten und dann aufeinander zu treffen drohten, wurden solche Konflikte, die es für sich meistens nicht wert schienen, bis zum Äußersten zu gehen, eingefroren ohne gelöst zu werden.
Das gemeinsame Interesse am Überleben hat die beiden Atommächte aber auch nicht davon abgehalten, neben den Rüstungskontrollsystem auf beiden Seiten eine permanente nukleare Aufrüstung zu betreiben. Auf 12000 Sprengköpfe sind die Arsenale angewachsen. Das reicht, das Leben auf dem Planeten Erde mehrfach auszulöschen. Was Ökonomisten vor allem im Westen einem „militärisch-industriellen Komplex“ anhängen, unterschlägt die eigentliche Triebfeder dieser Rüstungswettläufe. Es geht nicht um mehr Sprengkraft oder um mehr Waffen an sich, es geht nicht um einen quantitativen, sondern um einen qualitativen Rüstungswettlauf. Es ist der Versuch, durch zielgenauere Lenksysteme die Vernichtungskraft der Sprengköpfe so zu senken, dass ein „begrenzter“ Nuklearkrieg ohne die verheerenden Kollateralschäden unterhalb eines großen Schlagabtausches durch Eskalationsvorteile gewinnbar erscheint und damit wieder zu einer politischen Waffe werden könnte. Der legendär gewordene US-Stratege Herman Kahn hat dafür schon Mitte der sechziger Jahre 44 Eskalationsstufen erarbeitet. (Kahn 1965)
Henry Kissinger hat in seinem frühen, wegweisenden Buch aus dem Jahre 1957 „Nuclear Weapons and Foreign Policy“ in der Begrenzung des Atomkrieges den Ausweg aus dem Dilemma gesehen, dass angesichts des unvermeidlichen Vernichtungspotenzials nicht nur der Krieg als Mittel der Politik entfalle, sondern militärische Macht nicht mehr in politische umzumünzen sei. Dass absolute militärische Macht zugleich in die politische Ohnmacht führe, könne nicht das letzte Wort sein. Militärische Macht kann erst dann wieder als Möglichkeit des Krieges und damit als Mittel der Politik in Erscheinung treten, wenn die Ultima ratio eines nuklearen Schlagabtausches durch die reelle Chance einer Begrenzung unterlaufen werden kann.
Der gesamte Rüstungswettlauf seit den siebziger Jahren entfällt auf qualitative Aufrüstungsmaßnahme und Waffenmodernisierungen, die sich durch geringere Sprengkraft bei höherer Zielgenauigkeit auszeichnen. Im Ideal verbindet sich damit die Möglichkeit eines entwaffnenden Erstschlages. Also das Ende und die Überwindung der beiderseitig gesicherten Vernichtung durch eine garantierte Zweitschlagskapazität. Hinzu kommt eine räumliche, geografische Differenzierung, die den Gewinn einer Eskalationsdominanz ergibt. Die Idee ist, dass die Konflikte auf Nuklearwaffen gestützt einer Eskalationsdynamik folgen, die einem Schachspiel ähneln, während die Abschreckung der Ungewissheit eines Pokerspiels folgt.
Nuklearwaffen nur ein Papiertiger?
Sind Nuklearwaffen nur Papiertiger, wie Mao Ze Dong in den fünfziger Jahren behauptete, als das kommunistische Konkurrenzunternehmen Sowjetunion die „friedliche Koexistenz“ mit dem amerikanischen Imperialismus mit Verweis auf die gemeinsame Verantwortung angesichts der Bedrohungen durch die vernichtende Kraft der Atomwaffen propagierte? China hat seine Episode als „Avantgarde der kommunistischen Weltbewegung“ weit hinter sich gelassen, hält sich aber als Atommacht zurück und setzt (noch) mehr auf Wirtschaftsmacht.
Das ist bei der Atomsupermacht Russland anders. Putin und vor allem sein Wadenbeißer Medwedew gefallen sich seit dem Ukrainekrieg mit Verweisen auf die russische Atommacht. Dass atomwaffenlose Europa flieht unter den amerikanischen Schutzschild, wohlwissend, dass es hier keine Garantien mehr gibt. Da man der russischen Atommacht nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hat, entsteht das Gefühl der Erpressbarkeit. Ohne die russische Atommacht zu bagatellisieren und ohne Putins Skrupellosigkeit zu unterschätzen, kommt man bei einer realistischen Einschätzung der politischen Brauchbarkeit des russischen Nuklearpotenzials zu der Erkenntnis, dass Russland dieses Potenzial für die Eroberung (etwa der Ukraine) aus den genannten Gründen nichts bringt. Gebiete radioaktiv zu verseuchen, die man nutzbringend erobern will, ergibt selbst für Irrationalisten keinen Sinn. Erpressung durch nukleare Drohung dürfte von ähnlich geringem Erfolg sein, mit der Einschränkung, dass sie in dosierter Form erfolgt, aber das ist dann eine rein militärische Variante. Wirksamer ist die Drohung, wenn Russland etwas „liefern“ soll oder konventionell in eine militärische Bedrängnis gerät und dann vor dem Nichts stehend alles riskiert. D.h. Russland ist militärisch nicht zu besiegen, um ihm politische Zugeständnisse abzupressen. Da würden übrigens dann auch europäische Nuklearwaffen nichts nützen. Ergo: Der politische Nutzen von Nuklearwaffen ist sehr ungewiss und hängt allein von dem Konfliktszenario ab.
Literaturverweise:
- Jaspers, Karl: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München 1958
- Kahn, Herman: Eskalation. Frankfurt – Berlin – Wien 1965
- Kissinger, Henry A.: Kernwaffen und Auswärtige Politik. München – Wien 1974 (Nuclear Weapons and Foreign Policy. New York 1957)
- Overy, Richard: Hiroshima. Berlin 2025
- Overy, Richard: Weltenbrand. Der große imperiale Krieg 1931-1945. Berlin 2023
- Paul, Michael: Atomare Abrüstung. Bonn 2012
- Zusätzlich sei an den Film „Oppenheimer“ von Christoph Nolan aus dem Jahre 2023 erinnert, der das „Manhattan-Projekt“ und das gesamte soziale und politische Umfeld sehr gut darstellt.