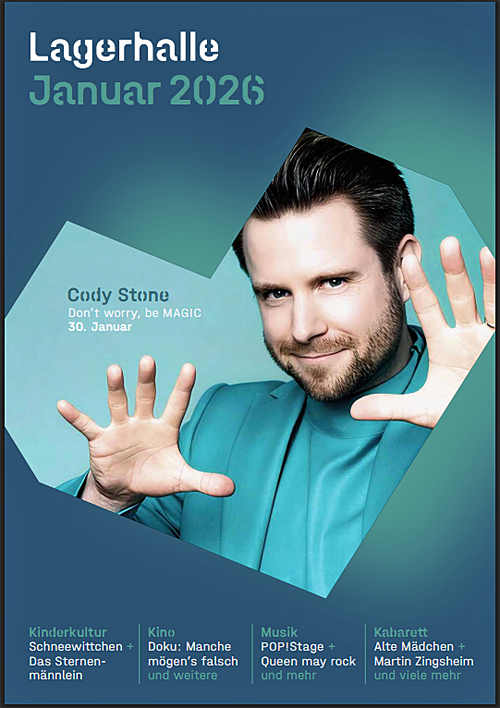Die Mitte als Mythos und Problem – Teil 4
(Teil 1 –Teil 2 – Teil 3)
Vom Ende der klassischen Industriegesellschaft zur postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft und die neuen Formen sozialer Ungleichheit.
Veränderungen in der Sozialstruktur einer Gesellschaft ergeben sich in der Regel aus Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur. Offensichtlich ist das, wenn man sich den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft vor Augen führt. Die dann in der Industriegesellschaft zu beobachtenden Umstrukturierungen beispielsweise durch das Aufkommen einer „Angestelltenschicht“ folgen ebenfalls ökonomischen Veränderungen. Die zunehmende „Verbürokratisierung“ in der Privatwirtschaft ist eine Folge des Größenwachstums der Organisationseinheiten einerseits und des Beschäftigungszuwachses in privater wie öffentlicher Form in infrastrukturellen Bereichen.
Um die gesamtgesellschaftlichen Umbrüche von ihrer ökonomischen Seite und ihren sozialen Folgen in ihrer Entwicklung nachvollziehbar zu machen, ist es hilfreich, sich zuerst mit einer ökonomischen Gesamtbetrachtung vertraut zu machen, die in der Volkswirtschaftslehre unter dem Namen des „Drei-Sektoren-Modells“ firmiert. Sein bekanntester Mit-Erfinder und Propagandist ist der französische Ökonom Jean Fourastié mit seinem 1954 in Deutschland erschienenen Buch Die Große Hoffnung des 20. Jahrhunderts.
Das „Drei-Sektoren-Modell“
Die Gesamtwirtschaft wird statistisch in drei Sektoren unterteilt. Der erste oder auch „primäre Sektor“ umfasst die Agrar- und Forstwirtschaft, die Fischerei und diverse Rohstoffe. Er ist der Sektor der Nahrung und Grundversorgung.
Den zweiten bzw. „sekundären Sektor“ bilden das verarbeitende und produzierende Gewerbe, vor allem sind das die gesamte Industrie, das Handwerk, die Bauwirtschaft.
Der dritte, „tertiäre Sektor“ wird auch der „Dienstleistungssektor“ genannt. Er ist strenggenommen eine statistische „Residualgröße“, die alles enthält, was unter den anderen beiden Sektoren keinen Unterschlupf findet. Seine Schwerpunkte sind der Handel, Verkehr, Logistik, Versicherungen, Banken, Gesundheit insgesamt, Pflege, Sozialeinrichtungen, in der Summe „personenbezogene Dienstleistungen sowie die Zivilgesellschaft, der Bildungsbereich und der gesamte Öffentliche Dienst. Im Unterschied zu den beiden anderen Sektoren zeichnet er sich durch Beschäftigungsformen aus, deren Arbeitsproduktivität in der Regel durch Technik nicht wesentlich gesteigert oder gar ersetzt werden kann. Es ist also jener Sektor, der am wenigsten rationalisierungsanfällig ist. Er gilt deshalb auch als derjenige, der allein in der Lage ist, die Rationalisierungseffekte der beiden anderen Sektoren beschäftigungswirksam aufzufangen. Und aus diesem Grund sah Fourastié in diesem Sektor auch die „große Hoffnung“ für nicht substituierbare Tätigkeitsfelder.
Der Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft wird heute häufig an dem Grad seines Dienstleistungssektors gemessen. Alle hochentwickelten Volkswirtschaften zeigen mit gewissen Unterschieden ihrer nationalen Besonderheiten insgesamt den gleichen Trend sowohl im Anteil an der Wertschöpfung (Bruttosozialprodukt) als auch in dem Anteil der Beschäftigten, es ist eine sukzessive Verschiebung zunächst vom ersten zum zweiten Sektor und dann bei immer weiterer Ausdünnung des ersten Sektors die Verschiebung vom zweiten in den dritten Sektor.
Am Beispiel Deutschlands kann man vor 200 Jahren geschätzt (amtliche Statistiken gab es noch nicht) davon ausgehen, dass etwa mehr als drei Viertel der Beschäftigten im primären Sektor tätig waren und sich der Rest auf die anderen beiden Sektoren verteilte. Mit der einsetzenden Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschieben sich die Gewichte vom ersten auf den zweiten Sektor mit einem ebenfalls leicht wachsenden dritten Sektor.
Machen wir einen Sprung in die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts und nehmen die Entwicklung der BRD ins Visier und konzentrieren uns auf die für unser Thema vor allem relevanten Verschiebungen der Anteile der Beschäftigten in den jeweiligen Sektoren, dann zeigen die Prozentzahlen für die Sektoren (allen statistischen Zuordnungsproblemen zum Trotz) einen eindeutigen Entwicklungstrend:
Jahr 1. Sektor 2. Sektor 3. Sektor
1950 24,6 42,9 32,5
1965 10,7 49,2 40,1
1980 5,1 41,1 53,8
1995 2,3 31,9 65,9
2010 1,6 24,4 74,0
2019 1,3 24,2 74,5
Eine Aufteilung nach dem Anteil der Sektoren am Bruttosozialprodukt käme in etwa zu dem gleichen Ergebnis. Deutlich wird, dass in dem Zeitraum vom Ende der sechziger zu den siebziger Jahren ein dramatischer Wandel vom zweiten zum dritten Sektor stattfindet. Im Zeitraum von 1973 bis 1975 erfolgt der „Strukturbruch“ (so Raphael 2018, 35), denn hier überflügelt der tertiäre Sektor den sekundären und sein Wachstum zu Lasten oder als „Auffangbecken“ des zweiten Sektors verstetigt sich in der Folgezeit auch unter den veränderten Bedingungen der deutschen Einheit.
Anzumerken ist noch, dass im Unterschied zu den anderen hochentwickelten Industrieländern der Prozess der „De-Industrialisierung“, der z.B. in Großbritannien in der Thatcher-Ära politisch gewollt wurde, in Deutschland nicht in dem Ausmaß stattfand und sich so in einem Bereich weit über 20 Prozent bewegt, ein Anteil doppelt so hoch wie in den USA und Großbritannien. (s. dazu insgesamt Raphael 22018, 92 ff.)
Eine Darstellung der Entwicklung entlang der Berufsgruppen verdeutlicht diese Entwicklung ebenfalls. Seit 1965 ist der Anteil der Selbständigen mit 11,6 Prozent der Erwerbstätigen bis 2018 mit 9,9 Prozent im Jahre 2018 fast konstant geblieben, nur 1980 fiel er auf 8,6 und stieg 2010 auf 11,5 Prozent. Die Beamten bleiben mit 5,0 Prozent im Jahr 1965 bis 4,8 Prozent im Jahr 2018 ebenfalls eine konstante Größe. Ganz anders dagegen das Verhältnis von Arbeitern zu Angestellten. 1965 stellten die Arbeiter noch 48,6 Prozent der Erwerbstätigen gegenüber 26,3 Prozent Angestellte, dagegen beträgt der Anteil der Arbeiter 2018 nur noch 16,6 Prozent und der der Angestellten 65,1 Prozent. Da die Unterscheidung von Angestellten und Arbeitern für die amtliche Statistik an der Beitragszahlung zur jeweiligen Rentenversicherung festgemacht wird, sind diese Zahlen und die Verschiebungen lediglich als ein Indiz für die Veränderungen der Qualifikationsstruktur und Beschäftigungsformen zu werten.
Nach der hier skizzierten Verschiebung in der Beschäftigungsstruktur gilt es nun, diesen Entwicklungsprozess hinsichtlich seiner Gründe und seiner Folgen insbesondere für die Sozialstruktur der deutschen Gesellschaft näher zu betrachten.
Vorzeichen des Wandels in 1960er Jahren
Schon in den 1960er Jahren kündigte sich ökonomisch ein weitreichender Strukturwandel an. Die Expansion des industriellen Sektors erfolgte mit teilweise rasant steigenden Löhnen zunehmend im Verbund mit Rationalisierungsmaßnahmen, die zur Folge hatten, dass die Beschäftigungsmenge in der Industrie nicht mehr wuchs. Einfache Tätigkeiten (veranschaulicht durch den Begriff der „Fließbandarbeit“) wurden aus Kostengründen zunehmend durch Maschinerie ersetzt. Damit stieg zwar zugleich die Nachfrage nach höher qualifizierten Fertigkeiten, was nebenbei bemerkt zu Veränderungen und schließlich zur Expansion und Reform eines immer dysfunktionaler werdenden Bildungssystems führte, weil diese neuen Tätigkeiten mehr kognitives Wissen erforderten als die handwerklichen Fertigkeiten des herkömmlichen Facharbeiters.
Diese interne Umschichtung der Qualifikationsprofile innerhalb des Industrieproduktion erzwang zunächst eine größere Durchlässigkeit im klassischen dreigliedrigen Schulsystem bzw. dessen Ersatz. Ihre Umsetzung erfolgte dann in den siebziger Jahren unter der sozial-liberalen Koalition der Bundeskanzler Brandt und Schmidt. Dass es dabei auch zu heftigen Kämpfen im und um das Bildungssystem kam, bedarf keiner Begründung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Bildungsfragen auch Klassenfragen sind. Natürlich verteidigte insbesondere die CDU / CSU die herkömmlichen „Bildungseliten“ und die privilegierten Zugänge ihres Nachwuchses mit allen Mitteln, um sich gegen aufstrebende Konkurrenz von unten abzuschotten. Nichts fürchtete diese Mitte der Gesellschaft mehr als die Realisierung der „Chancengleichheit“ mit dem Ergebnis, dass aus der bisherigen Ideologie der „sozialen Mobilität“ eine Realität werden könnte.
Aber diese sich damals abzeichnenden Kämpfe, die die Republik mehr oder weniger bis heute begleiten, hielten sich zunächst noch in Grenzen, denn sie erfolgten zunächst noch vor dem Hintergrund des „Wirtschaftswunders“. Noch lebte man in der heilen Welt, wo alle Nutznießer eines „Fahrstuhleffekts“ waren, der alle, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Etagenhöhe, zu abgestuften Teilhabern am Wohlstandszugewinn machte. Und es herrschte Vollbeschäftigung.
Die erhielt ihren ersten Riss 1966 durch eine kleine Wachstumskrise. Nicht einmal eine halbe Millionen Arbeitslose als Folge einer Krise im Kohlebergbau, nicht unmaßgeblich verursacht durch die Substitution der Kohle durch das preiswertere Öl und Gas, reichten in der alten BRD, um die Politik in Panik zu versetzen. Man hatte sich daran gewöhnt, den legendär gewordenen Buchtitel des Schweizer Publizisten Fritz René Allemann Bonn ist nicht Weimar aus dem Jahre 1955 für einen zukunftsweisenden Befund zu halten, womit der Schrecken des Endes der ersten deutschen Republik gebannt sei. Nun schien die Apokalypse der Massenarbeitslosigkeit und damit das Ende der Demokratie wieder aufzuerstehen. Die Panik war so groß, dass es am Ende dieses Jahres 1966 die erste Große Koalition gab. Dank der „modernen Wirtschaftspolitik“ des Sozialdemokraten Karl Schiller, der anders als der „Ordoliberale“ Ludwig Erhard für staatliche Eingriffe in den Wirtschaftskreislauf im Geiste des englischen Ökonomen John Maynard Keynes plädierte, war schon zwei Jahre später die erste Wirtschaftskrise als kleine Konjunkturdelle Vergangenheit.
Dennoch deutete sich hier schon etwas an, was bald darauf eine neue Qualität erhielt: die allgemeine Entwicklung der klassischen von der Schwerindustrie getragenen Industriegesellschaft stand an einem Wendepunkt. Die Rationalisierungsmaßnahmen vernichteten mehr Arbeitsplätze als sie neue schafften. Zunächst gerieten ganze Industriezweige unter Druck und verloren ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber einer aufstrebenden Konkurrenz durch sich industrialisierende „Schwellenländer“ mit Schwerpunkt in Ostasien auf dem Weltmarkt.
In den 1970er Jahren, dem „Jahrzehnt des gesellschaftlichen Aufbruchs“, der sozialen und kulturellen Fundamentalmodernisierung der Gesellschaft endete aber auch der „kurze Traum von der immerwährenden Prosperität“. (Lutz 1984) Dieses Ende drohte noch nicht wegen der vom „Club of Rome“ 1972 zum allgemeinen Entsetzen der Wachstumspropheten verkündeten Endlichkeit der natürlichen Ressourcen, wozu vor allem die Hauptenergielieferanten Kohle, Öl und Gas sowie alle weiteren nicht regenerierbaren Rohstoffe gehören. „Grenzen des Wachstums“ setzte nicht nur die Natur (vom Klimawandel war da noch nicht einmal die Rede), sondern auch die Dynamik der kapitalistischen Ökonomie selbst, und zwar vermittelt über den für Deutschlands Prosperität so unabdingbaren Weltmarkt.
Die Krise ereilte die BRD zuerst in der relativ arbeitsintensiven Textilindustrie, die sich gegenüber der südostasiatischen Konkurrenz nicht mehr behaupten konnte. Schwerer wogen allerdings die nachfolgenden Krisen, die die Werften und dann die Stahlindustrie, das Herzstück des klassischen Industriezeitalters erfasste. (Raphael 2018) Regional war das der Anfang des Niedergangs des Ruhrgebiets. Dazu gesellte sich durch tiefgreifende technologische Innovationen eine „Revolution“ in der Druckindustrie, die weniger quantitativ als vielmehr qualitativ ins Gewicht fiel, weil hier hochqualifizierte Facharbeiter Opfer des technologischen Fortschritts wurden.
Der sich in diesen Produktionsbereichen ankündigende „Strukturbruch“ und Strukturwandel, der eine wirtschaftspolitische Herausforderung wurde, wo die auf Einebnung von Konjunkturzyklen ausgerichtete Theorie von Keynes ohnmächtig war, fand zu Beginn der siebziger Jahre noch seine Erweiterung durch zwei externe Ereignisse, die eine nachhaltigen Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen ankündigten. Da war einerseits das Ende von „Bretton Woods“, jenes nach dem Ende Zweiten Weltkrieges installierte Weltwährungssystem, das auf dem Dollar als Leitwährung mit festen Wechselkursen beruhte. Durch die enorm gestiegenen Kosten des Vietnamkrieges verlor der Dollar an Wert. Das System fester Wechselkurse wurde aufgekündigt und durch das „Floaten“ ersetzt, das hieß der Wert des Dollars bildete sich an Währungsmärkten, was dem Finanzkapitalismus später erkennbaren Auftrieb gab. Der Dollar wurde nun zur „heimlichen Leitwährung“, weil alle internationalen Transaktionen weiterhin in Dollar absolviert wurden.
Noch gravierender war aber zunächst ein anderes Ereignis, das den Ausgangspunkt für ein neues Zeitalter bildete und die westlichen Industriestaaten ins Mark traf. 1973 nutzte im Kontext des Yom-Kippur-Krieges die Organisation Erdöl exportierenden Staaten (OPEC) die Gunst der Stunde und verwandelte die Ware Öl in eine politische Waffe gegen den Israel im Krieg unterstützenden „Westen“. Das bis dahin billige „Schmiermittel“ der Industrieländer stieg von 2,1 Dollar pro Barrel auf 35,2 Dollar und stürzte sie in eine tiefe Krise. (Wehler 2008, 60 f.)
Es folgte ein Jahrzehnt der Dauerkrise, der Parallelität von Inflation und Massenarbeitslosigkeit (Stagflation genannt), also jener beiden Geiseln des Kapitalismus, die man im Westen dank der Keynesianischen Wirtschaftspolitik für ausgerottet hielt. Da aber die Ölpreiserhöhung ein willkürlicher politischer Akt war, wurde allein darin die Ursache für die Misere gesehen und alle Bemühungen zielten dahin, dieser politischen Waffe den Zahn zu ziehen, d.h. Zerschlagung der OPEC. Was allerdings nicht gelang, sondern 1976 und 1980 erfolgte weitere Erhöhungen um 130 %. (Wehler 2008, 62 f.)
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der BRD 1950 bis 1990 und das Problem der Dienstleistungsgesellschaft
Die Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit war für Westdeutschland ein zusätzliches Problem, weil sich damit – wie schon erwähnt – die Diagnose verband, sie habe primär zum Ende der Weimarer Republik und Hitlers Machtergreifung geführt und nun drohe in dieser Kausalität betrachtet auch der zweiten deutsche Demokratie das gleiche Schicksal.
Dabei startete die Bonner Republik mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Von 11 Prozent im Jahre 1950 sank sie dann aber kontinuierlich auf 0,7 Prozent im Jahre 1962, statistisch war das „Vollbeschäftigung“ bzw. gar „Überbeschäftigung“, denn es handelte sich lediglich um eine „Reibungsarbeitslosigkeit“ beim Wechsel von einem Job zum anderen. Als die im Zuge des „Wirtschaftswunders“ steigende Nachfrage nach Arbeitskräften durch die gut ausgebildeten Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands durch den Bau der Mauer 1961 nicht mehr befriedigt werden konnte, wurden sie durch „Gastarbeiter“ für einfachere Tätigkeiten und Weiterqualifizierung heimischer Arbeitskräfte substituiert. Bis 1967 hielt sich die „Arbeitslosigkeit“ auf dem Niveau von 0,7 Prozent, bis sie dann 1966/67 durch die Bergbaukrise auf fast eine halbe Millionen Arbeitslose auf 2,1 Prozent anstieg. Sie fiel dann durch das „Konjunkturpaket“ der Großen Koalition wieder unter 1 Prozent. Dort verharrte sie bis 1974, wo sie dann als Folge der „Ölkrise“ auf über eine halbe Millionen Arbeitslose (2,6 %) und 1975 auf über eine Millionen (4,7%) hochschnellte, um dann auf diesem Niveau leicht abfallend bis 1980 zu stagieren. Mit einer weiteren Ölkrise erfolgte dann bis 1985 eine Steigerung weit über die zwei Millionen (9,3 %) und sank erst 1990 wieder unter die zwei Millionenmarke (7,2 %).
Die Diagnose der rein politischen Ursache für die ansteigende „Sockelarbeitslosigkeit“ verdeckte lange tieferliegenden Ursachenergründungen. Das Sterben von Wirtschaftsbranchen wie der Textilindustrie, dann der Stahlindustrie verrieten ökonomische Gründe und Wandlungen, die mit der Veränderung der Weltwirtschaft zu tun hatte, aber auch mit Strukturproblemen im eigenen Land. Aber welcher Art waren sie? Nicht zufällig erlebte hier der wirtschaftspolitische Neoliberalismus seinen Aufschwung, der vor allem auf den angeblich auswuchernden Sozialstaat als Krisenverursacher zielte. Für die Neoliberalen war der Staat mit seinen Interventionen in den Wirtschaftskreislauf nicht mehr die Lösung, sondern das zu lösende Problem. Und die Devise hieß fortan, mehr Markt und so wenig Staat wie möglich.
Die zunehmende Erkenntnis, dass der Einbruch der Wachstumsraten nicht konjunktureller, sondern struktureller Art war, erzwang zum einen, die Grenzen des „Keynesianismus“, d.h. der politischen Steuerung des Wirtschaftskreislaufs zu erkennen und zweitens, nach Strukturreformen Ausschau zu halten. Die damit verbundenen Herausforderungen waren mehrfacher Art. Insofern ganze Branchen der Weltmarktkonkurrenz der aufstrebenden „Schwellenländer“ nicht mehr gewachsen waren, waren sie vor dem Hintergrund der erreichten Lohnstandards kaum zu halten. Dieses Schicksal teilte die BRD-Ökonomie mit allen anderen „hochentwickelten Industrieländer“, ihre Wettbewerbsvorteile verlagerten sich in höher qualifizierte Technologien, die aber den Nachteil hatten, dass sie zugleich bezogen auf den gesamten sekundären Sektor mehr Arbeitsplätze abgaben als neue – und das waren dann meistens höher qualifizierte – zu kreieren.
In diesem Sinne beschrieb der amerikanische Soziologe Daniel Bell in seinem 1975 in Deutschland erschienenen Buch Die nachindustrielle Gesellschaft den Übergang von einer Güterproduzierenden zu einer „Dienstleistungsgesellschaft“. Bei ihm ist der Dienstleistungsbereich allerdings keine eigenständige Größe, sondern etwas, was sich um die Industrieproduktion herum legt, sie erweitert und ergänzt. Den entscheidenden Wandel sieht er in der zunehmenden Bedeutung des wissenschaftlich-technischen Wissens in allen Bereichen der Produktion und Organisation. Daraus, so seine Prognose, ergebe sich eine neue soziale Achse, die nicht mehr entlang der Gegensätze in den Kategorien von Kapital und Arbeit, sondern nach Bildung und Wissen verläuft.
Ein Vorteil der Prognose Bells besteht darin, dass er einen (diffusen) Begriff von Dienstleistungsgesellschaft (etwa in Form des statistischen tertiären Sektors) nicht an die Stelle der alten Industriegesellschaft setzt, sondern den Strukturwandel innerhalb der Industrie als Verlagerung von Berufstätigkeiten und entsprechenden (höherwertigen) Qualifikationsprofilen beschreibt und die sich damit verändernde Sozialstruktur einer nachindustriellen Gesellschaft analysiert. Der Nachteil war aber auch, dass er damit den parallelen gesamtgesellschaftlichen Strukturwandel, also den „sektoralen“ Wandel mit der Expansion von „Dienstleistungen“ jenseits der Industrieproduktion zu wenig würdigte.
Die amtlichen Statistiken bieten keine exakten Zahlen über das Gebilde Dienstleistungsgesellschaft, bestenfalls Annäherungswerte, weil die eigentlichen Tätigkeiten dafür statistisch gar nicht erfasst werden. Man kann hier lernen, dass die Bildung von Begriffen gerade für empirische Analysen das entscheidende Handwerkszeug ist. Denn bevor ich in der Mannigfaltigkeit der komplexen Sachverhalte etwas Messbares finden kann, brauche ich einen genauen Begriff davon. Sie wirken wie die Netze eines Fischers, deren Art und Größe darüber entscheidet, welche Fische ich fangen kann.
Ein simples Beispiel möge das zeigen, dass Worte noch keine Begriffe sind und sogar gleiche Tätigkeiten in den Statistiken ganz verschieden untergebracht und zu Verzerrungen führen können: Ein Jurist, der er in einem Industriebetrieb arbeitet, findet sich statistisch im sekundären Sektor wieder, arbeitet er für den gleichen Betrieb als Jurist in einer „outgesourcten“ Kanzlei, vergrößert er den tertiären Sektor. Beim Wachstum dieses Sektors ist also auch zu bedenken, dass Formen des Organisationsmanagements für die Charakterisierung gesellschaftlicher Entwicklungen nicht einflusslos sind. Und der Trend des „Outsourcing“ von „Dienstleistungen“ aus den Produktionsbetrieben wurde zum Markenzeichen „modernen Organisationsmanagements“ und beflügelt den Zuwachs des Dienstleistungssektors.
So wichtig die Bestimmung der Dienstleistungen in Verbindung mit der industriellen Produktion ist, so falsch ist es, sie darauf zu reduzieren. Wenn richtig ist, dass technologisch induzierte Rationalisierungsprozesse in der Industrie mehr Arbeitsplätze vernichten als sie neue kreieren. stellt sich gesamtwirtschaftlich die Frage, wo können dann die so ihrer Arbeit Beraubten neue „Jobs“ finden? Und da zeigt sich, dass gemäß dem Sektorenmodell dies nur in einem erweitert verstandenen Begriff von „Dienstleitungen“ erfolgen kann. Und es zeigt sich, dass dieser Bereich der „großen Hoffnungen“ seine eigenen gesellschaftlichen und vor allem ökonomischen Tücken hat.
Die Hoffnungen liegen darin, dass sie arbeitsintensiv und resistent gegen technologisch induzierte Rationalisierungen sind. Aber dieser Vorteil begegnet auch dem Nachteil, zumindest teilweise auf einem vergleichbar geringeren Lohnniveau leben zu müssen. Die Arbeitskosten schlagen hier nicht nur unmittelbarer auf die Produktpreise durch, sondern diese Produkte unterliegen häufig dem zusätzlichen Problem, dass die Konsumenten hier die Wahl haben, bei steigenden Preisen statt zu kaufen, auf Eigenleistung umzusteigen („make or buy). Wenn die Löhne aber nicht vom allgemeinen Lohnniveau, das wesentlich durch die Produktivitätssteigerungen des produzierenden Gewerbes bestimmt wird, abgekoppelt werden sollen und sich somit ein „Niedriglohnsektor“ entwickelt, dann steigen die Löhne und Arbeitskosten ohne dass ihre eigene Produktivität steigt. In dieser Falle stecken weite Teile des Dienstleistungssektors von der öffentlichen Verwaltung bis zum Gesundheitsbereich, wobei hier die Alternative der „Kunden“ von „selbermachen“ oder „kaufen“ nicht so stellt wie bei der Dienstleistung Frisör. Ökonomen nennen dieses Phänomen nach dem US-Ökonomen Baumol die „Baumolsche Falle der Dienstleistungsökonomie“.
Beim Transfer der Arbeitenden von einem Sektor in den anderen stellen sich noch weitere, u.z. soziale Probleme: welche Möglichkeiten und Zumutbarkeiten bestehen, um beispielsweise aus einem gelernten Stahlkocher einen Altenpfleger oder IT-Experten zu machen. Hier konnte man von Beginn an lediglich beobachten, dass flexiblere Arbeitsmärkte (wie in den USA), also solche, die nicht durch Gewerkschaften und Tarifverträge mehr oder weniger reguliert waren, wesentlich „unbürokratischer“ und „anpassungsfähiger“ waren, als die stärker regulierten in Deutschland. Und um die steigende Zahl der Arbeitslosen zu senken, gingen die Bemühungen folgerichtig dahin, in den USA das „gelobte Land“ moderner, flexibler Arbeitsmärkte zu sehen. Der „Stumme Zwang der Ökonomie“ oder der „Markt“ regelte das scheinbar von selbst. Damit übernahm die Dreifaltigkeit der neoliberalen Wirtschaftspolitik: Privatisierung, Deregulierung und Flexibilisierung (vor allem von Arbeitsmärkten) die Deutungshegemonie.
Es war aber keineswegs so, dass ein großangelegter Dienstleistungsbereich schon vorhanden war, der nur darauf wartete, die „Freigestellten“ aus dem anderen Sektor aufzunehmen. Bei aller Vielfalt dessen, was sich hinter der weiten Begrifflichkeit der Dienstleistungen verbirgt, damit hier „marktförmige“ Beschäftigungen größeren Umfangs generiert werden konnten, mussten immer weitere Bereiche der Gesellschaft „ökonomisiert“ und Tätigkeiten und Arbeitsfelder in „Warenform“ (Kommodifizierung) verwandelt werden. Dem Erfindungsgeist war hier von der Bildung über die Gesundheit bis zur Altenpflege – um nur die prominentesten zu erwähnen – keine Grenzen gesetzt, wobei die „Professionalisierung“ insbesondere zuvor „ehrenamtlicher“ Tätigkeiten ein zusätzlicher Faktor war.
Kurzum: In Deutschland fehlte rein marktwirtschaftlich betrachtet auf Grund vergleichsweise stark regulierter Arbeitsmärkte – was ein Gewinn für die Arbeitnehmer war und ist – die erforderliche „Flexibilität“ auf den Arbeitsmärkten (wie im Musterland USA), die einen aufnahmefähigen „Niedriglohnsektor“ für Dienstleistungen erzwangen. Aber auch in den USA, wie in allen westlichen Industrieländern sah man mit quantitativen Unterschieden das gleiche Phänomen, die Träger einer strukturellen (also nicht nur konjunkturell bedingten) Arbeitslosigkeit türmte sich mit jeder weiteren Konjunkturdelle weiter auf und brachte ein stetig wachsendes Heer von Langzeit- und Dauerarbeitslosen hervor.
Aber diese hier rein aus der ökonomischen Entwicklung sich ergebende Entwicklung zeigte dann auch die effektiven Nachteile der Ökonomisierung gesellschaftlicher Bereiche, die neue Formen des „Wirtschaftens“ mit alten Ideen wie beispielsweise dem Genossenschaftsgedanken als ein Element der „Dekommodifizierung“ als Kern einer „solidarischen Ökonomie“ revitalisierte, die sich schon Ende der siebziger Jahre bemerkbar machten.
Neue soziale Spaltungen, kulturelle Differenzierungen und die „Silent Revolution“
Die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts waren von sehr widersprüchlichen Tendenzen geprägt. Sie begannen politisch und gesellschaftlich mit großen Reformerwartungen, die sich mit dem Aufbruchversprechen „mehr Demokratie zu wagen“ verbanden und auch insofern erfüllten, als sich in diesem Jahrzehnt eine die Republik neu prägende Zivilgesellschaft etablierte. Sie war allerdings keine Verstärkung der schon bestehenden institutionalisierten Formen der traditionellen Großorganisationen Kirchen und Gewerkschaften. Die sich entfaltende neue Zivilgesellschaft war das Spätprodukt der Jugendrevolte der sechziger Jahre. Eine „Graswurzelrevolution“, die überwiegend getragen wurde von Jugendlichen, die neue Themen – hervorzuheben die Frauen- und Umweltbewegung sowie „Selbsthilfegruppen“ und autonome Jugendzentren – in die politische Öffentlichkeit trugen und insgesamt Repräsentanten dessen wurden, was dann als „Neue Soziale Bewegungen“ in die Geschichte einging. Sie ersetzen und verdrängten zunächst nicht die „alten“ an sozialen Konfliktlagen orientierten sozialen Bewegungen, also hier speziell die Arbeiterbewegung, sie ergänzten sie mit neuen Interessen und Lebenslagen.
Aber das vollzog sich keinesfalls konfliktlos. Die Anti-AKW und Umweltbewegung kollidierte mit den unmittelbaren materiellen Interessen der dort Beschäftigten. Diese Interessenkonflikte erweiterten sich mit sozialen Differenzen. Gesellschaftlich stammte die überwältigende Mehrheit der Akteure der „Neuen Sozialen Bewegungen“ entweder aus der Mittelschicht oder zählten als Bildungsaufsteiger potenziell zu ihr. Aber hinter dieser Erscheinungsform verbarg sich noch eine kulturelle Differenz, eine fundamental andere Lebenseinstellung.
Sie wurde zwar ansatzweise schon 1977 von dem kanadischen Soziologen Ronald Inglehart in The Silent Revolution diagnostiziert, aber sie kam erst in den achtziger Jahren zum Durchbruch. Inglehart (1995) hatte für die Jugendrevolte und ihre nachfolgenden Jahrgangskohorten festgestellt, dass es sich hier um eine nachhaltige Veränderung in der Einstellung von Kohorte zu Kohorte handelt, die sich keinesfalls mit dem dreißigsten Lebensjahr überlebt, um dann als „nützliches Mitglied der etablierten Gesellschaft“ in den main-stream der Rollenerwartungen und Normen der „Erwachsenen“ einzutreten. Die von Inglehart eruierte „postmaterialistische Wertorientierung“ relativiert bzw. ersetzt die „materiellen“ Werte der Erwachsenenwelt wie Wohlstand, Besitz, Konsum und Sicherheit als erstrebenswerte Lebensziele durch Werte wie „Selbstverwirklichung“, sinnvolles Leben jenseits des „Habens“. Man könnte es lebensphilosophisch auf Erich Fromms Unterscheidung von „Sein“ und „Haben“ zuspitzen (Fromm 1976).
Natürlich lag der Verdacht nahe, dass sich solche Einstellungsmuster durch die schon erfolgte materielle Sättigung erklären lassen, aber das verdeckte die Tatsache, dass das Wachstum der „Postmaterialisten“ innerhalb der Mittelschicht, wo er stark gekoppelt am höheren Bildungsniveau war, die kulturelle Homogenität dieser Schicht aufkündigte. Das wurde politisch offensichtlich, als in Gestalt der Partei Die Grünen sich hier eine neue politische Kraft formierte, die dann die soziale und sich bürgerlich dünkende „Mitte“ förmlich zerriss. Da sich dieses Einstellungsmuster, entgegen konservativer Hoffnungen – wie erwähnt – nicht mit dem Erwachsenenalter auswuchs, sondern als eine in der „postadoleszenten“ Sozialisationsphase erworbene dauerhafte Prägung erkannt wurde, musste mit dieser kulturellen Erneuerung als neue Scheidung der (bürgerlichen) Mitte gerechnet werden.
In diesem Gepäck befand sich ein weiterer Befund, der durch den Soziologen Ulrich Beck (Beck 1986) Mitte der achtziger Jahre Karriere machte. Beck stellte, was nicht neu war, fest, dass „Stand und Klasse“ als Kategorien der Gesellschaftsanalyse ausgedient hätten. Aufregender war seine Erkenntnis, dass die Integrationskraft großer Organisationen dramatisch schrumpft, weil es einen Trend zur „Individualisierung“ gebe. Deutlich zeigte sich das am „Engagementverhalten“, was sich später immer deutlicher empirisch messen ließ. (Darthe 2011 und Wortmann 2012). Nachwachsende Generationen orientierten sich immer weniger an dem, was „man“ aus welchen Traditionsbeständen auch immer tut, sondern allein an dem, was man selber für sinnvoll und erstrebenswert erachtet. Dabei spielte die subjektive Selbstverwirklichung und der Faktor „Spaß“ eine zunehmend wichtigere Rolle und ein neues Zauberwort kam hinzu: die „Betroffenheit“. Daraus resultierte eine Neuformierung der Zivilgesellschaft. Altehrwürdige Großorganisationen wie Kirchen und Gewerkschaften, aber auch andere als zu schwerfällig und bürokratisch erachtete Schwergewichte wie z.B. das „Rote Kreuz“ litten unter Nachwuchsmangel, während kleine „Selbsthilfegruppen“ mit überschaubarem Teilnehmerkreis und geringen Organisationsaufwand Zulauf für zeitlich kontingentiertes Engagement erhielten. (Wortmann 2012)
Die unbeabsichtigten Folgen dieses Trends waren ebenfalls bald erkennbar: eine zunehmende Bewegungsmenge kreiste in immer kleineren und zahlreicheren Gruppen um immer speziellere Themen von denen immer weniger „betroffen“ waren. Die Gesellschaft entpuppte sich so gesehen als ein loseverknüpfter Flickenteppich, wo immer spezifischere Minderheitenthemen für immer weniger Menschen in immer weniger verbundenen Kleingruppen um sich selber kreisten. Diese sich abzeichnenden Schattenseiten der „Individualisierung“ gerieten zunehmend ins Visier einer anderen Gesellschaftskritik und erhielt Nahrung, weil der Eindruck entstand, dass nur noch (als lautstark wahrgenommene) Minderheiten überhaupt Gehör fänden, während die „schweigende Mehrheit“ leer ausgehe. Welchen Anteil am Anstieg v.a. des Rechtspopulismus diese Wahrnehmung hat, ist eine andere Frage.
Was Ulrich Beck als „Individualisierung“ beschrieb, hieß zugleich auch Auflösung der „traditionellen Großmilieus“ und deren nicht zu unterschätzenden Anteil an der Bereitstellung „sozialer Integration“. In der politischen Sphäre machte sich die Erosion der sozialen Milieus als sukzessiver Niedergang des Typus der Volkspartei bemerkbar. Platt ausgedrückt, verliert die Volkspartei CDU an gläubigen Christen und die Arbeiterpartei SPD an Arbeitern. Einerseits weil es sich sozialökonomisch bzw. soziokulturell um schmelzende Größen handelte oder sie abwanderten, weil sie sich nicht mehr als Kernklientel ihrer alten Parteien erkennen konnten, denn diese mussten paradoxerweise, um den Status der Volkspartei quantitativ zu halten, ihre immer pluraler werdende Wählerschaft aus immer kleinteiligeren Themen zusammensetzen, womit ihre „Identität“ zwangsläufig unschärfer wurde.
Die spätere Suche etwa der SPD unter Gerhard Schröder nach einer „neuen Mitte“, die als die „Leistungsträger“ und „Gewinner der Globalisierung“ das Zentrum der neuen Wählerschaft sein sollte, ist ein Versuch, dem Risiko einer „Regenbogen-Koalition“ von exklusiven Minderheiten zu entgehen, aber damit wurden auch die sozial an den Rand oder gar außerhalb der Gesellschaft Gedrängten als überwiegende Nichtwähler sich selbst überlassen. (Walter 2009, 92 ff.)
Für die neuen sich abzeichnenden Spaltungslinien der Gesellschaft prägte schon Mitte der 1980er Jahre der frühere Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter Glotz, den Begriff der „Zweidrittel-Gesellschaft“. (Glotz 1984, 109) Das wurde quantitativ als übertrieben kritisiert, aber als „Zuspitzung“ einer Tendenz war es weitsichtig. Was sich abzeichnete, dann aber durch die zusätzlichen Probleme und neuen Ungleichheiten im Gefolge der deutschen Einheit als hinzukommende Verwerfungen verdeckt wurde, war eine Gesellschaft, in der ein ziemlicher großer Teil nicht nur dauerhaft und meistens unfreiwillig aus dem Beschäftigungssystem ausschied, sondern auch am gesamten gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben nicht mehr teilnahm. Sie machten sich lediglich als steigende Zahl einer Nichtwählerschaft (un)bemerkbar. Die wurde zunächst unter dem diffusen Sammelbegriff der „Politik- oder Parteienverdrossenen“ registriert und schien alle Parteien gleichermaßen zu treffen. Bis bei einem Ländervergleich auch für Deutschland offenkundig wurde, dass vor allem die Parteien der Linken, hierzulande insbesondere die SPD, von dieser massenhaften Wahlabstinenz erfasst wurde. Das war eine Erfahrung, die durch die Hartz-Reformen noch verstärkt wurden und der SPD nachhaltig ein verlorenes Wählerpotenzial verschloss. Was der Politikwissenschaftler Arnim Schäfer bei seiner Auswertung internationaler Wahlstatistiken herausfand, brachte er auf die Formel: „Wie man wählt, hängt weniger eng mit der Klassenlage als in der Vergangenheit zusammen, ob man wählt dafür umso mehr.“ (Schäfer 2015, 123)
Renaissance der Klassen oder Identitätssuche?
Angesichts des tiefen Strukturwandels und Strukturbruchs ab den 1970er Jahren wäre kaum etwas naheliegender gewesen, als eine Renaissance von Sozialstrukturanalysen auf der Basis des Klassen- und zumindest des Schichtenbegriffs. Unübersehbar driftete die Gesellschaft immer weiter in ein sozialökonomisches Unten und Oben auseinander. Soziale Armut wurde wieder zu einem Phänomen wie umgekehrt ungeheurer Reichtum sich ebenso zeigte. Er wurde so enorm, dass es dafür das neue Wort der „Hyperreichen“ gibt.
Nach einer überwiegend außeruniversitär erfolgten kurzfristigen Wiederbelebung des Klassenbegriffs in den siebziger Jahren im Kontext der Aufarbeitung der Marxschen Theorie, die sich aber in kategorialen Problemen ebenso verfing wie in dem noch größeren empirischen Problem, die sich immer stärker ausdifferenzierende Gesellschaft in ein „konfliktfähiges“ Klassenschema zu fassen, das sich zugleich als handlungsfähige Subjekte zu erkennen gab. (Wortmann 2020)
Hans-Ulrich Wehler skizziert in seiner kritischen Rekonstruktion der Sozialstrukturanalysen nach dem Ende der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ Schelskys in den siebziger Jahren die weitere Abkehr der universitären Forschung vom Schichten- und Klassenbegriff. Wehler favorisiert dabei nicht den Marxschen Klassenbegriff, der sich an der Stellung zu den Produktionsmitteln und den daraus resultierenden Revenuequellen (Profit, Grundrente und Lohn) orientiert, sondern den an Erwerbsklassen favorisierten von Max Weber, den er dann auch ins Zentrum seiner späteren Sozialanalyse rückte. (Wehler 2013, 29 ff.)
Wehler fand es erstaunlich, dass angesichts der sich abzeichnenden sozialen Krisenphänomene die hierarchischen Sozialstrukturen immer mehr aus dem Blickfeld zugunsten einer „kulturalistischen Wende“ gerieten. Nicht die „objektive“ Stellung der Menschen in der Gesellschaft oder gar im „Produktionsprozess“ rückte ins Visier des Erkenntnisinteresses, sondern „Lebenslagen“, „Lebensstile“ und „Milieus“ wurden die Schlüsselkategorien der Gesellschaftsanalyse. Diese „kulturalistische Wende“ verlagerte das hierarchische, vertikale Schichtengefüge in eine horizontale soziale Ungleichheit, die zusätzliche Ungleichheitsfaktoren wie Geschlecht, Herkunft, Ethnie und Alleinerziehende als Elemente für Benachteiligungen ins Zentrum der Strukturanalyse rückte. (Wehler 2008. 113 ff.) Wehler verdächtigte die Forschung, hier Opfer des „postmodernen“ Zeitgeistes geworden zu sein.
Besonders der Faktor Bildung erfährt als Element der Verteilung für gesellschaftliche Chancen eine sich nahezu verselbständigende herausragende Bedeutung. Ergänzt wurde diese Forschungstendenz durch stärkere Einbeziehung auch der subjektiven Selbsteinschätzung der Gesellschaftsakteure. Die sich so formierende und dominant werdende Forschungsrichtung spiegelt sich paradigmatisch in dem Lehrbuch von Stefan Hradil das es auf acht Auflagen brachte. (Hradil 2005)
Wie sehr die sich pluralisierende Gesellschaft nach neuen Erklärungen rief und wie sehr sich die Analysen auf die empirische Erkundung dieser „neuen Unübersichtlichkeit“ stürzten, erklärt vielleicht nichts besser, als die atemberaubende Karriere, die in den achtziger Jahren (und weit darüber hinaus) die „SINUS-Milieustudien“ erlebten. Das auf Marktforschung spezialisierte Unternehmen SINUS hatte das Beobachtungsverfahren auf die Gesellschaft radikal verändert. Ausgang waren nicht mehr objektive Sozialdaten wie Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf, Einkommen, Religion, Stadt-Land, Familie etc. von denen aus man dann auf beobachtbare Einstellungsmuster und unter anderem auch auf das Wahlverhalten schließen konnte. Mit diesem alten Ansatz hatte die Wahlforschung übrigens bei der Bundestagswahl 1983 Schiffbruch erlitten, weil sie damit Die Grünen nicht ins Visier bekamen. Denn hier entstand eben jene Mittelschicht, die nicht ihrem „Geldbeutel“ entsprechend wählte, sondern eher gegen ihn, also „postmaterialistisch“.
SINUS verändert die Herangehensweise und suchte in der Gesellschaft mit einem extrem aufwändigen Verfahren mach clusterbaren Einstellungstypen (Milieus) und erkundete dann deren Anteile in der Gesellschaft. Aus der Perspektive dieser „subjektiven“ Seite der Gesellschaft konnten „Lebensstile“ quantitativ erfasst und prognostiziert werden, was für die Wahlforschung nun immer wichtiger wurde – und fürs Marketing natürlich noch mehr, damit Werbung und Produkte von vorherein an die Richtigen adressiert werden.
Da das gesellschaftliche und kulturelle Leben immer stärker von einer sozialen Mittelschicht dominiert wurde, den die unteren Ränder fielen ja faktisch aus, die aber äußerlich (und innerlich) nicht mehr wie zuvor als ein relativ homogenes Bürgertum in Erscheinung trat (wie sehr man sich auch um die Reaktivierung einer „neuen Bürgerlichkeit“ bemühte), sondern im Gegenteil als ein sehr heterogenes Gebilde in eine Vielzahl disparater Lebensstile und Kulturen zerfiel, war es vielleicht naheliegend, den Schwerpunkt einer differenzierten Sozialanalyse auf jene „subjektiven“ und „kulturellen“ Faktoren, die für das gesellschaftliche Leben als relevanter erscheinen als die objektiven Faktoren der Stellung im gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess. Dass aber Schichtung für die Lebensstilforschung doch nicht ganz unwichtig war, das signalisierte ausgerechnet SINUS, als dort in den Nuller Jahren die Milieus mit der Schichtzuordnung kombiniert wurden. (Burzan 2004, 118 ff.)
Es zeigte sich, dass das gesellschaftlich relevante Maß an sozialer Ungleichheit nicht nur kulturell, sondern in den hierarchischen Formen enormen Zuwachs erhielt. Die Vermögens-, Eigentums- und Besitzverhältnisse auszuklammern oder zu marginalisieren, wurde spätestens mit der kollektiven Erfahrung der Finanzkrise „ideologieverdächtig“. In diesem Sinne ist Ulf Kadritzkes These, dass der „Abschied von der klassentheoretischen Perspektive, den jüngere Analysen zur gesellschaftlichen Mitte genommen haben, als Verlust von Erkenntnismöglichkeiten und zugleich als renovierte Ideologie“ anzusehen ist, noch auszuweiten. (Kadritzke 2017: 18)
Auch der „Mythos der Mitte“ gerät zunehmend ins Visier der Kritik. So sehr sie immer noch (neuerdings auch als „hart arbeitende Mitte“) als der soziale und politische Stabilitätsanker der Gesellschaft erscheint, so sehr gerät sie in den Verdacht der „Schwindsucht“ wegen ihrer sozioökonomischen Disparitäten einerseits und ihrer schwächelnden sozialen und politischen Integrationskraft andererseits, denn die Mitte selbst gilt als anfällig für das, was ihr eigentlich gerade widerspricht, für Radikalität. Politisch aktuell spitzt sich das auf die politische Gretchenfrage zu: Wie hält sie es mit dem „Rechtspopulismus“ und der AfD?
Diesem Themenspektrum der Gegenwart widmet sich abschließend der fünfte Teil.
Literatur:
Abelshauser, W. (2011): Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart. München
Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M.
Bell, D. (1973): Die nachindustrielle Gesellschaft. Frankfurt / New York 1975
Burzan, N. (2004): Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien.Wiesbaden
Dathe, D. (2011): Engagement: Unbegrenzte Ressource für die Zivilgesellschaft? in: E. Priller et al. (Hg.): Zivilengagement. Herausforderung für Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. Münster: LIT-Verlag 2011, S. 41-56
Fourastié, J. (1954): Die Große Hoffnung des 20. Jahrhunderts. Köln
Fromm, E. (1976): Haben oder Sein. Die seelischen Grundlageneiner neuen Gesellschaft. Stuttgart
Glotz, P. (1984): Die Arbeit der Zuspitzung. Berlin
Hradil, St. (2005): Soziale Ungleichheiten in Deutschland. Wiesbaden 8. Aufl.
Inglehart, R. (1995): Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt. Frankfurt a.M./ New York
Kadritzki, U. (2017): Mythos „Mitte“ -Oder; Die Entsorgung der Klassenfrage. Berlin
Lutz, B. (1984): Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Eine Neuinterpretation der industriell-kapitalistischen Entwicklung im Europa des 20. Jahrhunderts. Frankfurt / New York
Raphael, L. (2018): Jenseits von Kohle und Stahl. Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom. Berlin
Schäfer, A. (2015): Der Verlust politischer Gleichheit. Frankfurt a.M. / New York
Walter, F. (2009): Im Herbst der Volksparteien? Bielefeld
Wehler, H.-U. (2013): Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland. München
Wehler, H.-U. (2008): Deutsche Gesellschaftsgeschichte. V. Band: Bundesrepublik und DDR 1949 bis 1990. München
Wortmann, Rolf (2020): Zwischen Integration in die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ und der Suche nach dem revolutionären Subjekt, in: Werner Thole u.a. (Hg.):‘Der lange Sommer der Revolte‘. Soziale Arbeit und Pädagogik in den frühen 1970er Jahren. Wiesbaden. 2020, S. 29-38
Wortmann, R. (2012): Neuere Literatur zum Bürgerschaftlichen Engagement, zum Dritten Sektor und neue Managementansätze für NPOs – Ein kritischer Literaturbericht, in: Jahrbuch für Management in Nonprofit-Organisationen Vol. 1, Münster: LIT-Verlag, S. 203-225