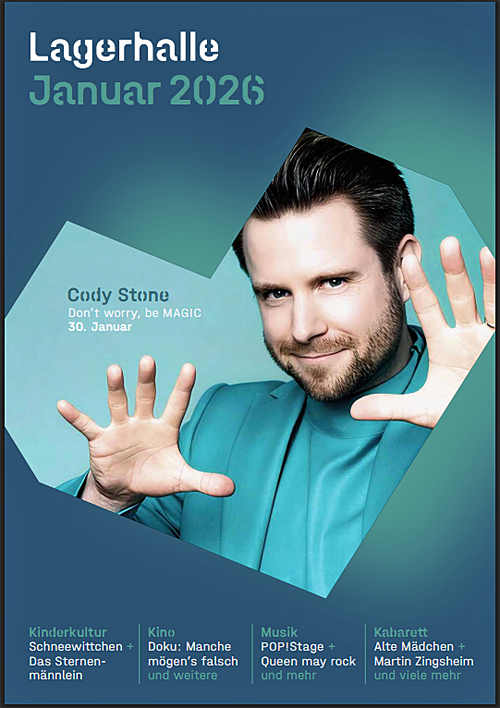Die Mitte als Mythos und Problem – Teil 5
(Teil 1 – Teil 2 – Teil 3 – Teil 4)
Die soziale und politische Fragmentierung der Mitte. Rückkehr zur Klassengesellschaft?
Im vereinten Deutschland änderten sich in der Wissenschaft die Sichtweisen auf die Gesellschaft keineswegs. Zwar musste den „Besonderheiten“ der „neuen“ Bundesländer, also dem Osten, Tribut gezollt werden, aber die kulturelle Perspektive in der Strukturanalyse der Gesellschaft blieb dominant. Probleme bereiteten den Forschern die Übertragung der Milieus auf die Ostländer, die dadurch vom Westen abgekoppelt wurden und zwei getrennten Sozialanalysen Platz machen mussten.
In der Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze (1992) erreichte die „kulturalistische Wende“ in der Soziologie ihren Höhepunkt. Zwar stellten sich im neuvereinten Deutschland andere Fragen, aber Schichtenmodelle, von Klassen ganz zu schweigen, blieben rare Versuche, die neue Einheitsgesellschaft zu erfassen und zu beschreiben. Das war insofern etwas überraschend, weil im den 1990er Jahren abseits der Vereinigungsfolgen zusätzlich zu dem Strukturwandel zur „postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft“ im Zuge der Globalisierung die sozialen Ungleichheiten sowohl weltweit als auch in Deutschland zunahmen. Die Teilung in Einheitsgewinner und -verlierer trat ergänzend hinzu. Der Traum, dass die steigenden Wasserstände alle ins Boot nehmen und höher tragen würden, erfüllte sich nicht. Weder im Vereinigungsprozess noch weltweit in der Globalisierung. Vielmehr teilten sich die nationalen Gesellschaften in solche mit mehr Gewinnern als Verlierern und umgekehrt, aber insgesamt gab es in jeder Gesellschaft Gewinner und Verlierer, unterschiedlich waren nur die Relationen von Land zu Land.
Die Entdeckung der „Unterschicht“
Im deutschen Diskurs über die Strukturen der Gesellschaft hatte zwar die harmonische Mittelschichtsgesellschaft ihre Arbeit getan und war schon in den achtziger Jahren abgetreten, aber weiterhin dominierte der Blick auf die Gesellschaft durch die Mitte. Die „moderne Dienstleistungsgesellschaft“ gebar unübersehbar eine neue Kategorie von Arbeitenden, die aus dem von Tarifverträgen mit Gewerkschaften ausgestatteten Arbeitsbereichen herausfielen und sich am unteren Rande des Arbeitsheeres in einem „Niedriglohnsektor“ vermehrten oder als „Langzeitarbeitslose“ ganz aus dem Arbeitsleben ausschieden.
In den Jahren nach der Jahrhundertwende gerieten sie in einer Studie im Auftrag der „Friedrich Ebert Stiftung“ ins Visier einer Forschungsgruppe, die für diese stattliche Gruppe das Wortungetüm des „abgehängten Prekariats“ erfand. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse paarten sich mit unsicherer Lebenshaltung. Was die Forscher herausfanden, war für die „soziale“ Marktwirtschaft eigentlich ein Offenbarungseid und überforderte den Sozialstaat. Menschen arbeiteten in fulltime-Jobs, die allein zu einem ausreichenden Lebensunterhalt nicht reichten und immer mehr kamen nicht einmal in den Genuss relativ schlecht bezahlter Arbeit und mussten von Sozialhilfe leben. Das ökonomisch mächtige Deutschland wurde zum „Sorgenkind Europas“. Die Befürchtungen vieler Europäer, Deutschland werde durch die Einigung ökonomisch noch mächtiger, schlugen ins Gegenteil um. Deutschland habe sich mit der Vereinigung übernommen, deren Kosten unterschätzt und falle somit als Wirtschaftslokomotive Europas aus.
Zwar war und ist die gesellschaftliche Mitte keinesfalls gegen den Sozialstaat, jedenfalls nicht dann, wenn sie selber davon profitiert. Anders liegen die Dinge, wenn die Empfänger von Sozialleistungen diejenigen sind, für die er eigentlich vornehmlich gemacht war. Da wurden „Modernisierungsverlierer“ zu „Kostgängern“, die sich am Rande der Gesellschaft einrichten, denen auch von sozialdemokratischen Politikern „mangelnde Leistungsbereitschaft“ attestiert wurde. Die SPD erlebte in ihrer Regierungszeit von 1998 an eine Beschleunigung zu jener Entwicklung, die ihr früherer Bundesgeschäftsführer Peter Glotz schon in den achtziger Jahren als „Zweidrittelgesellschaft“ prognostiziert hatte. Allerdings machte er dafür strukturelle, ökonomische Gründe verantwortlich, die seine Genossen später überwiegend ignorierten.
Was nun entdeckt wurde, war keine neue Klasse im klassischen Sinne, aber sie wurde mit einer gleichen Lebenslage zu einer „Schicht“ mit kollektiver Identität und eigenen Lebensformen entwickelt. Zyniker nannten sie die neue DDR, als Abkürzung für „der doofe Rest“. Grund war die Behauptung, es ermangele ihnen vornehmlich an Bildung und vor allem an Bildungswilligkeit und -bereitschaft. Aus der Tatsache, dass Menschen mit einer höheren formalen Bildung nicht im gleichen Maße von Arbeitslosigkeit erfasst wurden wie jene mit geringerer Qualifikation, entstand der Fehlschluss, dass allein der Bildungsabschuss über die Chancen am Arbeitsmarkt entscheidet. Unterschlagen wurde dabei, dass sich erstens der Arbeitsmarkt nicht an den Bildungsabschlüssen der Arbeitssuchenden orientiert und zweitens, dass bei einem Überangebot an höher Qualifizierten lediglich ein Verdrängungswettbewerb entstand, wo die geringen Bildungsabschlüsse die Verlierer im Kampf um die knappen Arbeitsplätze waren und die höher Qualifizierten zwar keine ihrer erworbenen Qualifikation angemessene Beschäftigung fanden, sich aber dafür wenigstens überhaupt einer „minderwertigen“ Beschäftigung erfreuen durften. Was hier entstand, war lediglich eine Verdrängung von formell geringer Qualifizierten durch „Überqualifizierte“. Und da sich die Erklärung, Arbeitslosigkeit ergebe sich primär aus unzureichender Qualifikation, in der öffentlichen Meinung durchsetzte, war die Verantwortung geklärt. Die Individualisierung der Arbeitslosigkeit als Folge mangelnder Bildung erforderte vom „unternehmerischen Selbst“ das Talent, seine Selbstoptimierung auch noch mit der richtigen, also effektiv nachgefragten Qualifikation an einem hoch dynamischen Arbeitsmarkt auszurichten. Und das in einer Zeit, in der die ökonomische Entwicklung von Wandel und unabsehbaren Brüchen bestimmt wird.
Wem die Selbstoptimierung gänzlich misslang, fiel in eine neue Klasse, die eigentlich keine ist. Am untersten Rand entstand ein „Subproletariat“, früher wurde es das „Lumpenproletariat“ genannt, das aus dem normalen Erwerbsleben mehr oder weniger dauerhaft ausgeschieden wurde. In einer „Arbeitsgesellschaft“, wo die Arbeit Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens ist, kommt das als Dauerzustand dem Ausschluss aus der Gesellschaft gleich. Und als solche, als die „Ausgeschlossenen“ wurden sie vom Soziologen Heinz Bude auch als neue Sozialformation auf den Begriff gebracht, bevor er sie später auch noch als die „Überflüssigen“ identifizierte.
Das begann nicht erst mit den Hartz-Reformen, es begann mit der Suche nach Gründen für die anhaltende und steigende Massenarbeitslosigkeit und eines drohenden Zerfalls der Mitte nach unten. Dass es sich bei diesen Neulingen des Elends inmitten einer „Überflussgesellschaft“ weder um ein ökonomisches Struktur- oder gar Systemproblem noch um ein Armutsproblem handelt, machte der Zeithistoriker Paul Nolte in Beiträgen für DIE ZEIT deutlich. Unter dem Titel Das große Fressen (Nolte 2003) setzte er schon in die Untertitel die Kernpunkte seiner Analyse. „Nicht Armut ist das Hauptproblem der Unterschicht“ heißt es da, und der eigentliche Grund folgt sogleich: „Sondern der massenhafte Konsum von Fast Food und TV“. Geboren war ein neues Phänomen, das sich nun als die „Unterschicht“ öffentlichen Interesses erfreuen durfte.
Ihren Aufstieg im öffentlichen Bewusstsein verdankte sie zu einem nicht unerheblichen Teil dem Comedy-Star Harald Schmidt. Er fand in seiner beliebten „TV-Show“ zur allgemeinen Unterhaltung zwei Begriffe, die bald Karriere machten. Es waren die „Fettis“, die mit dezidiert schlechter Ernährung für ihr gesundheitswidriges Übergewicht sorgten und vor der Glotze hängend als bekannt „bildungsferne Schicht“ ihre „trash culture“ im „Unterschichtenfernsehen“ (RTL) konsumieren. An ihrem „Outfit“, ihren Tätowierungen, Piercings etc. konnte man sie in der Öffentlichkeit, die sie allerdings überwiegend mieden, dann sogleich erkennen. Dass Elemente dieser „trash-culture“ heute nicht nur auf den Fußballfeldern zu besichtigen sind, sondern bis weit in die Mitte hinein stilbildend wurden, konnte man damals noch nicht ahnen.
Jenseits dieser unerwarteten kulturellen Avantgardeleistung entdeckte die Forschung da weniger Exemplare eines ums Überleben kämpfenden Dienstleistungsproletariats, sondern Vorboten des Scheiterns eines Aufstiegs aus der Unterschicht in eine von Abstiegsängsten geplagte, aber doch noch „relativ homogenen Mittelschichtsgesellschaft“. Die ähnelte faktisch weniger einem Flachdachbungalow, als einer sich neu entwickelnden sozialen Pyramide. An den von Ulrich Beck entdeckten „Fahrstuhleffekt“, der alle in höhere Etagen führt, glaubte man unten sowieso, aber auch in der Mittelschicht nicht mehr. Statt Angleichung der Einkommen (und damit der Lebenschancen) wurde eine „Spreizung“ der Einkommen nicht nur registriert, sondern vom herrschenden Neoliberalismus zum ökonomischen Imperativ erhoben, damit sich „Leistung wieder lohnt“.
Das „abgehängte Prekariat“ bzw. die neue „Unterschicht“ wurden als Leistungsverweigerer entlarvt. Sie waren nicht die bemitleidenswerten „Loser“ in einem Kampf um die knapper werdende Ressource Arbeitsplatz, sondern als ein neues soziokulturelles Milieu kreiert, das aus seiner vermeintlichen Not eine Tugend machte. Entlastend für den Rest der Gesellschaft wurde festgestellt, es handele sich hier nicht um „Ausgeschlossene“ durch die Gesellschaft, sondern die Exklusion ginge, wie der Heinz Bude messerscharf bewies, von ihnen aus. Es ging hier nicht um „soziale Ungleichheit, auch nicht um materielle Armut, sondern um soziale Exklusion“. (Bude 2008, 13)
Die vollzieht sich nicht durch ein „vom herrschenden Norm- und Wertesystem“ abweichendes Verhalten, an dem sich diese Exkludierenden noch orientieren. Was die „Unterschicht“ charakterisiert, ist ein dem Norm- und Wertesystem der (bürgerlichen?) Mitte entgegenlaufendes Bezugssystem, das sich durch die Alimentierung durch den Sozialstaat zu einer eigenen Lebensform entwickelt. (Bude 2008, 120-127). Mit dieser selbstgewählten Exklusion, die Züge einer „Parallelgesellschaft“ annimmt, entfällt für den Rest der Gesellschaft eigentlich auch die Mitverantwortung dafür.
Die beeindruckende Leistung bestand darin, wie es gelang, diese neue Form der sozialen Ausgrenzung in ein selbstverschuldetes soziokulturelles Phänomen zu verwandeln. Um sie dennoch „bei Laune“ zu halten, empfahl die liberale „Süddeutschen Zeitung“ (und nicht etwa die BILD-Zeitung) das antik-römische Machtinstrument: „Brot und Spiele“. Da es für das „neue Subproletariat keine Perspektive eines sozialen Aufstiegs“ gebe, könnten sie zwar durch „Sozialleistungen befriedet“ werden, was aber eine „einheitliche Lebensform“ nach sich ziehe, die empirische Sozialforscher dann wie folgt beobachten können: „Die neuen Unterschichten sind kinderreich, kennen aber kaum mehr stabile Familienverhältnisse. Sie schauen eklatant mehr Fernsehen (…) und rauchen mehr, ernähren sich ungesund mit teurem Fast Food, was zur Übergewichtigkeit führt, ohne Sport zu treiben und konsumieren in großen Summen Unterhaltungselektronik“ (Mangold 2005) Es ist diese Art der Lebensführung und nicht materielle Armut, die diese „Unterschicht von der Gesellschaft ausschließt“. Aber es sei besser, sie auch mit „Unterschichtenfernsehen“ ruhig zu stellen, bevor Rechtsradikale dieses Sinnvakuum mit ihren Inhalten füllen, aber sie seien kein Fall für den Sozialstaat.
Die „Neue Mitte“ als Studiengegenstand
Die Suche nach der verloren gegangenen Mitte in den siebziger Jahren landete politisch zum Jahrhundertbeginn bei einer „Neuen Mitte“, die von der „modernen Sozialdemokratie“ erfunden wurde und in dem Schröder-Blair Papier zum Hauptadressaten ihres Modernisierungskurses erkoren wurde. Wie Paul Nolte (2004, 125) dazu treffend feststellte, war die „Neue Mitte“ „soziologisch“ gesehen, eine Leerstelle. „Ob die auf Sekurität bedachten Angestellten- und Dienstleistungsmilieus überhaupt reformwillig oder reformfähig seien – diese Fragen blieben ausgeklammert.“ Sie reduzierte sich „eher auf den Durchschnitt des Bestehenden. statt eine soziale Zielvision anzugeben“. (Nolte 2004, 125) Die Mitte erlebte in den unsicheren Zeiten einer stetig steigenden und zunehmend bestandsgefährdenden Massenarbeitslosigkeit die Ambivalenz von „sozialer Mobilität“.
Der Traum der Mitte ist der Aufstieg, der Alptraum der Abstieg und die Angst davor. Letzteres war aber das bestimmende Element dieser Zeit. Und die unter dem Namen Hartz-IV bekannten Sozialreformen, die Schröder den Beifall der „falschen Seite“ einbrachte und der SPD mehr Stimmen und Glaubwürdigkeit kostete als sie damit einfuhr, verschärften vor allem die Abstiegsängste. Denn es war insbesndere die vom Abstieg „gefährdete Mitte“, die mit diesem Reformwerk nun in einen sozialen und ökonomischen Abgrund sah. Bei steigendem Risiko ins Lager der Arbeitslosen zu fallen, gab es nun kein ökonomisches Auffangbecken mehr, sondern es drohte der tiefe Fall, der selbst ersparte Reserven auflöste. Was man als Steuerzahler vermeintlich an Sozialkosten einsparte, kostete einem im Ernstfall die Ersparnisse. Ein Teil der Mitte ritt sich in Gefahr und größter Not in den eigenen Abgrund.
Ein Jahrzehnt später, nachdem die Weltfinanzkrise schon fast vollendete Vergangenheit war, lebte die politisch heiß umworbene Mitte immer noch und schon wieder in einem Meer von Unsicherheiten. Die Welt teilte sich deutlicher in ein „Oben“ und „Unten“ (siehe dazu den sehr aufschlussreichen Sammelband der „Bundeszentrale für politische Bildung 2015“), und die Ungleichheiten im Kapitalismus (Bude / Staab 2016) nahmen auch nach der Finanzmarktkrise auf allen Ebenen weltweit wie national zu (Milanovic 2016). Thomas Pikettys nicht ganz unumstrittenen Studien lehrten in der Tendenz etwas, was schon gefühlt der Wahrheit entsprach: die absolute Herrschaft des „Matthäus-Prinzips“, also „wer hat, dem wird gegeben“ war zur allgemeinen Maxime geworden. (Piketty 2014) Die Mitte wähnte sich mit Blick auf die sich ausweitenden „prekären Arbeitsverhältnisse“ mit ihren „Leiharbeitern“, „Ein-Euro-Jobbern“ und sonstigen „Pseudo-Selbständigen“ Mittelstandsmenschen perspektivisch in einer „Abstiegsgesellschaft“, wie der Soziologe Oliver Nachtwey die „Rolltreppe nach unten“ zugespitzt nannte. (Nachtwey 2016)
Die „Mitte-Studien“, die sich auf die Folgen dieser sozialen und ökonomischen Entwicklungen auf die politische Einstellung, speziell auf die Erkundung „rechtsextremer“ Einstellungspotenziale in der Bevölkerung konzentrieren, erscheinen nach einigen Vorläufern seit 2002 bzw. 2006 im zweijährlichen Rhythmus im Auftrag der SPD-nahen „Friedrich-Ebert-Stiftung“ (FES). Sie werden seit 2014 durchgeführt vom „Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung“ an der Universität Bielefeld, im Anschluss an die vorherige Forschungsgruppe zur „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“. Die jeweiligen Ergebnisse werden unter dem Titel „Mitte-Studien“ im Bonner Dietz-Verlag publiziert.
Deren methodisches Problem liegt darin, dass die „Mitte“ nicht als sozialökonomisches Objekt mittels „objektiver Daten“ erfasst wird, sondern die Zuordnung erfolgt durch die Selbsteinschätzung sowohl als sozialökonomische wie auch politisch-kulturelle Mitte. Von daher vermögen die empirischen Befragungsergebnisse nicht mehr als Trendfaktoren über „Einstellungen“ im Längsschnittvergleich zu vermitteln. Die sind aber deutlich und beunruhigend zugleich. So kommt die jüngste Mitte-Studie von 2022/23 (Zick 2023) zu dem Resultat, dass die anhand von Aussagen messbaren „rechtsextremen Einstellungen stark angestiegen und weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt sind“. Die eigentlich aufregende Frage wäre, warum profitiert von den sozialen Problemen und Unsicherheiten die sich formierende Rechte und nicht die politische Linke?
Die sozialen und ökonomischen Erosionen der Mitte sind mit Blick auf die Spreizung der Einkommen und der extrem unterschiedlichen Vermögensverhältnisse schon mehrfach beschrieben worden, sie sind nicht neu, aber sie verschärfen sich. Das ist der grundlegende Unterschied zu der „nivellierenden“ Entwicklung in der ersten Phase der Bundesrepublik, der sich ab den siebziger Jahren durch den im 4. Teil beschriebenen Strukturbruch und Strukturwandel immer stärker durchsetzt. Es zeigen sich in der Mitte politische Erosionserscheinungen und vermehrt auch soziale. Welche Verschärfungen dieser Tendenz durch die gegenwärtig sich abzeichnende erneute Strukturkrise der deutschen Ökonomie, die hier nur als Krise des „Modells Deutschland“ als Exportnation erwähnt werden soll, auf die sozialökonomische „Mitte“ mit welchen politischen Folgen zukommen, bleibt abzuwarten.
In einem weiteren Sammelband zum Thema Gerechtigkeit und Gleichheit (Mau / Schöneck 2015) kreist ebenfalls fast alles um eine „Mitte“, von der Steffen Mau allerdings zuvor sehr treffend schrieb, begrifflich sei sie „unscharf, ja geradezu schwammig“. (Mau 2012, 13) Die Mitte bewegt sich in einem „Zwischen“ eines ebenso diffusen „Oben“ wie „Unten“ und aus dem „Irgendwo“ wird irgendwann ein „Nirgendwo“. Die Ausblendung sozialökonomischer Faktoren zugunsten kultureller, die dann empirisch auf einer Selbstbeschreibung beruhen, bringen eine Mitte hervor, die gerade kulturell keine einigende Homogenität auszeichnet. Ganz im Gegenteil finden die sich vertiefenden kulturellen Differenzen in der Gesamtgesellschaft ihren Kern in der Mitte. In Ermangelung einer einheitlichen bzw. dominanten Kultur, die mehr als ein Abbild der Gesamtgesellschaft darstellt als eine das Ganze zusammenhaltende Kraft, verliert die Mitte zunehmend ihre Funktion als Ort der „sozialen Integration“. Sie ist keine vermittelnde Kraft zwischen den Flügeln und Rändern, sie entwickelt in Zeiten des Umbruchs und der Krise mehr sich widersprechende Eigeninteressen. Als „hart arbeitende Mitte“ definieren sie sich zwar als die „Leistungsträger“, pochen aber immer mehr auf ihr Eigeninteresse und treten so immer weniger als Vermittlungsinstanz für „soziale Integration“ in Erscheinung.
Die Problematik einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Mittelklasse und die Schwierigkeiten, sie ökonomisch mit ihren kulturellen Differenzen zu verbinden und dann in eine umfassende Theorie der Gesellschaft einzubinden, spitzt Andreas Reckwitz auf die Überlagerung der Mitte in eine nach wie vor „traditionelle“ und eine breiter gefächerte „moderne“ zu, die sich sowohl sozialökonomisch wie kulturell verschieden von der neuen „Unterschicht“ abgrenzen und unterscheiden. (Reckwitz 2021) Hier deutet sich an, dass die Focussierung auf die Mitte eine analytische Sackgasse ist, wenn sie nicht eingebettet wird in eine erweiterte Theorie der Gesellschaft.
Klassengesellschaft ohne Klassen?
Die „Kulturalisierung“ der sozialen Strukturanalysen, die Bedeutung der Selbstbeschreibung und Selbsteinschätzung der Gesellschaftssubjekte an Stelle „objektiver“ Strukturanalysen, die den vertikalen Aufbau gegenüber dem horizontalen entlang anderer Sozialfaktoren hervorheben, ist in den letzten Jahren vermehrt kritisiert worden. In diesem Sinne ist Ulf Kadritzkes These, dass der „Abschied von der klassentheoretischen Perspektive, den jüngere Analysen zur gesellschaftlichen Mitte genommen haben, als Verlust von Erkenntnismöglichkeiten und zugleich als renovierte Ideologie“ anzusehen ist, nicht zu widersprechen. (Karditzke 2017, 18) Sie wurde auch von anderen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Begründungen unterstützt. (Wehler 2013, Butterwegge 2020, tendenziell auch von Reckwitz 2021 sowie dem amerikanischen Soziologen Erik Olin Wright 2023).
Im Zentrum steht dabei die Abkehr von den klassischen Strukturbegriffen wie Schichten und Klassen. Da gegenwärtig durch den Aufschwung der AfD die Frage nach deren Wählern und deren Motiven Hochkonjunktur hat, dabei aber eher Einstellungsmuster erkennbar sind als eine signifikante sozialökonomische Gruppenzugehörigkeit, liegt hier ein Kernthema soziologischer Forschung. Bemerkenswert ist die Erkenntnis, dass es der AfD gelungen ist, in der Arbeiterschaft erhebliche Stimmengewinne einzufahren, ohne dass sie deshalb die „neue Arbeiterpartei“ ist. (s. dazu Dörre 2024)
Was immer die Wahlanalysen der letztlich weltweit zu beobachtenden Rechtsentwicklung an Motiven und Interessen dafür erbringen, eine grundlegendere Frage wäre, ob das nicht eine durchaus diffuse Antwort auf ein tiefergreifendes „Gefühl“ einer Krise ist, die sich bislang nicht artikuliert. Es mehren sich Stimmen, die unter der Oberfläche der Symptomfeststellungen nach Krisengründen „moderner Gesellschaften“ suchen. Erste Ansätze einer solchen Suche nach einer zeitgemäßen „Gesellschaftstheorie“ (Reckwitz / Rosa 2021 und neuerdings Reckwitz 2024) bleiben aber noch der „Kulturanalyse“ der Gesellschaft als der „Moderne“, wenn auch als „Krise“ verpflichtet.
Eine „Theorie der Gesellschaft“ war seit den siebziger Jahren nach dem Sinken der Marx-Rezeption die alleinige Domäne der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Luhmanns Theorie leidet darunter, dass sie mit ihrer zentralen Annahme, hochkomplexe moderne Gesellschaften seien durch ihre funktionale Ausdifferenzierung durch gesellschaftliche Teilsysteme keine vertikal stratifizierten Gesellschaften mehr und zudem ultrastabil, angesichts der zahlreichen Krisen der real-existierenden kapitalistischen Systeme an Plausibilität eingebüßt hat. Es ist um sie jedenfalls auffallend still geworden.
Mit der Wiederentdeckung der sozialen Hierarchien rücken die Begriffe „Schichten“ und „Klassen“ wieder in das Blickfeld. Ein häufiges Argument gegen den Gebrauch des Klassenbegriffs ist, es ermangele den „Klassen“ insbesondere an Bewusstsein ihrer selbst. Das hieße aber der „kulturalistischen Wende“ vollends auf den Leim zu gehen. Ausgangspunkt kann nicht sein, was die Subjekte zu sein glauben, sondern nur, was sie faktisch sind. Nur weil sie sich keiner Klasse mehr zuordnen, heißt das ja nicht, dass es keine mehr gibt. Oder anders formuliert: Der Mangel an Klassenbewusstsein, also der „Klasse für sich“, ist ein schwerwiegendes und begründungswürdiges Faktum, aber kein Argument dafür, dass es deshalb auch keine „Klassen an sich“ mehr gibt. Die mittelalterliche Ständegesellschaft mit ihren abgestuften Rechten verliert ihre Faktizität auch nicht dadurch, weil Christen glauben, vor Gott seien alle Menschen gleich.
Es ist nicht entscheidend, ob der Begriff Klasse als solcher wieder zu Ehren kommt. Hans-Ulrich Wehler hat mit dem Verweis auf die Vermögensverhältnisse als einen wesentlichen Faktor der Ungleichheit auf den Klassenbegriff Max Webers insistiert. Nun hat Webers Klassenbegriff, anders als Erik Olin Wrjght behauptet, nur bedingt etwas mit dem Marxschen gemein. Weber unterscheidet zwischen Besitz- und Erwerbsklassen, aus denen sich verschiedene Lebensformen ableiten lassen. (Weber 1976, 177 ff.) Marx dagegen unterscheidet die Klassenzugehörigkeit im weitesten Sinne nach der Verfügungsgewalt über die lebensnotwenigen Produktionsmittel und leitet daraus weiterhin bestehende Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse ab, die in diesem Kontext bei Weber keine Rolle spielen. Marx war weder der Erfinder noch Entdecker der „sozialen Klassen“, der „Klassengesellschaft“ und auch nicht des „Klassenkampfes“, all das war von scharfsichtigen Analytikern der frühen bürgerlichen Gesellschaft vor ihm erkannt worden. Im Kern wies er der bürgerlichen Gesellschaft nach, dass sie trotz ihrer Überwindung der „ständischen Gesellschaft“ durch die Gleichstellung aller (Männer) vor dem Gesetz weder die Herrschaft des Menschen über den Menschen noch die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen überwunden hat.
Aber eine explizite Klassentheorie hat Marx nicht entwickelt. Wie dem unvollendeten Kapitel in dem von Friedrich Engels redigierten dritten Band des Kapitals zu entnehmen ist, war sie geplant, kam aber über die Benennung der drei Grundklassen mit in Aussicht gestellten etlichen Differenzierungen, nicht hinaus. „Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer bilden die drei großen Klassen der modernen, auf der kapitalistischen Produktionsweise beruhenden Gesellschaft.“ Ihnen entsprechen die unterschiedlichen Revenuequellen (Einkommen): Arbeitslohn, Profit und Grundrente. Das Manuskript bricht nach eineinhalb Seiten mit der Problematisierung dieser Einteilung durch weitere erforderliche Differenzierungen ab. Seither ist die Klassentheorie von Marx weitgehend ein im wahrsten Sinne unbeschriebenes Blatt, also für Dogmatiker eine gefährliche Leerstelle. (Marx 1894, 892 f.)
Wie heute eine den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen, bei Gleichheit konstituierender Strukturen, angemessene Klassenanalyse aussehen müsste, wäre eine Aufgabe intensiver Forschung, die den Weg für eine andere Sichtweise auf die krisengeschüttelten Gesellschaften der Gegenwart werfen könnte und Begriffe wie Macht, Herrschaft und Ausbeutung aus ihren Tabuzonen holen müsste. Sie könnte für sich reklamieren, dass die Ungleichheiten der weltweiten wie nationalen Vermögensbestände nicht ein Problem mit Blick auf die daraus resultierenden Luxusyachten sind, sondern ihre soziale und politische Bedeutung als Form von privater Herrschaftsausübung ins Blickfeld rücken. Als „Hyperreichtum“ erscheint dieses Phänomen langsam in einem anderen Licht und eine Figur wie Elon Musk könnte dabei zum tragischen Helden seines Größenwahns werden, weil er die Schattenseite solcher Reichtümer als Herrschaftsanspruch zum kollektiven Lernbeispiel machen könnte.
Auch auf den Etagen darunter lauern gesellschaftliche Kampffelder, die sich nicht dauerhafter Legitimität sicher sind. Das Problem der vererbten Reichtümer wird zunehmend zu einer Herausforderung für die Legitimation der Ungleichheit als Folge unterschiedlicher Leistungen. Es sei denn, es gelingt der Erbengemeinde noch, Erbe als besondere eigene Leistung herauszustellen, die besondere gesellschaftliche Gratifikation verdient. Welche Folgen das dann aber für die gleichen Lebenschancen als Versprechen der Gesellschaft hat, wird sich dann zeigen. Wenn Leistung sich wieder lohnen soll, sich aber bei Erben schon etwas lohnt, wofür gerade nichts geleistet wurde, dann steht es mit der Leistungsgesellschaft und dem Leistungsprinzip auf Dauer nicht zum Besten.
Soziologie ist eine Krisenwissenschaft. Die Krise birgt auch die Chance, durch Änderung der Blickwinkel zu neuen und vor allem besseren Erkenntnissen über die Realität unserer Gesellschaft und ihrer Probleme zu gelangen. Die Verhältnisse verlangen danach.
Zitierte Literatur:
Bude, H: (2014): Gesellschaft der Angst. Hamburg
Bude, H. (2008): Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft. München
Bude, H. / Staab, Ph. (Hg.) (2016): Kapitalismus und Ungleichheit. Die neuen Verwerfungen. Frankfurt a.M.
Bundeszentrale für politische Bildung (2015): Oben – Mitte – Unten. Zur Vermessung der Gesellschaft. Bonn
Butterwegge, Ch. (2020): Die zerrissene Republik. Weinheim Basel
Dörre, K. (2024): Die verlorene Ehre der Arbeiter, Bundeszentrale für politische Bildung / www.bpb.de/themen/parteien/rechtspopulismus/ 556662/die-verlorene-ehre-der-arbeiter
Kadritzke, U. (2017): Mythos „Mitte“ oder: Die Entsorgung der Klassenfrage. Berlin
Mangold, I. (2005): Das neue Subproletariat, Süddeutsche Zeitung v. 9.2.2005, S. 11
Marx, K. Das Kapital III. Band, in Marx-Engels-Werke Bd. 25, Berlin 1966
Mau, St. (2012): Lebenschancen. Wohin driftet die Mittelschicht? Berlin
Mau, St. / Schöneck, N.M. (Hg.) (2015): (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten. Berlin
Milanovic, B. (2016): Die ungleiche Welt. Migration, das Eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht. Berlin
Nachtwey, O. (2016): Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne. Berlin
Nolte, P. (2004): Generation Reform. Jenseits der blockierten Republik. München
Nolte, P. (2003): Das große Fressen, in DIE ZEIT v. 17. Dezember 2003
Piketty, Th. (2014): Das Kapital im 21. Jahrhundert. München
Reckwitz, A. (2024): Verlust. Ein Grundproblem der Moderne. Berlin
Reckwitz, A. (2021): Auf der Suche nach der neuen Mittelklasse – Replik auf Nils Kumkat und Uwe Schimank, in: Leviathan, 49. Jg. 1/2021, S. 33-61
Reckwitz, A. / Rosa, H. (2021): Spätmoderne in der Krise. Was leistet die Gesellschaftstheorie. Berlin
Schulze. G. 1992): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt / New York
Weber, M. (1976): Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen
Wehler, H.-U. (2013): Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland. München
Weiß, A. (2017): Soziologie globaler Ungleichheit. Berlin
Wright, E.O. (2023): Warum Klassen zählt. Berlin
Zick, A. / Küpper, B. (Hg.) (2021): Die geforderte Mitte. Bonn
Zick, A. (Hg.) (2023): Die distanzierte Mitte. Bonn