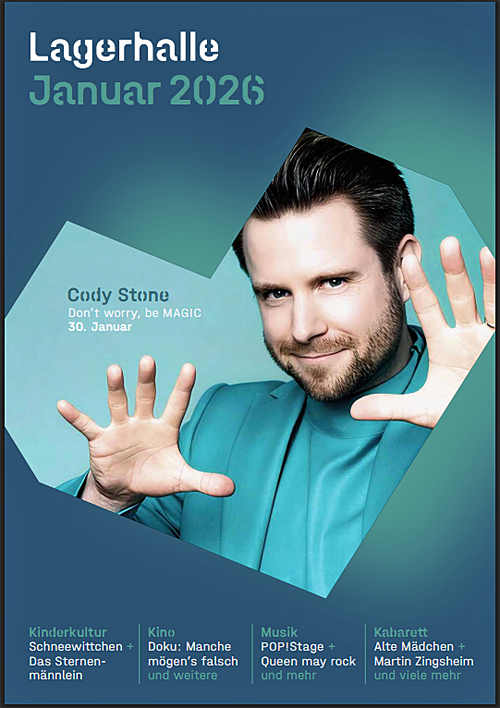Die Botschaft der Münchner Sicherheitskonferenz
Der Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance am Wochenende auf der „Münchner Sicherheitskonferenz“ wird als eine Zäsur der westlichen „Werte- und Sicherheitsgemeinschaft“ in die Geschichtsbücher eingehen. Nicht nur der Form, viel mehr dem Inhalt der Botschaft nach war diese Rede die einseitige Verkündigung des Endes der „transatlantischen Wertegemeinschaft“.
Selbst wenn man diese vielbemühte „Wertegemeinschaft“ schon immer kritisch und als Camouflage für Interessen gesehen hat, so war dies doch der offene Bruch zwischen den USA und Europa. Vance machte deutlich, dass weder die Interessen noch die Werte diesseits und jenseits des Atlantiks noch übereinstimmen. Sprachlos macht dabei die Verdrehung der Tatsachen. Die durch Trumps Vorgehen gefährdete „liberale Demokratie“ in den USA wird als Vorbild gepriesen gegen ein Europa, das diese Werte nach Vance nicht mehr erfülle, weil die Demokratie in Europa nicht von außen, sondern von innen bedroht sei. In Europa herrsche keine Meinungsfreiheit mehr und der Wille des Volkes werde systematisch durch „Brandmauern“ ignoriert.
Als ob die AfD schon die Mehrheit des Wahlvolkes hinter sich hätte. Um seine (und des US-Präsidenten) Sympathien mit der AfD zu unterstreichen, wurde deren Chefin Weidel die Gnade eines persönlichen Gesprächs mit dem US-Vizepräsidenten gewährt, die den offiziellen Staatsvertretern erspart blieb.
Über diesen maßlosen Stilbruch, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen und das im Wahlkampf bei „Verbündeten“, gehen wir einmal hinweg. Für Trump und seinesgleichen waren und sind solche „Anstandsregeln“ bzw. diplomatischen Verkehrsformen nur noch Relikte einer Vergangenheit, die man schnellstens vergessen sollte.
Tiefgläubige Transatlantiker glauben zwar immer noch, Trump sei nur eine „Episode“ der amerikanischen Politik, aber sie übersehen den durch ihn entstandenen Riss. Der Glaube an daran, die USA sei kraft ihres Institutionengefüges ein Bollwerk der liberalen Demokratie, ist nachhaltig erschüttert. Die USA stellen sich momentan sogar an die Spitze einer „libertär-autoritären“ internationalen politischen Bewegungen, die in der Summe ein neues internationales System schaffen sollen.
Wie das aussehen wird, davon gab die Münchner Sicherheitskonferenz selbst nur insofern einen Vorgeschmack, weil zum eigentlichen Konferenzthema, die künftige Sicherheitsstruktur Europas und der Welt, von Vance nichts zu erfahren war. Dazu gab es aber im Umfeld von maßgeblichen Vertretern der Trump-Administration, nicht immer im Gleichklang, der eine durchstrukturierte einheitliche Strategie erkennen ließe, aber in der Tendenz Signale, was in naher Zukunft zu erwarten ist.
Da ist zum Ersten der schon seit längerem erhobene Vorwurf, die Europäer – und für Trump allen voran sein Liebling Deutschland – seien verteidigungspolitische Trittbrettfahrer auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler. Stattdessen gebe man hier das Geld für „Sozialleistungen“ aus.
Was hierzulande lange als „Friedensdividende“ gefeiert wurde, fällt uns spätestens seitdem Ukrainekrieg als Verteidigungsschwäche auf die Füße. Dass nun eine Umkehr erforderlich sei, ist inzwischen zwar fast schon politischer Konsens, aber über die viel pikantere Frage über die Höhe dieser zu erbrkngenden Verteidigungsleistungen, trifft man auf den weit interpretierbaren Satz, die Europäer und insbesondere Deutschland müssen nun „liefern“. Der Rest ist Schweigen.
Zwar haben Trumps Lautsprecher in den letzten Tagen nicht die NATO selbst in Frage gestellt, aber zugleich deutlich gemacht, dass die USA ihre globale Grand Strategy nicht in Absprache mit „ihren Verbündeten“ entwickeln werden. Die Causa Ukraine ist das Exempel. Der US-Verteidigungsminister erklärte schon vor dem Beginn der nun schnell herbeigeführten Verhandlungen über (von „mit“ ist offiziell nicht die Rede) die Ukraine, was an Forderungen auszuschließen sei: Die Wiederherstellung der territorialen Einheit der Ukraine vor der Krim-Annexion und eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine.
Zwei elementare Forderungen für die Sicherheit der Ukraine, die bislang wie ein Mantra hochgehalten wurden, sind wahrscheinlich die Vorableistungen, die Trump Putin servieren musste, damit es überhaupt zu „Verhandlungen“ kommt. Offensichtlich ist es nicht Putin, der aus der immer wieder vom Westen geforderten Position der Schwäche um Verhandlungen bittet.
Was spielt sich hier ab? Was treibt Trump so zur Eile und zu einem solche Kurs, der die Ukraine lediglich zum Bauernopfer auf dem Schachbrett der Weltpolitik herabsetzt und Putin das Feld bereitet, gestärkt auf die große Bühne der Weltpolitik zurückzukehren. Dass Putin diesen Krieg völkerrechtswidrig vom Zaune gebrochen hat, davon ist in Washington seit Trump nicht mehr die Rede.
Ist Trump lediglich der Gejagte seines großmauligen Wahlkampfversprechens, in 24 Stunden den kostenintensiven Krieg in der Ukraine zu beenden? Vielleicht auch, aber es scheint nicht der entscheidende Punkt zu sein.
Trumps erstes Problem ist, dass sich Putin militärisch weder faktisch noch subjektiv in einer Situation sieht, dass er Verhandlungen benötigt. Anders als die Ukraine, die offensichtlich militärisch kurz vor dem Ende steht. Auf weitere amerikanische Waffenzufuhr kann sie nicht mehr hoffen und die europäischen sind nicht ausreichend, da es zudem an Soldaten fehlt. Also musste Putin etwas geboten werden, was ihn nicht aus Not an den Verhandlungstisch bringt.
Ein Deal mit den Amerikanern über die Aufteilung der seltenen Erden ist vielleicht ein Abfallprodukt, aber nicht der entscheidende Grund. Er ist die „Zahlung“ für die amerikanischen Kriegsinvestitionen. Aufschlussreich ist daran, dass die Kosten der Europäer dagegen nicht mit seltenen Rohstoffen „bezahlt“ werden, sondern Hilfen für den „Kampf für unsere Sicherheit“ waren.
Dass die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine als eine gesamteuropäische Angelegenheit da hinzukommen, ist bislang zwar selbstverständlich, aber eine völlig unbekannte Größe und atemberaubende Herausforderung.
Was Trumps Leute deutlich gemacht haben, ist lediglich, dass die USA zwar die Verhandlungen mit Russland über die Ukraine ohne Einbeziehung der Europäer führen, aber ansonsten das Ganze eine rein europäische Angelegenheit ist.
Anders formuliert: die künftige Sicherheit Europas interessiert die USA nicht mehr. Diese Teilung und Abnabelung der USA von Europa, teilweise auch als Arbeitsteilung gedacht, war schon in etlichen Strategiepapieren republikanischer Denkfabriken vor Trumps Amtsantritt zu lesen.
Was treibt die USA an?
Was allerdings mindestes zwei Fragen aufwirft: Wozu bedarf es dann noch der Nato und was verspricht sich die USA von diesem Vorgehen? Bezüglich der letzten Frage zeichnet sich eine andere mögliche strategische Linie der USA ab.
Nicht nur Trump hat China als den Hauptkonkurrenten, als den Herausforderer der amerikanischen Weltmachtstellung und auch möglichen Feind ausfindig gemacht. Da gibt es eine große Koalition in den USA seit Obama. Unterschiede mag es bezüglich der Methoden geben, wie man China „begegnet“.
Schließt man militärische Mittel, und sei es auch nur als „Druckmittel“, nicht aus, stellt sich das schlichte Problem, ob die USA gegen ein mit Russland verbündetes China, also einem Zweifrontenkrieg stark genug ist. Wobei die Annahme hinzu kommt, dass Russland nicht von den Europäern in Schach gehalten wird. Zunehmend wird unter Sicherheitsexperten spekuliert, dass Trump dieser doppelten Herausforderung entgehen will. Dafür bedarf es des Versuchs, Putin durch ein Zurückholen auf die Weltbühne als globale Regionalmacht mit Blick auf Europa zu neutralisieren und so in die Achse Russland-China einen Keil zu schlagen. Wie die Europäer dann mit einer eurasischen Landmacht Russland, deren Vorstellungen mindestens auf die Wiederherstellung der Einflusssphären von 1997, also vor der Osterweiterung der Nato, zielen, fertig wird, wäre dann für die rein pazifisch orientierte USA ein mehr oder weniger uninteressantes Nebengleis.
Für diese Annahme, dass es bei den anvisierten Verhandlungen um mehr als nur die Ukraine geht, spricht zudem die Tatsache, dass auch die Zukunft des Nahen Osten Gegenstand der Verhandlungen sein soll. Das heißt, hier verhandeln zwei Großmächte unterschiedlichen Kalibers über das Abstecken ihrer Interessen in relevanten Teilen der Welt. Anzumerken ist noch, dass auch China hier außen vor bleibt. Was Amerika freiere Hand im Pazifik bringt, erhält Putin als dominante Landmacht in Europa als erweiterten Spielraum, weil sich die USA zurückziehen und die europäische Sicherheitsordnung komplett den Europäern überlassen.
Den Grund dafür verriet Vizepräsident Vance in seiner Rede in München mit dem Hinweis, dass die Sicherheit der Europäer nicht von außen, sondern allein von innen bedroht sei. Also jedenfalls nicht von Putins Russland, was einem zunächst in Osteuropa, aber mittlerweile in Europa insgesamt geteilten Narrativ widerspricht. Das lautet so: Wenn Putin mit dem Ukrainekrieg Erfolg habe, dann werde er zum Erben Hitlers, er werde durch die Schwäche der anderen ermuntert seine gewalttätige imperiale Hand auf die nächsten Objekte seiner Begierde (Baltikum, Polen etc.) auszustrecken. Die anstehenden Ukraineverhandlungen der USA würden somit in der üblichen Beschreibung der historischen Parallelen zur Wiederholung der Fehler der „Appeasementpolitik“ von München 1938, und ausgerechnet Donald Trump schlüpft dann in die Rolle Neville Chamberlains. Wer hätte sich vor ein paar Wochen oder Monaten eine solche Verkehrung von Freund-Feind-Konstellationen vorstellen können?
Was in diesem Kontext dann noch die Funktion der Nato wäre, bliebe abzuwarten. Die Glaubwürdigkeit des amerikanischen Nuklearschirms darf man bezweifeln. Klar ist aber die Rollenverteilung und deren Folge: die weltpolitische Marginalisierung Europas. Dass dies die sehr wahrscheinliche Zukunft unseres Kontinents sein wird, werden die künftigen Geschichtsschreiber mit dem Datum des vergangenen Wochenendes in Verbindung bringen. Und Trump hat schon in seiner ersten Amtszeit deutlich gezeigt, was er von Europa hält. Nichts und er ermunterte wo möglich, die EU zu schwächen.
Und was ist die Reaktion dieser Europäer auf die erneute Herausforderung?
Sprachloses Entsetzen, Ratlosigkeit und verteidigungspolitischer Aktionismus. Beschwörungen der Gemeinsamkeiten und des Willens zur Selbstbehauptung in Verteidigungsfragen. Noch spekuliert man darauf, durch höhere Beteiligung an den Verteidigungskosten der Nato wenigstens irgendwie an den „Katzentisch“ der Verhandlungen über die Ukraine zu kommen. Aber der amerikanische Sondergesandte für die Verhandlungen mit Putin hat dem schon eine deutliche Absage erteilt. Interessiert hat sich Washington lediglich für eine von den Europäern zu stellende „Sicherheits- oder Friedenstruppe“ für die Einhaltung des ausgehandelten Abkommens. US-Truppenpräsenz für die Sicherung der Ukraine hat Washington vorab kategorisch ausgeschlossen. Was angesichts der Causa China auch naheliegt.
Wie Europa aus dieser schwierigen Lage „gemeinsam“ herauskommt, wo es so wenig „Gemeinsamkeiten“ gerade in Fragen einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gibt, bleibt vorerst ein großes Rätsel. Nur Zweckoptimisten erwarten gerade wegen dieser plötzlichen Veränderungen und Herausforderung aus der Not heraus eine zukunftsweisende Neugeburt eines geeinten Europas.
Letztlich handelt es sich mehr um Notwendigkeiten denn als nahe zu erwartende Realität. Vorerst ist wahrscheinlicher, dass die Begeisterung hierfür in Europa endlich eine einheitliche Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu entwickeln, begrenzt ist. Und angesichts der gewaltigen Kosten für eine eigenständige europäische Verteidigungslinie (egal, ob in oder zusätzlich zur Nato), die man mit Blick auf die Aufrüstung in Russland nicht auf Jahrzehnte berechnen kann, herrscht große Ratlosigkeit.
Damit hat Putin schon ein Ziel erreicht, denn jenseits des tiefgreifenden Streits in Europa über den Umgang mit der „russischen Gefahr“ für die „liberalen Demokratien“, die ja alle zusätzlich von innen durch starke rechtsextreme Parteien bedroht sind, könnten die anvisierten Verteidigungsausgaben Sargnägel für das werden, was eigentlich gerettet werden sollte: die Demokratie. Sie sollten wir, all ihren Mängeln zum Trotz, angesichts der rechten Alternativen, eigentlich doch lieber erhalten. Geht diese Demokratie an den militärischen Anforderungen gegen ein Russland zu Grunde, das aus einem anderen Kalkül freie Hand für Europa erhält?
Hölderlins Satz, in „größter Gefahr, wachse das Rettende auch“, ist zwar oft nur ein Satz der hoffenden Verzweiflung, aber die Verabschiedung von einem Amerika, das dabei ist, sich im Innern wie nach Außen grundlegend zu verändern, ist auch eine Chance für eine grundlegende Neubestimmung eines neuen, anderen Europas jenseits alter Strukturen und eingeschliffener Denkgewohnheiten. Denn eines steht fest: Ohne Europa als Einheit hat kein Staat Europas für sich eine eigene sichere Zukunft.