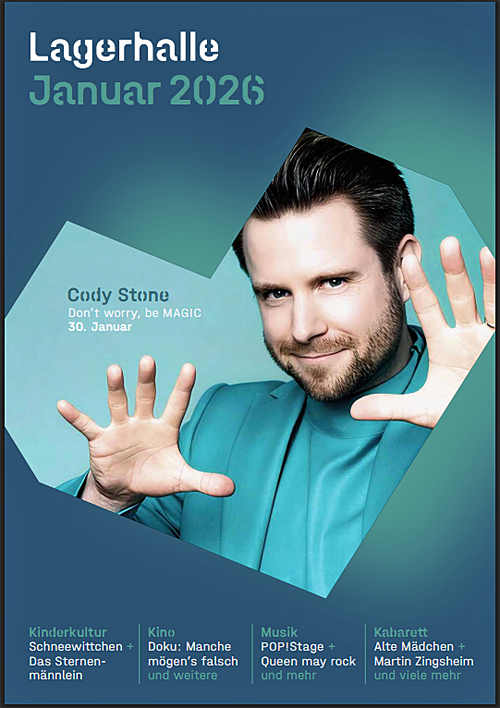Das Recht, das Naturrecht und die Gerechtigkeit
Recht und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe. Der Begriff des Rechts scheint wenig Probleme zu bereiten. Identifiziert man mit ihm doch ein geltendes, positives Recht, sei es Gewohnheitsrecht oder kodifiziertes Recht. In dieser Form ist das Gesetz das geltende Recht. Das positive Recht unterscheidet sich von allen anderen Arten des Rechts dadurch, dass seine Geltung erzwungen werden kann, ganz gleich wer oder was zur Durchsetzung des Rechts befugt ist. Moralische Rechtsprinzipien beziehen sich dagegen auf die „innere“ Einstellung handelnder Personen oder Individuen. Wenn beides zusammenfällt wird das auch als „Sittlichkeit“ bezeichnet.
Was bedeutet in diesem Kontext die Gerechtigkeit? Schon der Sprachgebrauch legt nahe, dass Recht zwar etwas Geltendes ist, aber die Frage nach sich zieht, ob es denn auch gerecht ist. Das Problem des Rechts hat Goethe im ersten Teil des Faust in der „Schülerszene“ auf den Begriff gebracht, als Mephisto, in Faustens Rolle des Lehrers schlüpfend, dem angehenden Schüler bei der Frage nach der Wahl der Fakultät, dessen Aversion gegenüber der „Rechtsgelehrsamkeit“ bestärkt:
„Ich weiß, wie es um diese Lehre steht,
Es erben sich Gesetz‘ und Rechte
Wie eine ew’ge Krankheit fort,
Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte
Und rücken sacht von Ort zu Ort,
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist leider! nie die Frage.“
Kürzer und schöner ist das dauernde Problem des Rechts nie formuliert worden. Das Recht ist die geregelte Form des Zusammenlebens der Menschen, ihr Verhältnis zueinander sowie zu den Dingen des Lebens und den Sachen, die uns umgeben und die wir herstellen. Ohne Regeln, also ohne Recht, ist das Zusammenleben der Menschen dauerhaft nicht möglich. Es gehört zum Alleinstellungsmerkmal des Menschen, dass er, anders als andere Lebewesen, die Form des Zusammenlebens nicht durch die Natur verordnet bekommt, sondern sie selber kraft seiner Intelligenz schaffen muss.
Mangels Festlegung durch die Natur ist der Mensch ein Kulturwesen. Und was die Formen des Zusammenlebens angeht, ist er kreativ. Er bringt eine Unzahl verschiedener Formen hervor und doch sucht er stets nach dem Recht. Diese Suche könnte man auch die nach der Gerechtigkeit nennen. Sie befragt das Recht, ob es in einem „höheren“, in einem reflektierten Sinne auch gerecht ist. Denn die Erfahrung lehrt, dass das Recht nicht überall gleich und unstet ist, sich ändert, auch weil sich das Leben ändert und nach neuen Regeln verlangt.
Wann die heute mit den Begriffen Legalität und Legitimität bezeichnete Zweistufigkeit des Rechts entstanden ist, wissen wir nicht genau, aber die schriftlichen Überlieferungen helfen uns hier etwas Klarheit zu gewinnen. Im Alten Testament werden die Rechtsnormen von einem allmächtigen Gott verkündet und verlangen bedingungslosen Gehorsam von den Gläubigen. Diskussionen und Begründungen für die Vielzahl der Vorschriften, die das Alte Testament festhält, sucht man dort vergebens.
Anders bei den alten Griechen. Hier entwickelt sich im fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung das, was man später Philosophie nennt. Deren Aufgabe ist es, danach zu fragen, warum etwas so ist, wie es ist und ob es so sein und bleiben soll, wie es ist. So auch, ob das, was geltendes Recht ist, im Lichte der Erfahrung und anderer Möglichkeiten nicht auch anders aussehen könnte. Damit wird die Frage aufgeworfen, was die dem Menschen zuträgliche und beste Form des Zusammenlebens wäre und das ist der Auftakt zur Suche nach der Gerechtigkeit, aus der sich dann das geltende Recht ableiten sollte.
Der Streit um die Gerechtigkeit ist zugleich die Frage nach der „guten Gemeinschaft“, nach dem „guten Leben“ und dem moralisch guten Handeln. In der Ethik verbindet sich das Handeln der Menschen mit der Gemeinschaft zu einer Einheit. Nur in einer „wohlgeordneten“ politischen Gemeinschaft, der Polis, ist ein gutes Leben und Handeln möglich. Die Suche nach der Antwort auf diese Herausforderung geht von der Möglichkeit aus, dass die Menschen durch Nachdenken sie finden können. Das ist im weitesten Sinne das Geschäft der Philosophie und die Ethik, jener Teilbereich, der uns zu vernünftigen Einsichten verhelfen soll.
Mit der Frage nach der Gerechtigkeit entsteht eine Zweistufigkeit des Rechts, sie impliziert die Erkenntnis, dass Recht Unrecht sein kann. Für diese Unterscheidung bedarf es einer (logischen) Instanz, die Maßstäbe dessen entwickelt, was die Scheidelinie zwischen Recht und Unrecht ist.
In der jüngsten Geschichte wurde der Menschheit in Gestalt des nationalsozialistischen „Dritten Reichs“ ein dramatisches Beispiel dafür präsentiert, das geltendes Recht „Unrecht“ ist. Vergleichbare Leuchttürme für das Gegenteil, einer „guten und gerechten Gesellschaft“, einem dem Paradies auf Erden auch nur nahekommendes Beispiel finden wir in der Realität noch nicht. Die gerechte Gesellschaft bleibt als Utopie vorerst ein Reservoir für Gedankenspiele, die Orientierungspunkte für das sein können, was als gesellschaftlicher Fortschritt gelten soll.
Die Suche nach einem festen Maßstab für das Recht angesichts unterschiedlicher und auch gegensätzlicher Rechtsauffassungen erfolgt bis heute unter dem missverständlichen Titel eines „Naturrechts“. Es erhebt den Anspruch, dem Recht eine feste und dauerhafte Grundlage zu verschaffen und so als „Appellationsinstanz“ zu dienen.
Philosophische Diskurse über Recht, Gerechtigkeit und das Naturrecht
Als „lex aeterna“, als „ewiges Recht“ trat schon in der Antike der Bezug auf die „Natur“ des Menschen auf. Er litt aber daran, dass sich daraus im Ansatz zwei gegensätzliche Bestimmungen der menschlichen Natur ergaben: die eine zielte auf die Rechtsgleichheit aller Menschen, weil wir von „Natur“ aus alle gleich seien, so die Schule der Stoiker. Dagegen opponierten im Namen der „natürlichen Ungleichheit“ der Menschen diejenigen, die es als gerecht ansahen, wenn den natürlichen Unterschieden der Menschen entsprechend auch die Rechte unterschiedlich verteilt würden.
Wer mit der Berufung auf die Natur unmittelbare Einsicht in deren Wesen, Festigkeit und Beständigkeit verbindet, sieht sich bei einem historischen Blick auf das „Naturrecht“ getäuscht. Man begegnet einem Reigen der Beliebigkeiten. Im Namen des Naturrechts wurde das (privilegierte) Recht des Stärkeren gefordert (am berühmtesten in Platons Politeia in der Person des Thrasymachos). In der Antike findet sich die dafür die Formel „suum cuique“ (jedem das Seine) als Begriff des Gerechten. Sie basierte auf einer nicht hinterfragten stratifizierten Gesellschaft als Folge der „natürlichen Ungleichheit“ der Menschen, wo jeder Person das „ihm Zukommende“ gemäß seiner gesellschaftlichen Position zusteht.
Herrscher und Reaktionäre beriefen sich auf ungleiche Rechte der Menschen, weil die Menschen verschieden, also ungleich sind. Die Natur des Menschen war nicht so eindeutig fassbar, dass sich daraus Antworten auf Fragen von Recht und Gerechtigkeit oder des guten Lebens ableiten ließen. Entscheidend und strittig war und bleibt, was die Natur des Menschen ausmacht.
Wie dem Naturrecht erging es seinem Äquivalent. Gerechtigkeit als Tugend füllte bei Aristoteles in der Nikomachischen Ethik ein ganzes Buch (V.) Bei den alten Griechen war die Gerechtigkeit philosophisch ein sehr hohes Gut, bei Platon (Politeia) sogar das höchste, etwas, was den Menschen noch verschlossen blieb und zu erkunden aufgegeben war. Das war das Geschäft der Philosophen, die deshalb nach Platon auch Könige werden sollten, wenn die Könige keine Philosophen würden.
Aristoteles unterscheidet dagegen zwei Arten der Gerechtigkeit: die justitia distributiva (austeilende Gerechtigkeit) als Maßstab der Güterverteilung, Vermögen, Ehre und der Stellung und die justitia redistributiva / commutativa als die ausgleichende Gerechtigkeit. Der Schwerpunkt ist hier das Strafrecht.
Später, im christlich geprägten Mittelalter bis in die frühe Neuzeit, entwickelte sich in Europa ein christliches Naturrecht, das bis in die Neuzeit feste Elemente wie die Gleichwertigkeit der Menschen als Ebenbilder Gottes tradierte, aber darüber hinaus dem Wandel der Zeiten auch Tribut zollte. Auch hier wurde die „Ewigkeit“ des Rechts relativiert. Mit derselben Entschiedenheit, mit der die einen die Gleichheit aller forderten, verteidigten die Anderen die bestehende ständische Ordnung als Gottes Wille. Die Herrschenden beriefen sich bei ihrer Verteidigung der Ungleichheit der Rechte auf dasselbe Evangelium wie beispielsweise Thomas Müntzer, der daraus das gleiche Recht für alle als die Mission Christi herauslas.
Das moderne Naturrecht und seine Kritiker
Mit der Aufklärung erhielt das Naturrecht eine säkulare Form und wurde eigentlich zu einem „Vernunftrecht“. Mit dem Anspruch, der Vernunft zu genügen, wurde das bestehende, tradierte Recht einer schonungslosen Kritik unterzogen. Es handelte sich hier nicht mehr um eine Kritik innerhalb einer akzeptierten Rechtsordnung, sondern um eine Fundamentalkritik im Geiste einer völlig anderen Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellung.
Das Kernstück dieses „revolutionären Naturrechts“, das wie kein anderes die Moderne auszeichnet, ist die Weiterentwicklung des Prinzips der Gleichwertigkeit zur Rechtsgleichheit aller Menschen und Bürger im Verbund mit individuellen Freiheitsrechten. Freiheit und Gleichheit aller sind die Säulen des neuen Naturrechts, begründet allein durch die Vernunft. Dieses „Vernunftrecht“ wurde zum Wegbereiter der neuzeitlichen Revolutionen und schuf die Grundlage dafür, dass die Rechtsgleichheit aller zum positiven, gesetzten Recht wurde.
Das gilt unabhängig davon, dass in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 noch ein Bezug auf eine höhere Macht anklingt. Im Namen einer Wahrheit, die als Evidenz auftritt, wird dort erklärt, dass man als „wahr“ erachte, dass alle Menschen von „ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit.“ Die Französische Revolution bezieht sich explizit auf die neuzeitliche Begründung des Naturrechts als „Vernunftrecht“ und vollzieht den Generalangriff auf das herrschende „Gewohnheitsrecht“. „Der Akt, mit dem in Amerika wie in Frankreich die Positivierung des Naturrechts eingeleitet wurde, war eine Deklaration von Grundrechten.“ (Habermas 1963, 92)
Bei aller Gemeinsamkeit sind die Unterschiede gravierend. Die Berufung auf das moderne Naturrecht erfolgt in der Französischen Deklaration im vorbereitenden Geiste der entwickelten Philosophie des Gesellschaftsvertrages. Ob und wieweit Rousseaus Einfluss sich da geltend machte, ist bis heute umstritten. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung beruft sich dagegen auf einen „Common sense“, der einer Wunschvorstellung der Lockeschen Philosophie ähnelt.
Dass die Französische Revolution politisch wirksamer blieb, lag vor allem daran, dass die amerikanischen Kolonisten „ihre Emanzipation vom Mutterlande nicht strikt im Bewußtsein einer Revolution vollzogen. Die Rede von der amerikanischen Revolution hat sich erst post festum eingestellt; aber bereits vor dem Ausbruch der Französischen Revolution ist sie in den Sprachgebrauch eingedrungen.“ (Habermas 1978, 92 f.) Insofern ist es auch nachvollziehbar, dass Hegel die „Morgenröte“ der Menschheitsgeschichte, mit der die Idee zur Wirklichkeit drängt, allein in der Französischen Revolution erkennt und feiert.
Der Inhalt des modernen Vernunft- bzw. Naturrecht wird deutlicher in seiner Frontstellung zur so genannten „Historischen Rechtsschule“, die in dem Alter, der Tradition, dem „organischen Wachstum“ der bestehenden besonderen Rechtssysteme deren Legitimität erkannte. Bevor Carl von Savigny, der Begründer dieser „Historischen Rechtsschule“, daraus eine ganze Rechtsideologie machte, fand man in dem Osnabrücker Rechtspraktiker Justus Möser einen glühenden Anhänger dieser Vorstellung. Möser war ein entschiedener und bedeutender Verteidiger des organisch gewachsenen Lokalrechts. Er sah in dem drohenden absoluten Zentralismus durch die Vereinheitlichung des Rechts an Stelle der historisch gewachsenen Rechtsformen, die nun unter der Fahne der Vernunft weichen musste, nur negative Folgen, wenn das „Besondere“ zum Opfer des Diktats des „Allgemeinen“ wird. (s. dazu Wortmann 2024, 48 ff.)
So wie es nur eine Wahrheit gibt, konnte es im Namen der Vernunft auch nur ein Recht geben. Dieser Streit zwischen den Verteidigern der alten feudalen Rechtsordnung wie Justus Möser und den „Revolutionären“ zeigt, dass das Recht als Form der Ordnung des Zusammenlebens keine von der Gesellschaft und ihren Interessen getrennte Sphäre ist.
Die Frontlinien verliefen damals so, dass das „moderne Naturrecht“ die bestehenden, historisch gewachsenen Rechtsordnungen vor den „Richterstuhl der Vernunft“ zitierten und nach ihrer Legitimität befragten. Und die Vernunft als die herrschende Instanz befand zudem, dass von diesem Rechtssystem der „abgestuften“ Hierarchie von Privilegien nur wenige ohne adäquate Verdienste profitierten. Da es außer dem Verweis darauf, dass es sich eben um „gewachsenes Recht“ handele, für diese Rechtsungleichheit unter den Menschen keine legitimierende Begründung (mehr) gab, geriet dieser ideologische Überbau der alten Feudalordnung in eine dramatische Legitimationskrise. Allerdings vor allem deshalb, weil die Forderung nach der Rechtsgleichheit aller Menschen auf das entschiedene Interesse des Dritten Standes, dem Bürgertum, wie auch des gesamten Populus traf.
Hier bewahrheitete sich die Erkenntnis von Karl Marx, dass sich die „Idee stets blamiert, wenn sie sich vom materiellen Interesse“ entfernt. Das Bürgertum trat nun im Namen der Vernunft als der Befreier der Menschheit auf. Für Möser und Co. war das zwar eine leere Phrase, aber mit der Beseitigung aller ständischen Privilegien und Besonderheiten weckte das Bürgertum damit ungewollt zugleich Begehrlichkeiten für die zahlenmäßig noch größere Masse des rechtlosen Volkes, die nun als „Gleiche“ nicht nur die Gleichheit vor dem Gesetz, sondern auch noch die soziale Gleichheit zu fordern begannen. Diese Entwicklung demonstriert, dass das Recht nicht nur eine sich wandelnde Größe nach Wertmaßstäben ist, sondern durch die sich wandelnden Interessen der gesellschaftlichen Stände und Klassen geprägt wird.
Was nun als „neue Wahrheiten“ proklamiert wird, ist zwar im historischen Kontext etwas, was von großen Teilen der Aufklärung intellektuell teilweise vorausgedacht wurde, aber ohne die sozioökonomischen Veränderungen in den Gesellschaften keinen fruchtbaren Boden gefunden hätte. Dass das „moderne Naturrecht“ den Werterelativismus nicht überwand, zumal es auf keine transzendentale Begründung zurückgreifen konnte, gehört zu den Hypotheken der Moderne. Ob daraus zugleich unausweichlich der Weg in den „Nihilismus“ folgt, wie die mehr oder weniger reaktionären Kritiker behaupten, ist bis heute die ständige Begleitmusik der Moderne. Aber es gehört auch zu deren bitteren Erkenntnissen, dass alle Versuche, den faktischen Wertepluralismus mit (neuen) „absoluten Wahrheiten“ zu überwinden, auf Sand gebaut sind. Die neuzeitliche Ideologie des Konservativismus weiß davon ein Lied zu singen.
Von Gerechtigkeit war bei alledem vorerst weniger die Rede. Nach Ernst Bloch gehörte die „Gerechtigkeit“ zu den „unsicheren Größen des Naturrechts“ und befand, dass sie „dem Naturrecht entbehrlich“ sei. Auch in Kants Rechtsphilosophie spielt sie keine zentrale Rolle. (Bloch 1961, 99) Das gilt eigentlich für die gesamte Aufklärungsphilosophie und bei Kant kommt hinzu, dass in seiner Rechtslehre das jeweils geltende positive Recht als Ordnungsinstanz so bedeutend ist, dass „Widerstand“ dagegen kategorisch ausgeschlossen wird. (s. dazu Wortmann 2024, 189 ff.)
Lob des positiven Rechts gegen die Irrlehren der Gerechtigkeit
Die Gerechtigkeit als höchstes Gut kann allerdings auch eine potenziell schreckliche Seite zur Entfaltung bringen. Die machte Heinrich von Kleist in seiner Novelle „Michael Kohlhaas“ zum Thema. Darin beschreibt er eindringlich, wie ein rechtschaffener Mann als Roßhändler Unrecht erleidet und sich im Kampf gegen die weiteren Folgen dieses Unrechts so empört und radikalisiert, dass er mit allen Mitteln für die Gerechtigkeit kämpft und dabei selbst zum Mordbrenner wird. Hier schlägt der Kampf für Gerechtigkeit als Prinzip ins Gegenteil um.
Kleist lässt den Gerechtigkeitsfanatiker am Ende, bevor er seine Strafe für seine Verbrechen büßen muss, noch erfahren, dass er sein ursprünglich eingefordertes Recht auf dem legalen Weg erhalten hat. Bemerkenswert ist, dass Kohlhaas nicht gegen geltendes Recht im Namen eines höheren Rechts, einer anderen Gerechtigkeit kämpft, sondern für sein Recht innerhalb der geltenden Rechtsordnung, das ihm durch Rechtsbeugung zunächst verwehrt wurde.
Gegen den Wahn der „absoluten“ Gerechtigkeit, wofür Michael Kohlhaas als literarische Figur stellvertretend genannt sei, steht realiter in der Französischen Revolution die Person Maximilian Robespierres, der mit seinem „Wohlfahrtsausschuss“ in der Zeit der Jakobinerherrschaft sein blutiges Unwesen trieb. Dagegen erhob sich ein Widerstand, der nicht das alte Recht verteidigte, sondern den Vorläufer eines Rechtspositivismus verkörperte, der im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht nur in Deutschland zur herrschenden Rechtslehre wurde.
Sie fragten nicht mehr nach dem „Wesen“ oder der „Natur“ des Rechts. Dergleichen galt ihnen als Rückfälle in metaphysische Spekulationen, die ihren Halt für die Fundierung eines „ewigen“ Rechts vergebens suchen, weil alle „tieferen“ Quellen problematischen Ursprungs sind, heißen sie Gott, Sittlichkeit oder „ewige Werte“. Wenngleich sich das positive Recht auch als „Unrecht“ entpuppen konnte und einen Rechtspositivisten in Argumentationsnöte versetzte, konnte sie darauf verweisen, dass die Fundamente bei den Suchern nach dem „natürlichen Recht“ auch nicht wesentlich fester waren.
In der Moderne haben namhafte Juristen, herausragend hier der Österreicher Hans Kelsen (1881 – 1973), den Rechtspositivismus (er nannte es „Reine Rechtslehre“) offensiv gegen alle Versuche einer Wiederbelebung jeglicher Art von Naturrecht verteidigt. Im Zentrum stand die Zurückweisung einer Begründung des Rechts mit einem Bezug auf die Gerechtigkeit. „Gerechtigkeit ist ein irrationales Ideal. So unentbehrlich es für das Wollen und Handeln des Menschen sein mag, dem Erkennen ist es nicht zugänglich. Diesem ist nur positives Recht gegeben oder richtiger, aufgegeben.“ (Hans Kelsen 1934, 28) Der Kampf gegen Kelsens Rechtspositivismus dagegen erfolgte aus unterschiedlichen Positionen im Geiste einer Sozialmetaphysik, die ein „ewiges Recht“ für sich reklamierten.
Sie erhielten nach 1945 im Versuch einer Wiederbelebung des Naturrechts angesichts des offenkundigen Unrechtsstaates in Nazi-Deutschland einen kurzen Frühling. Die Konfliktlinien waren dabei unübersichtlich. Einerseits war der Rechtspositivismus im Laufe des 19. Jahrhunderts formell Träger einer liberal-humanitären Demokratie gegen „atavistische“ Rechtsvorstellungen aus vormodernen Zeiten geworden, andererseits bereitete er mit seinem „Werterelativismus“ den Boden für den totalen Staat und sein „Unrechtsregime“, der rein formal als „Rechts- oder Gesetzesstaat“ gelten konnte.
Um diesem Legitimationsversuch etwas entgegen zu setzen, rief man das „Ewige Naturrecht“ in Erinnerung. Ohne eine solche fundamentale Begründung des Rechts, verliere jede Rechtsordnung ihre Berechtigung, denn auf Basis des Rechtspositivismus war das Unrecht nicht zu fassen. Schlimmer noch war er ja der Boden dafür. (s. dazu Topitsch 1964, 26) So wurde eine Wiederbelebung eines Naturrechts insgesamt als einziger Ausweg des kulturellen Versagens der „Moderne“ deklariert, um die Folgen des Werterelativismus, der zwangsläufig im Nihilismus ende, zu überwinden. Das war als vermeintliche Überwindung des Grauens des Nazismus und Faschismus äußerst populär.
Rechtspositivisten sahen dagegen im deutschen Faschismus Rückgriffe auf „alte germanische Rechtsgüter“, wogegen der Rechtspositivismus als liberal-demokratisches Gegenmittel in Stellung gebracht wurde. Das war insofern ein Irrtum, weil die Nazis mit solchen „Atavismen“ zwar zuweilen spielten, faktisch fußte das NS-Recht auf einem reinen „Dezisionismus“ der Macht, den der einflussreichste „Rechtsanwalt“ der Nazis, der berühmt-berüchtigte Staats- und Völkerrechtler Carl Schmitt, mit einem Aufsatztitel auf den Begriff brachte. „Der Führer schützt das Recht“ (Schmitt 1934) Das bedeutet, die Entscheidung und der entscheidende Mensch sind aus sich selbst heraus die Begründung und Rechtfertigung, mithin ein Freibrief für reine Willkür.
Die in der Begründung des (geltenden) Rechts angelegte Frage, wie dieses dann wiederum begründet werden könne, gerät dadurch in einen Zirkelschluss, dass es dafür keine verlässliche bzw. allgemein akzeptierte Bezugsgröße gibt. Gott und Religion wären zwar die ersten Anwärter, sind aber keine evidenten Instanzen mehr, sondern bedürfen selbst der Begründung. Das sich selbst so nennende Naturrecht relativiert sich dadurch, dass es nach der „Gerechtigkeit des Rechts“ fragt und damit letztlich nur eine Problemverschiebung ist. Denn nun beginnt der Disput darüber, was denn Gerechtigkeit sei.
Und damit befinden wir uns in einer Begründungsproblematik, die die gesamte Neuzeit durchzieht. Sie teilt das Schicksal mit der Frage und dem Suchen nach festen „ewigen“ Werten, die dem „Werterelativismus“ entgegengesetzt werden könnten. Von diesem Faktum ausgehend, geraten aber alle „festen“ („materialen“ wie Max Scheler sie nennt) Werte, die der drohenden Historisierung und damit Relativierung entzogen werden sollen, selbst in den Verdacht nur Produkt einer bestimmten zeitlich begrenzten Phase der Geistesentwicklung zu entspringen.
Mit der gleichen Argumentation wird auch der „Historismus“ als eine „seinsgebundene“ Ideologie (so in der Terminologie der Wissenssoziologie Karl Mannheims) entlarvt. (s. dazu Mannheim 1929 sowie Wortmann 2024, 100 ff.) Der soziologische Gewinn oder Verlust besteht lediglich darin, dass der Wertehimmel hier als von Interessen geleitete Ideologie geerdet wird. Was dann in die Aporien eines „totalen Ideologienverdachts“ und damit in eine andere Variante des „Nihilismus“ führt, der – wie beim Ausgangspunkt dieser Debatte bei Thomas Hobbes – in der Erkenntnis endet, dass nicht die Wahrheit das Recht setzt, sondern das mächtigste Interesse.
Ob im Artikel 1 des GG mit dem Satz von der „Unantastbarkeit der Würde des Menschen“ als Basis der gesamten Rechtsordnung eine Lösung für die Überwindung des Streits zwischen Rechtspositivisten und Naturrechtlern gefunden wurde, ist zwar nicht entschieden. Skeptiker wenden hier ein, eigentlich sei das eine Problemverlagerung, weil nun alles auf die Interpretation der „Würde“ delegiert wird. Aber gleichwohl lässt sich sagen, dass sich diese Formel als Basis des Rechtssystems bislang bewährt hat.
Das ändert aber nichts daran, dass rechtssoziologisch betrachtet die Moderne ein anderes Legitimationsprinzip favorisiert. Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann verweist darauf, dass die „funktional ausdifferenzierten Gesellschaften der Moderne“ die unbeantwortbare Frage nach dem Recht suspendieren und durch eine „Legitimität durch Verfahren“ ersetzen. (Luhmann 1969) Die Legitimität des Gesetzes erfolgt durch das rechtstaatlich korrekte Verfahren seines Entstehens und seiner Kohärenz zur Rechtsdogmatik. Mehr als das sei als Konsens nicht mehr zu erwarten.
Die Kehrseite ist allerdings, dass allen Begründungsproblemen zum Trotz, die Frage nach der „Gerechtigkeit des Rechts“ unausrottbar ist. In Krisenzeiten mindestens meldet sich vermehrt das Volk und fragt nach der Gerechtigkeit. Die Antworten mit dem Verweis auf die Korrektheit von Verfahren reicht nicht aus, wenn sich der „Sinn“ des Rechts als knappe Ressource erweist. Das ist der Stoff, aus dem sich schleichende bis abrupte Legitimationskrisen ergeben, die durchaus bestandsgefährdend werden können.
Aber damit begeben wir uns auf ein leicht verändertes Terrain. Was hier als krisenbegründendes Defizit eruiert wird, ist nicht ein Mangel, der nach einem übergeordneten Naturrecht lechzt. Es ist etwas, was als „Gerechtigkeitslücke“ erscheint. Es ist keine feste, messbare Größe. Es ist vielmehr etwas eher amorphes, es ist ein sich regendes Gerechtigkeitsgefühl mit der subjektiv sich verbreitenden Wahrnehmung, hierzulande gehe es nicht mehr mit rechten Dingen zu. Das kann zwei Gründe haben: Zum einen, dass wachsende Teile der Gesellschaft sich an vertraute Gerechtigkeitsstandards nicht mehr halten oder dass die bislang geltenden nicht mehr geglaubt werden und einer grundlegenden Änderung bedürfen. Das hieße, dass das ganze Recht mehr oder weniger als nicht gerecht disqualifiziert wird. Das wäre denkbar die Stunde einer politischen Revolution.
Im Zentrum steht da die Frage nach der „sozialen Gerechtigkeit“.
Literatur
- Aristoteles: Nikomachische Ethik
- Bloch, Ernst (1961): Naturrecht und menschliche Würde. Frankfurt a.M.
- Breuer, Stefan (1983): Sozialgeschichte des Naturrechts. Opladen 1983
- Ebert, Thomas (2015): Soziale Gerechtigkeit. Bonn
- Ebert, Thomas (2012): Soziale Gerechtigkeit in der Krise. Bonn
- Habermas, Jürgen (1978): Naturrecht und Revolution (1963), in: ders. Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien. Frankfurt a.M. 1978, S. 89 – 127
- Hayek, Friedrich August von (1977): Demokratie, Gerechtigkeit und Sozialismus. Tübingen
- Höffe. Otfrried (2001): Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. München 2007, 3. Aufl.
- Kelsen, Hans (1934): Reine Rechtlehre Tübingen 2008
- Kelsen, Hans (1953): Was ist Gerechtigkeit? Stuttgart 2024
- Maihofer, Werner (1969): Ideologie und Recht, in ders. Hrsg. Ideologie und Recht. Frankfurt a.M. 1969, S. 1 – 36
- Mannheim, Karl (1929): Ideologie und Utopie. Bonn
- Mandeville, Bernard (1724): Die Bienenfabel oder private Laster, öffentliche Vorteile. Frankfurt a.M. 1968
- Platon: Politeia (Der Staat)
- Rawls, John (1971): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M. 1975
- Rawls, John (1992): Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989. Frankfurt a.M. 1992
- Rawls, John (1993): Politischer Liberalismus. Frankfurt a.M. 1998
- Rawls, John (2001): Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuentwurf. Frankfurt a.M. 2003
- Rosenbaum, Wolf (1972): Naturrecht und positives Recht. Neuwied-Darmstadt
- Sandel, Michael J.: (2009) Gerechtigkeit. Wie wir das richtige tun. Berlin 2013
- Schmitt, Carl (1934): Der Führer schützt das Recht, in: ders. Positionen und Begriffe. Berlin 1988 (1940), S. 199 – 203
- Smith, Adam (1776): Der Wohlstand der Nationen. München 1974 (Übers. H. C. Recktenwald)
- Strauß, Leo (1953): Naturrecht und Geschichte. Stuttgart 1955
- Topitsch, Ernst (1964): Einleitung zu Kelsens „Aufsätze der Ideologiekritik“. Neuwied 1964, S. 11 – 27
- Wortmann, Rolf (2024): Kant gegen Möser oder Aufklärung statt Traditionalismus. Osnabrück
- Wortmann, Rolf (2024b): Die Mitte als Mythos und Problem, in: Osnabrücker Rundschau: Teil 1; Teil 2; Teil 3; Teil 4 und Teil 5.