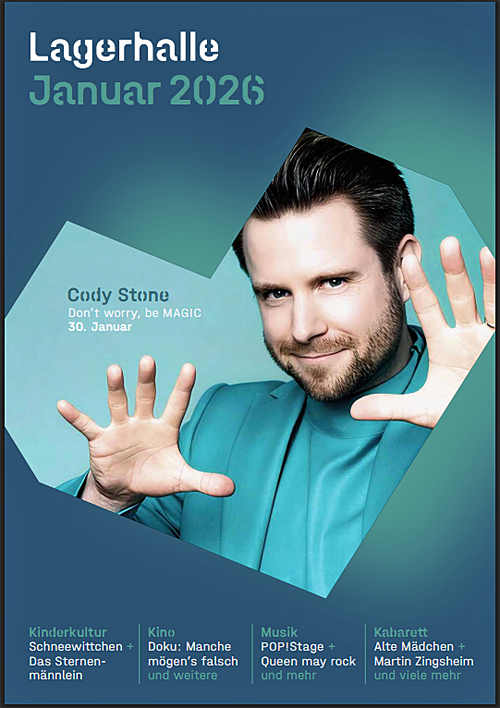Der Streit um die „soziale Gerechtigkeit“
Eine wichtige Rolle spielt die Frage nach der Gerechtigkeit im Strafrecht. Hier geht es um die „gerechte“ Strafe. Sie steht auch im Zentrum des „gerechten“ Handelns eines jeden einzelnen und im sozialen Miteinander und mündet in der Suche nach der gerechten Gesellschaftsordnung. Hier geht es um die „politische“ Ordnung und die Rechte der Menschen sowie um die „gerechte“ Verteilung der Güter. Letzteres umfasst die Frage nach einer gerechten Wirtschaftsordnung. Und hier vollzieht sich ein epochaler Wandel im 18. Jahrhundert.
Die Beseitigung der Gerechtigkeit aus der Ökonomie
Bis in die Neuzeit hinein war die Ökonomie von moralischen Regeln bestimmt. Im Mittelpunkt stand neben dem „kanonischen Zinsverbot“ die Frage nach dem „gerechten Preis“. Das „kanonische Zinsverbot“ verschwand mit der Ausdehnung der Geldwirtschaft als funktionale Notwendigkeit. Der Streit um den „gerechten Preis“ erledigte sich mit der Durchsetzung der freien Marktwirtschaft. Die Begründung dafür lieferte insbesondere Adam Smith in seinem 1776 erschienenen wegweisenden Buch über den „Reichtum der Nationen“. Mit seiner Theorie, der Preis einer Ware (die darin enthaltene Lehre vom Arbeitswert als preisbildend unterschlagen wir hier) ergebe sich aus dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage, vollzieht sich eine Entmoralisierung der Ökonomie. Die Marktpreise sind Ergebnis eines rein ökonomischen „Gesetzes“ und kennen kein moralisches Gebot mehr.
Der Markt ist der Ort, wo sich in einer arbeitsteiligen Tauschgesellschaft freie und gleiche Akteure als Käufer und Verkäufer begegnen und freiwillig Verträge abschließen. Diese Freiwilligkeit und formelle Rechtsgleichheit der Vertragsschließenden ist die Basis für die Ideologie des „gerechten Tausches“ und der sich daraus herleitenden Bestimmung des „gerechten“ Marktpreises. Als weiteren Vorteil dieses Verfahrens nennt Adam Smith, dass diese Orientierung am Preis auch weitere Moralisierungen neutralisiert. Der sich am Preis orientierende Tausch interessiert sich zum Beispiel nicht mehr dafür, welcher Konfession der jeweilige Tauschpartner angehört, entscheidend ist, dass der Preis stimmt.
Kratzer erhielt die „Tauschidylle“ des Adam Smith und seiner Anhänger dadurch, dass die Vertragschließenden zwar formell Gleiche waren, die nicht mit Gewalt gezwungen wurden, zu kaufen oder zu verkaufen, aber vernachlässigt wurde der durchaus vorhandene „stumme Zwang“ der Ökonomie. Der ergibt sich aus den asymmetrischen Machtstrukturen der Tauschakteure. Nicht alle Verträge werden auf „Augenhöhe“ abgeschlossen. Prominente Beispiele sind die „asymmetrischen“ Verträge zwischen Kapitaleignern und freien Lohnarbeitern oder zwischen Vermietern und Mietern, denn das lebenswichtige Dach über den Kopf zu benötigen ist etwas anderes, als den begehrten Mietzins zu erhalten.
Jenseits dieses unterschiedlich bewerteten Faktums herrscht in der (bürgerlichen) Wirtschaftslehre insofern Einigkeit, dass der „gerechte Preis“ ausgedient hat. In der späteren Zuspitzung entfallen damit auch alle weiteren Fragen nach der Gerechtigkeit ökonomischer Ergebnisse, die sich aus dem Konkurrenzmechanismus freier Märkte ergeben. Friedrich August von Hayek, einer der maßgeblichen Vordenker des Liberalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bestimmte die Suche nach der „sozialen Gerechtigkeit“ als eine unsinnige und nicht beantwortbare Frage, weil es dafür keinen ethischen Maßstab geben könne.
Hayek nennt „soziale Gerechtigkeit“ einen „Atavismus“ (Hayek 1977, 23). Es sei ein Wort, das für eine „Gesellschaft freier Menschen (…) überhaupt keinen Sinn hat.“ Grund für seine Präsenz seit hundert Jahren sei der „Erfolg der Bemühungen, Ansprüche einzelner Gruppen auf einen größeren Anteil an den guten Dingen dieses Lebens anzumelden.“ Sie sei „eine völlig nichtssagende Formel“ für „begründungslose Ansprüche“ und beziehe sich ethisch betrachtet auf die austeilende Gerechtigkeit, weshalb sie für die Marktwirtschaft untauglich sei, da es hier keine austeilende Instanz gebe, denn diese sei der Markt und die darin handelnden Akteure Käufer und Verkäufer. Der Markt gleiche einem Spiel der Teilhabe (Katallaktik), Handeln und Handel, also die Einbeziehung anderer, sei ein zivilisatorischer Gewinn. Offenbar werde der, wenn aus Feinden durch Tausch Freunde werden und so erweitert aus dem Handel ein Friedensprojekt wird. Die Ergebnisse freier Märkte bei gegebener Konkurrenz und freier Preisbildung sind demnach definitionsgemäß „gerecht“ und freier Handel führt zum Frieden.
Damit der gerechte Tausch unter Gleichen funktioniert, müssen allerdings einheitliche Spielregeln und Gleichheit der Chancen vorausgesetzt werden. Zwar gibt es niemals komplette Chancengleichheit und die sich daraus ergebenden Folgen für die Leistungsgerechtigkeit sind nur modellhaft optimal zu gestalten, aber realiter reicht in diesem Begründungskontext, dass es keine formellen Diskriminierungen von Marktteilnehmern gibt. Das Recht auf Reichtum ist ein Möglichkeitsrecht und kein Anspruchsrecht. Ob es zu einer „fairen“ Ökonomie gehört, dass alle Menschen einen Anspruch auf bestimmte Grundbedürfnisse haben, ist bis heute der Streit zwischen Ultraliberalen und Verfechtern des Sozial-bzw. Wohlfahrtsstaates. Umstritten bleibt zudem, ob alle wirtschaftlichen Gewinne und Ergebnisse auf Leistung und wenn, auf deren „gerechte“ Belohnung beruhen.
Das scheinbar gelöste Problem des gerechten Preises wählt der amerikanische Philosoph Michael Sandel in seinem Bestseller Gerechtigkeit (Sandel 2009) als Ausgangspunkt für seine kritische Nachfrage, ob dem wirklich so ist. Am Beispiel der Wucherpreise für etliche Güter nach dem Hurricane „Charley“ im Golf von Mexico im Sommer 2004 zeigt er, wie dadurch entstehende Knappheiten von vielen Akteuren ausgenutzt wurden, um horrende Preise für unabdingbare Güter zu erzielen.
Was dem einen als Abzocke, als unmoralische, wenn nicht kriminelle Ausnutzung von Notsituationen erschien, war dem marktwirtschaftlich orientierten Ökonomen nichts anderes als die funktionsgerechte Preisbildung am Markt durch eine veränderte Angebot-Nachfrage-Situation. Der (erhöhte) Preis, so deren Argumentation, sei doch auch ein Anreiz dafür, dass eine durch das Unglück entstandene Verknappung von Gütern nun durch deren Vermehrung, angereizt durch den erhöhten Preis, schneller bereitgestellt würden und das käme doch letztlich allen zu Gute.
Sandels Beispiel verdeutlicht eine grundsätzliche Problematik. An die Stelle des gerechten Preises einer moralischen Ökonomie tritt ein abstrakter, unpersönlicher Marktmechanismus, der als „unsichtbare Hand“ die Güterproduktion durch Angebot und Nachfrage wie ein (von Menschen gemachtes) Naturgesetz steuert. In diesem Sinne spricht allein der Markt die Wahrheit. Die Suche eines jeden nach seinem Vorteil wird durch die freie Preisbildung die Basis für den Ausgleich der individuellen Nutzen und Interessen. So verwandelt die freie Preisbildung am Markt den „wohlverstandenen Eigennutz“, wie ihn Adam Smith nennt, „hinter dem Rücken der Tauschenden“ ins Gemeinwohl.
Dass gesellschaftliche Laster, ökonomisch betrachtet, auch zu Tugenden werden können, ist ein Paradox, das Bernard Mandeville 1724 in satirischer Form in seiner Bienenfabel aufdeckte. Eine Gesellschaft von Tugendbolden würde keinen Wohlstand kreieren. Beten mache nicht reich. Nur durch Laster entstünden Begehrlichkeiten und deren Befriedigung sei Reichtum. Ohne Trinklust keine Brauereien, ohne Verbrechen keine Polizei, ohne Krankheiten keine Ärzte und so fort.
So sehr die Apostel der Marktökonomie Gerechtigkeitsfragen auch scheuen, ganz verschont bleiben sie davon nicht. Dafür sorgte in jüngster Vergangenheit ein schwerer Flurschaden im eigenen System. Der Anlass war die Finanzkrise 2008 und deren Folgen. Die Frage, ob es gerecht war, diese Finanzscharlatane mit öffentlichen Geldern vor ihren wohlverdienten Ruin, den der Markt schließlich nach seinen eigenen Gesetzen besiegelt hatte, zu retten, nur weil andernfalls das gesamte Finanzsystem kollabiert wäre, war unausweichlich.
Ihr folgten weitere: Wo liegen die Grenzen wirtschaftlicher Macht und wie isst das Verhältnis von Eigennutz und Gemeinwohl? Welche Aufrechnung von Kollateralschäden ist unter welchen Bedingungen gerecht? Wo bleibt da die Logik, wenn in einer Notlage Wucherpreise eingeheimst werden dürfen, weil sie paradoxerweise dem Gemeinwohl dienen, weil das den Gesetzen des Marktes entspricht, aber warum soll einem allmächtigen Wirtschaftssektor geholfen werden, der nach denselben Marktgesetzen von angebli„moralfreie“ Marktwirtschaft ist eine Illusion mit gefährlichen Folgen. Vielmehr drängt sich in weiten Teilen der Bevölkerung der Eindruck auf, hier gehe es nicht mehr mit „rechten Dingen“ zu.
Wenn schon die Ökonomie, wo es doch um die Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen geht, die Gerechtigkeitsfrage ignoriert oder als Unsinn ausscheidet, dann sollte man wenigstens erwarten, dass die ebenfalls zuständigen Sozialwissenschaften sich damit beschäftigen. Doch zuvor gilt es einen der Philosophie entspringenden Versuch zu würdigen, das Gerechtigkeitsthema aus der Versenkung öffentlicher Diskurse wieder in den Mittelpunkt der sozialen und politischen Auseinandersetzung zu stellen.
John Rawls Theorie der „Gerechtigkeit als Fairness“
Das war die Tat des amerikanischen Philosophen John Rawls, als er vor gut fünfzig Jahren mit seinem Buch A Theory of Justice (1971) die Frage der Gerechtigkeit wieder ins Zentrum der politischen Philosophie rückte. Er verwies auf einen fundamentalen moralischen und ethischen Mangel des politischen Liberalismus als Basis des westlichen Gesellschafts- und Staatsmodells. Diesem Legitimationsdefizit entgegen zu wirken, war sein Ansinnen. Nebenbei führten seine damals „exotisch“ eingestuften Bemühungen zur Renaissance einer in der Versenkung der positiven Wissenschaft verschwundenen politischen Philosophie.
John Rawls folgt mit seiner vertragstheoretischen Adaption einer eher „schwachen“ Begründung, die auf Absolutheitsansprüche verzichtet und Diskursverhältnisse beschreibt, die bei gegebener Öffentlichkeit Raum für kritisches Räsonnement bieten. Was genauer als „gerecht“ zu werten ist, ist nirgends in Stein gemeißelt, sondern letztlich das Resultat öffentlicher Diskurse. Dass dabei auch das jeweilige Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung eine Rolle spielt, ist für den Bestand einer liberalen Demokratie zwar offenkundig und somit ein Politikum ersten Grades, aber nicht das entscheidende Kriterium für Rawls‘ Argumentation.
Rawls‘ universell angelegte Theorie der Gerechtigkeit versteht „Gerechtigkeit als Fairness“. Rawls korrigierte seinen ursprünglichen Plan, eine generelle Theorie der Gerechtigkeit zu entwickeln, aus einer Vielzahl von Gründen, die für unsere Zwecke nicht weiter ausgeführt werden müssen. Sein auf eine Neubegründung des politischen Liberalismus konzentrierter Entwurf orientiert sich angesichts des „Faktums eines vernünftigen Pluralismus in demokratischen Kulturen“ nicht an Wahrheit, sondern an „der Möglichkeit einer vernünftigen öffentlichen Basis (für) die Rechtfertigung (…) grundlegender politischer Fragen“. (Rawls 1993, 16)
Politisch kann Rawls Beitrag als eine Kritik am vorherrschenden rein ökonomischen Liberalismus und damit als Gegensatz zu dessen Repräsentant Friedrich August von Hayek, der bei Rawls allerdings keine Beachtung findet, gelesen werden. Rawls positioniert sich dagegen als moderner Vertreter eines „Sozialliberalismus“, der auch dadurch liberales Neuland betritt, weil es sich von der „liberalen“ Moraltheorie des Utilitarismus löst.
Rawls‘ Verständnis der Gerechtigkeit als Fairness kann man sich mit einer Anleihe bei Spielen nähern. Fairness ist ja ein Begriff, der an Spiele erinnert. Spiele basieren darauf, dass die Regeln für alle Spieler gleiche Gültigkeit haben. Spiele setzen ergebnisoffene Regeln voraus, die allen Teilnehmern die gleichen Chancen gewähren. Stünde der Sieger vorher fest, gäbe es kein Spiel. Ob der Sieg primär auf Glück oder Geschick bzw. Leistung beruht, ist dabei zweitrangig. Unfair ist es, die Regeln zu missachten, das gilt als „foul“.
Entscheidend für die Festlegung der Fairness ist bei Rawls der Rückgriff auf die neuzeitliche Vertragstheorie, u.a. die Grundannahme einer Ursprungssituation. Eine beliebige Menge „vernunftbegabter Subjekte“ wird in einen fiktiven Urzustand versetzt, um Prinzipien einer „wohlgeordneten Gesellschaft zu entwickeln. Ihre wichtigste Gemeinsamkeit ist, dass sie, mit einem „Schleier der Unwissenheit“ versehen, über ihre künftige Stellung in einer Gesellschaft keine Ahnung haben. Die Frage ist also, wie würden, von keinerlei Interesse geleitet, vernünftige Subjekte im „Urzustand“ als Gleiche allgemeingültige Prinzipien festlegen.
Wie kaum anders zu erwarten, würden bei der Festlegung für die Prinzipien des „politischen Zusammenlebens“ die Rechte für alle gleich verteilt. Hier eine Unterscheidung vorzunehmen, gliche einem Lotteriespiel, wer in der richtigen Gesellschaft dann zum Herrn oder Sklaven würde. Das Gleichheitsprinzip der Rechte für alle erfährt für einen zweiten Bereich, der Verteilung der Güter, eine wesentliche Veränderung. Hier gilt das „Differenzprinzip“. In dieser Sphäre, bestimmt durch die Frage nach der Berechtigung oder Notwendigkeit „sozialer Ungleichheit“ folgt Rawls tendenziell einem utilitaristischen Argument. Ungleichheit ist in einer „wohlgeordneten Gesellschaft“ insofern gerecht, wenn dadurch auch die sozial Schwächsten der Gesellschaft bessergestellt werden als bei einer Gleichheit aller. Ökonomen nennen es das „Pareto-Optimum“.
Veranschaulichen lässt sich dieses Argument an einem vertrauten Bild aus dem Kalten Krieg, dessen Sohn auch Rawls war. Der westliche Kapitalismus ist zwar ungerecht, wie die Spreizung der Vermögen zeigt, aber (dadurch?) auch effizienter als der reale Sozialismus mit seiner Gleichheit für alle. Wie man sogleich erkennen kann, geht es den Schwächsten in der ungleichen Gesellschaft absolut besser als den Gleichgestellten in der Egalitären.
Dieser Argumentationsgang Rawls‘ impliziert immanent gedacht eine Vielzahl Probleme und gilt einigen Kritikern als eine Schwachstelle, wo er dem realen Liberalismus Tribut zollt. Erwähnt werden sollte aber, dass es Rawls nicht um eine Parteiergreifung in der Frage unterschiedlicher Wirtschaftssysteme ging und das Recht auf Privateigentum gehört bei ihm nicht zu den „natürlichen“ Menschenrechten.
Ohne auf die breitgefächerte Debatte über diese Probleme innerhalb der Rawlsschen Theorie einzugehen, sollen im Folgenden schlaglichtartig einige aktuelle Problembereiche skizziert werden, die sich als „Gerechtigkeitslücken“ bezeichnen lassen und Fragen nach der „sozialen Gerechtigkeit“ aufwerfen.
Die blinden Flecken der Gerechtigkeitsdebatte
Rawls hat das Recht auf Privateigentum zwar nicht in den Katalog der Grundrechte aufgenommen. Es gehört für ihn nicht zu den originären Menschenrechten, sondern wird bestenfalls im Rahmen einer „wohlgeordneten“ Gesellschaft gewährt. Da es aber ein zentrales Element gesellschaftlicher Macht und Herrschaft ist, muss es in der Gerechtigkeitsbestimmung eine angemessene Rolle spielen.
Rawls reiht sich in diesem Fall in die sozialwissenschaftlichen Analysen zur sozialen Ungleichheit ein, die sich in den letzten fünfzig Jahren durch eine erstaunliche „Eigentumsvergessenheit“ auszeichnen. Im Kontext einer „kulturalistischen Wende“ finden sich als Gründe für die empirisch messbaren sozialen Ungleichheiten die vertrauten Faktoren: Herkunft bestimmt Zukunft und die entscheidenden Faktoren sind insbesondere Bildung, gefolgt von Geschlecht und Migration. Vom Privateigentum als Quelle gesellschaftlicher Macht oder gar Herrschaft ist nie die Rede. Nicht einmal die unterschiedlichen Startbedingungen mit oder ohne Erbschaft von Vermögenswerten finden eine angemessene Würdigung. (ausführlicher dazu Wortmann 2024b)
Dabei fordern nicht nur die aktuellen Debatten über die Zukunft des Sozialstaates und Entwicklungen in der Vermögensbildung eine kritischere Betrachtung dieses Faktors geradezu heraus. Übergehen wir hier das strukturell tieferliegende Problem privater Verfügungsgewalt über Produktionsmittel als Form von Herrschaft, so ist die schlichte Tatsache, dass durchschnittlich pro Jahr Vermögenswerte von ca. 250 Milliarden € in der Bundesrepublik in extrem abgestufter Form vererbt werden, ein Tatbestand, der für eine problemorientierte Untersuchung über „soziale Gerechtigkeit“ nicht ausgeklammert werden kann.
Zumal hier auch noch das „Matthäus-Prinzip“ gilt: „Wer hat, dem wird gegeben!“ Das wirft nicht nur Fragen in Bezug auf Chancengleichheit und -gerechtigkeit auf. Die Erbmassen werden nicht folgenlos für das Leistungsprinzip als Legitimation für ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen sein.
Die neue Macht und Herrschaft der „Hyperreichen“
Hinzu kommt, dass mit Blick auf den weltweiten „Hyperreichtum“ die Frage von gesellschaftlicher (und politischer) Macht und Herrschaft eine wahrnehmbar steigende Bedeutung erfährt. Was in den USA durch das Duo Musk und Trump personifizierte Anschaulichkeit erhielt, steht für eine Ära einer sich in wenigen Händen massierten Entscheidungsmacht über die zukünftige Entwicklung von Gesellschaften, ja der Welt. Ein sich formierender Club von Hyperreichen verlangt nicht nur die Abschaffung des Sozialstaates und der Demokratie, beide gelten diesen Hyperreichen als widerwärtige Gefährdungen ihres „erarbeiteten Reichtums“ durch politische Eingriffe. Der Traum ist die Abschaffung herkömmlicher Staatlichkeit insgesamt, die in auserwählten „Steueroasen“ schon erprobt wird. (s. dazu Slobodian 2023)
„Öffentliche“ Aufgaben werden privatisiert und der Staat in eine Einrichtung verwandelt, wo die Aktionäre nach ihrem jeweiligen Aktiengewicht über die Formen des Zusammenlebens allein entscheiden. Dieser „libertäre Anarchismus“ ist keine abstrakte Utopie und paart sich mit einem neuen Autoritarismus. Politiker wie Trump erfüllen dabei die Funktion des disruptiven Zerstörers des Bestehenden, also dem, was wir „liberale Demokratie“ nennen. Mehr oder weniger bewegen sich die neuen Rechtsparteien weltweit mit ihrer dezidiert marktradikalen Ausrichtung und der Verteidigung des „Rechts auf Vermögen“ (Alice Weidel) in diesem Strom, dessen populäre Mobilisierungsquellen Wohlstandchauvinismus und Rassismus sind. (s. Landa 2022)
Das Problem der schier uferlosen Macht der weltweiten Milliardärskartelle könnte sich insbesondere durch die KI-Giganten noch verschärfen. Entgegen dem vermittelten Eindruck, hier entwickle sich eine an sich neutrale Technologie zu einer bisher unbekannten Macht über uns, ist vor solchen „Verdinglichungen“ zu warnen. Denn auch diese Technologie erhält ihre letzte Zweckbestimmung und Befehlsgewalt von lebendigen Zweibeinern, die über profane Macht- und Herrschaftsmittel verfügen und auch mit dieser Technologie vor allem Geld verdienen sowie ihre Herrschaft erhalten und mehren wollen. Die Gefahren und Risiken auch dieser Technologie liegen nicht nur in der Tücke der Materie selbst, sondern vor allem in ihrer sozialen und politischen Instrumentalisierung für profane Zwecke.
Aktuelle Kampffelder „sozialer Gerechtigkeit“ und ein strukturelles Problem
Angesichts solcher Entwicklungen muss die Suche nach der sozialen Gerechtigkeit den von Rawls verdienstvoll eröffneten Problemhorizont noch erheblich aktualisieren und erweitern. Die Debatte über die Zukunft des Sozialstaates, Umbau oder Abbau, ist dabei ein weiteres Element, dass über das Thema „Bürgergeld“ hinaus mit den genannten Themenfeldern erweitert und neu justiert werden müsste. Dabei wäre der bei Rawls angedachte Zusammenhang von gesellschaftlich geteilter Gerechtigkeitsvorstellung und sozialer Integration stärker zu gewichten.
Die gegenwärtige Debatte über die Ursachen der Wachstumskrise, der „Finanzierbarkeit“ bzw. den Um- oder Abbau des Sozialstaates und die Reformen sozialpolitischer Bereiche wie Gesund, Pflege, Alter und Rente (um nur die momentan wichtigsten zu nennen), bedarf einer gesonderten Betrachtung und Analyse, die hier den Rahmen sprengen würde. In Erinnerung zu rufen ist dagegen eine Erklärung dafür, warum sich bestimmte Gruppen – wie z.B. Bürgergeldempfänger – hervorragend als „Sündenböcke“ eignen. Das hat etwas damit zu tun, dass von hier der geringste Widerstand zu erwarten ist. Warum das so ist, verweist auf ein Strukturproblem unseres Systems.
Die Erklärung dafür ist eigentlich über fünfzig Jahre alt. (Offe 1969) Der Kampf um Gerechtigkeit ist auch, wenn nicht vor allem ein Kampf der Interessen. In einer offenen pluralistischen Gesellschaft ist der Widerstreit unterschiedlicher und auch konkurrierender Interessen eine Selbstverständlichkeit und das Recht, sie zu artikulieren und sich dafür auch zu organisieren, das Markenzeichen einer freien Gesellschaft.
Hier liegt allerdings die Crux. Das Recht sich zu organisieren, ist das eine, die Möglichkeiten das andere. Zwei Faktoren sind unabdingbar: Interessen müssen erstens organisierbar sein und zweitens müssen sie konfliktfähig und damit durchsetzungsfähig sein. Das heißt nichts anderes, als die Fähigkeit, bei Nichterfüllung von Forderungen, mit dem Entzug gesellschaftlich relevanter Leistungen drohen zu können. Dass es hier Disparitäten gibt, ist offenkundig. Gewerkschaften können mit Streik drohen und gemäß dem alten Motto: „Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will!“ die Gesellschaft partiell oder total lahmlegen. Unternehmer können durch Aussperrung die Arbeiter unter Druck setzen.
Entscheidend für gesellschaftliche Konfliktmacht ist nicht unbedingt die Menge der (organisierten) Interessenten. Kleine Berufsgruppen und Organisationen lehren uns als Fluglotsen oder Lokomotivführer, dass sie an der Nahtstelle systemrelevanter Leistungen in kleiner Zahl enorme Macht ausüben können. Große Mengen, wie beispielsweise Rentner, sind aus diesem Grund nicht organisierbar, weil sie unmittelbar nicht konfliktfähig sind. Sie können mit keinem Entzug einer systemrelevanten Leistung drohen. Ein Verzicht auf die Rente wäre eine paradoxe Drohung. Studentenstreiks haben vergleichbaren Charakter.
In dieser Kategorie befinden sich auch die Empfänger von Bürgergeld. Da sie ökonomisch betrachtet nichts leisten (können), können sie auch mit keinerlei Leistungsentzug drohen. Da Interessen umso leichter organisierbar sind, je konfliktfähiger sie sind, treten schon hier schwer überwindbare Barrieren auf. Wie bei Rentnern und anderen Gruppen bliebe nur der Weg in den politischen Raum, um dort die Menge als relevante Wählergruppe in die Waagschale zu werfen. Stimmen zu bündeln und mit Forderungen zu verbinden, wäre der Weg.
Doch genau das funktioniert nicht. Weder Arbeitslosen noch Rentnern, auch Autofahrern ist es nicht gelungen, ihre Menge politisch als eigenständige Gruppe so zu bündeln, dass sie im pluralistischen Wettbewerb als Wählermasse Macht ausüben. Rentnern ist das als Wählerschaft zwar über die Parteien indirekt gelungen, aber nie über eine eigene Organisationsform, weil diese Interessen in differenzierter Form mittlerweile Teil der politischen Agenda sind.
Die Gründe für die begrenzte politische Organisierbarkeit sind vielfältig. Zum einen sind die sozialen Lagen und Problembereiche zu heterogen. Und als Teil von Parteien werden innerhalb dieser die Partialinteressen solcher Gruppen schon marginalisiert. Bei Bürgergeldempfängern handelt es sich empirischen Studien zufolge um eine politisch eher lethargische Ansammlung, die nicht zu selbstbewussten und eigenständigen Aktivtäten tendiert. Selbst als passive politische Gruppe reicht es hier erfahrungsgemäß häufig nicht einmal zur Wahlteilnahme. Im Gegenteil, aus diesem Milieu der „Abgehängten“ rekurriert sich ein beträchtlicher Teil der Nichtwählerschaft und fällt damit fatalerweise auch aus der politischen Interessenanmeldung heraus. Somit werden, wenn überhaupt, diese Interessen lediglich „advokatorisch“ wahrgenommen und geraten dann in die Falle einer moralischen Vertretung, die sich nicht auf manifeste Interessen, sondern primär auf Moral stützt.
Was immer eine sozial gerechte Gesellschaft ist, aber allein die Tatsache, dass sie inmitten von Reichtum ein stattliches Heer an Arbeitslosen hervorbringt, ist ein Beleg dafür, dass es sich nicht um eine Gesellschaft im Sinne einer „sozialen Gerechtigkeit“ handeln kann.
Literatur
- Ebert, Thomas (2015): Soziale Gerechtigkeit. Bonn
- Ebert, Thomas (2012): Soziale Gerechtigkeit in der Krise. Bonn
- Hayek, Friedrich August von (1977): Demokratie, Gerechtigkeit und Sozialismus. Tübingen
- Höffe. Otfrried (2001): Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. München 2007, 3. Aufl.
- Landa, Ishay: Der Lehrling und sein Meister. Liberale Tradition und Faschismus. Berlin 2022
- Maihofer, Werner (1969): Ideologie und Recht, in ders. Hrsg. Ideologie und Recht. Frankfurt a.M. 1969, S. 1 – 36
- Mandeville, Bernard (1724): Die Bienenfabel oder private Laster, öffentliche Vorteile. Frankfurt a.M. 1968
- Offe, Claus (1969): Politische Herrschaft und Klassenstrukturen, in: Kress / Senghaas: (Hrsg.) Politikwissenschaft. Frankfurt a.M., S. 155 – 189
- Rawls, John (1971): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M. 1975
- Rawls, John (1992): Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989. Frankfurt a.M. 1992
- Rawls, John (1993): Politischer Liberalismus. Frankfurt a.M. 1998
- Rawls, John (2001): Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuentwurf. Frankfurt a.M. 2003
- Sandel, Michael J.: (2009) Gerechtigkeit. Wie wir das richtige tun. Berlin 2013
- Smith, Adam (1776): Der Wohlstand der Nationen. München 1974 (Übers. H. C. Recktenwald)
- Slobodian, Quinn (2023): Kapitalismus ohne Demokratie. Wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen. Berlin
- Wortmann, Rolf (2024): Kant gegen Möser oder Aufklärung statt Traditionalismus. Osnabrück
- Wortmann, Rolf (2024b): Die Mitte als Mythos und Problem, in: Osnabrücker Rundschau https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/rolf-wortmann/die-mitte-als-mythos-und-problem/ https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/rolf-wortmann/die-mitte-als-mythos-und-problem-teil-2/ https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/rolf-wortmann/die-mitte-als-mythos-und-problem-teil-3/ https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/rolf-wortmann/die-mitte-als-mythos-und-problem-teil-4/ https://os-rundschau.de/rundschau-magazin/rolf-wortmann/die-mitte-als-mythos-und-problem-teil-5/