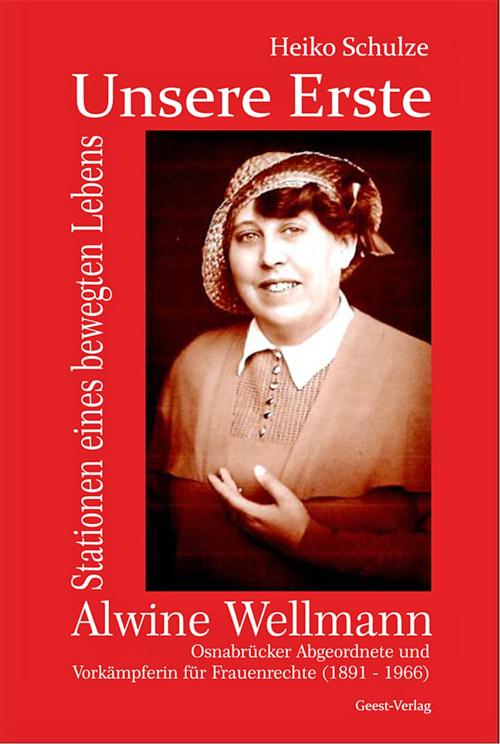Egon Bahrs Tutzinger Rede vor sechzig Jahren
Vor sechzig Jahren, genauer am 15. Juli 1963, hielt der Leiter des Presseamtes in Berlin und persönliche Vertraute des Berliner Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt Egon Bahr an der Evangelischen Akademie Tutzingen am Starnberger See eine Rede, die er als „Diskussionsbeitrag“ zum Tagungsthema „Wiedervereinigung“ herunterspielte, die unter dem Titel „Wandel durch Annäherung“ in die Geschichte einging und Geschichte machte.
Was Egon Bahr hier einem kleinen, erlauchten Publikum servierte war ein wohlkalkulierter Bruch mit der bisherigen Deutschland- und Außenpolitik der BRD. Sie skizzierte die Folgen, die sich aus einer veränderten internationalen Konstellation ergaben, die in ihrer Konsequenz aber erst sechs Jahre später mit dem Regierungswechsel 1969 zur sozial-liberalen Koalition unter der Kanzlerschaft Willy Brandts mit den „Ostverträgen“ zur praktischen Umsetzung gelangte.
Die Rede erfolgte mit Rückblick auf turbulente Jahre, die gezeichnet waren von dramatischen Krisen und der Erfahrung, dass der weltumspannende Ost-West-Konflikt unmittelbare Folgen für Deutschland hatte und Berlin ins Zentrum des Weltgeschehens rückte. Nachdem sich mit dem Beitritt der beiden deutschen Teilstaaten zu den militärischen Bündnissystemen der Nato und des Warschauer Paktes 1955 das Ost-West-Verhältnis zunächst entspannte, Entmilitarisierungspläne – am prominentesten der „Rapacki-Plan“ des polnischen Außenministers – für Europa wie Pilze aus dem Boden schossen, änderte sich alles, als im November 1958 der Generalsekretär der KPdSU Nikita Chruschtschow verkündete, der „anormale“ Zustand Berlins müsse überwunden und die Stadt in eine „entmilitarisierte“ neutrale Zone verwandelt werden. Das hieß – wie ein Ultimatum Chruschtschows verlangte – den Rückzug der westlichen Siegermächte aus Westberlin und die Aufgabe Berlins zugunsten der DDR bzw. der Sowjetunion.
Wandel der Ost-West-Machtkonstellation
Chruschtschow ließ zwar das Ultimatum verstreichen, was ihm den Status eines „Papiertigers“ einbrachte, aber man war gewarnt. Mit dem erfolgreichen „Sputnik-Start“ von 1957 signalisierte Moskau seine Fähigkeit, mittels ballistischer Trägersysteme ihre Atomwaffen künftig direkt in die USA senden zu können. Damit zeichnete sich eine dramatische Änderung der strategischen Kräfteverhältnisse ab. Atomsprengköpfe konnten bis dahin „nur“ mit Langstreckenbomber transportiert werden, deren Reichweite aber weder von der Sowjetunion in die USA noch umgekehrt reichten, zumindest wenn man den Rückflug mit berechnet. (Stanley Kubricks Film „Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe zu lieben“ macht aus diesem strategischen Kernproblem eine meisterhafte Komödie.)
In dieser Konstellation hatten die USA aber den Vorteil, dass sie ihre Langstreckenbomber von dem Territorium ihrer europäischen Verbündeten ins Gebiet der Sowjetunion schicken konnten, während diese mit gleicher Münze nicht zurückzahlen konnte, sondern lediglich die europäischen Verbündeten als Geiseln nehmen konnten. Die Glaubwürdigkeit einer auf atomarer Abschreckung basierenden Verteidigung des Westens bestand in dem atomaren Schutzschirm der USA, jeden Angriff der Gegenseite mit einem atomaren Vergeltungsschlag zu beantworten.
Da der USA keine unmittelbare gleiche atomare Antwort drohte, konnte man den atomaren Schutzschirm der USA für ausreichend halten, aber es gab Zweifel, ob die USA bei jedem Nadelstich des Gegners sofort mit dem atomaren Hammer antworten würde. Also musste unterhalb der atomaren Antwort, die von den Westeuropäern gern eingeklagt wurde, eine für den Feind glaubwürdigere konventionelle Verteidigungslinie aufgebaut werden. Diesem Umstand verdankte die BRD nicht nur ihre von den Amerikanern unterstützte Wiederbewaffnung, sondern dazu noch ihre gleichberechtigte Mitgliedschaft n der Nato. Damit ging Adenauers Nahziel in Erfüllung, die BRD zum gleichberechtigten souveränen Mitglied des westlichen Bündnisses zu machen, nachdem der Versuch einer „Europäischen Verteidigungsgemeinschaft“ an Frankreichs Ablehnung gescheitert war.
Was die Souveränität betrifft, so muss in diesen Wein etwas Wasser gegossen werden, denn die jeweiligen Verträge der Siegermächte mit dem deutschen Teilstaat legen in Ost wie West fest, dass alle „Fragen, die Deutschland als Ganzes betreffen“, dem Vorbehalt der Siegermächte unterliegen. Diese gern unterschlagene Klausel wurde 1990 bei den Verhandlungen über die Wiedervereinigung in Erinnerung gerufen. Sie bedeutete für die Zeit der Krisen Ende der fünfziger und Beginn der sechziger Jahre aber auch, dass die Parole „Deutsche an einen Tisch“, wie Egon Bahr in seiner Rede hervorhebt, der Illusion aufsitze, die „deutsche Frage“ könne von Deutschen allein beantwortet werden. Faktisch wie völkerrechtlich war sie eine Frage auf die es ohne die Siegermächte keine Antwort gab, folgerichtig sei die Frage der Wiedervereinigung, so Bahr, eine Frage der deutschen Außenpolitik.
Und die müsse eine völlig veränderte Weltlage und ein verändertes Kräfteverhältnis zur Kenntnis nehmen. Im Kern bestehe die Veränderung darin, dass sich mit dem „Sputnik-Schock“ eine militärstrategische Parität zwischen den beiden Nuklearmächten abzeichne, die in der verrückten Situation einer „mutual assured destruction“ (MAD), der garantierten wechselseitigen Vernichtungsmöglichkeit münde. Aber damit neutralisiert die nukleare Abschreckung die militärischen Mittel einer politisch wirksamen Überlegenheit. Anders ausgedrückt: Atomwaffen ließen sich nicht mehr in politische Macht ummünzen.
Eben das, so Bahr, kennzeichne den Verlauf der Krisen von der Berlin-Krise, die man als neues Selbstbewusstsein Moskaus interpretierte und die schließlich zur – von den Amerikanern im Juni 1961 beim Gipfeltreffen in Wien von Kennedy akzeptierten – Zementierung der Teilung Europas und Deutschlands in Gestalt der Mauer am 13. August 1961 führte. Für die frisch ins Amt gekommene Kennedy-Administration war nicht zuletzt auf Grund des sich herausbildenden nuklearen Patts der Ost-West-Gegensatz primär ein ziviler Kampf um die Überlegenheit der gegensätzlichen Systeme, aber dieser Kampf verlagert sich weg von Europa, wo die Einflusssphären abgesteckt waren und die Sowjetunion eher als eine Status quo-Macht statt einer expansiven, revisionistischen Macht engeschätzt wurde, in das, was man nun als die „Dritte Welt“ einer sich entkolonisierenden Welt bezeichnete.
Kennedys Neuausrichtung verfolgt keine Eindämmungspolitik mehr, die den Anschein erweckt, man wolle den politischen oder gar territorialen Status quo des Zweiten Weltkriegsergebnisses offensiv revidieren. Weniger durch Taten, wie die Reaktionen auf die Erosionen des Ostblocks insbesondere 1956 signalisierten, aber doch durch die Rhetorik insbesondere des amerikanischen Außenministers John F. Dulles wurde die offensive Variante der den Kalten Krieg bestimmenden „Containment-Politik“ der USA als untauglich verabschiedet.
Die Kubas-Krise im Oktober 1962, wo die USA den Versuch der Sowjetunion, durch Stationierung von Mittelstreckenraketen auf Kuba ein strategisches Äquivalent zu den in Europa stationierten und auf die UdSSR gerichtet amerikanischen Atomarsenale zu schaffen, als eine unmittelbare Gefährdung der amerikanischen Sicherheit interpretierten und die Welt in eine dramatische Krise brachte, die damals dichter an einen Atomkrieg führte als viele befürchteten. gelang es durch eine geschickte Konfliktentschärfung das Schlimmste zu verhinderten, Der Deal bestand darin, dass die USA eine öffentliche Zusicherung der kubanischen Souveränität gaben und dies mit der öffentlich unbekannten Zusicherung gegenüber Moskau verbanden, im Gegenzug ihre in Europa stationierten Mittelstrecksysteme abzuziehen. Dass dieser Schachzug öffentlich als Niederlage erschienen wäre, ist die eine Wahrheit, die andere, dass sie faktisch nichts kostete, denn der Abzug und die Umwandlung der Stationierung auf U-Boote war längst geplant. Entscheidend war, dass Chruschtschow die geheim gehaltene Zusicherung des Abzugs der atomaren Mittelstreckenraketen aus Europa intern als seinen Erfolg verkaufen und er somit sein „Gesicht gewahren“ konnte.
Die Kuba-Krise war die „Welt am Abgrund“ und zugleich ein Durchbruch. Sie zeigte, dass im Atomwaffenzeitalter „selbst Feindschaft kompliziert wurde“ – wie Henry Kissinger feststellte. Das gemeinsame Interesse am Überleben überwog die vitalen anderen Interessen. Für den Kampf um den Einfluss in der restlichen Welt hatte die Kennedy-Administration ein weltumspannendes Programm unter dem Titel „Allianz für den Fortschritt“ aufgelegt, dessen Kern ökonomische Hilfen für „Entwicklungsländer“ war. Der verbleibende Ost-West-Konflikt als „Systemkonflikt“ verlagerte sich vom aufgeteilten Europa in die weiten Zonen der noch nicht verteilten Welt. Zudem war festzustellen, dass durch den aufkommenden Konflikt zwischen den beiden kommunistischen Großmächten Sowjetunion und der Volksrepublik China der Kommunismus kein hermetischer Block mehr war.
Folgen für die Bundesrepublik
Das nukleare Patt, die Anerkennung der Macht- und Einflusssphären in Europa bescherten Europa eine neue Zeit der „friedlichen Koexistenz“ der Systeme, die auf wechselseitiger Anerkennung und somit auf „Entspannung“ hinzielten. Von dieser grundlegenden Erkenntnis ausgehend war der bisherigen von Adenauer definierten Deutschland- und Außenpolitik der Boden entzogen, was allein für Bahrs Befund schon ein Umdenken verlangte. Hinzu kam ganz praktisch, dass nach dem Bau der Mauer noch so viel moralische Empörung über das Verhalten der „Zone“ und Pochen auf Rechte nichts daran ändern konnten, dass man um der humanitären Erleichterungen willen für die betroffenen Menschen mit „denen da drüben“ reden musste, um zu Regelungen und Erleichterungen, zur „Durchlässigkeit“ der Mauer zu kommen. Und damit musste deren Existenz, in welcher Form auch immer, irgendwie als Faktum anerkannt werden.
Egon Bahrs Tutzinger Rede basierte einige Wochen nach John F. Kennedys legendärer Berliner Rede („Ick bin ein Börliner“) ganz auf der Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik unter dem Label „Strategie des Friedens“. Drauf aufbauend ergaben sich Herausforderungen, aber auch Chancen. Zunächst musste erkannt werden, dass die bisherige von Adenauer als Politik der „Wiedervereinigung aus der Position der Stärke“ betriebene Deutschland- wie Außenpolitik der Boden entzogen wurde. Mochte der Glaube, dass der Schlüssel zur Wiedervereinigung allein in Moskau liege, Bahr teilte diesen naiven Glauben, unsere westlichen Verbündeten seien ernsthaft an einer „Wiedervereinigung“ interessiert, nicht, noch plausibel erscheinen, so war das erforderliche Mittel, die Stärke, die Moskau dazu zwingen sollte, ihn herauszugeben, kaum anders als militärisch zu bestimmen und somit hatte das veränderte strategische Gleichgewicht diesem Glauben eigentlich jegliche Plausibilität genommen.
Adenauers Wiedervereinigungspolitik lebte von dem Dogma, dass die Voraussetzung für eine Entspannung in Europa die (positive) Lösung der deutschen Frage sei. Bei der hatte man sich in selbst gebastelte Rechtsdoktrinen verstrickt wie den „Alleinvertretungsanspruch“, d.h. allein die BRD sei der legitime Nachfolgestaat des untergegangenen Dritten Reiches, der zudem in den Grenzen von 1937 weiterexistiere. Allein diese Rechtsformel barg schon genügend Zündstoff nicht nur für die dadurch unmittelbar in ihrer territorialen Verfassung bedrohten ost- und mitteleuropäischen Staaten, deren Sicherheitsinteressen hier unmittelbar zur Disposition standen, sie fanden nicht einmal bei den Verbündeten Beifall. Denn wer sollte im Nachkriegseuropa ein ernsthaftes Interesse daran haben, ausgerechnet denen, die das ganze Elend verursacht hatten, nun in einer erneuten unkalkulierbaren Auseinandersetzung zu einer Wiederherstellung von territorialen Zuständen zu verhelfen, an denen sie kein Interesse haben konnten und deren Rechtskonstruktionen außerhalb Deutschlands niemanden als zwingend erschienen.
Der Rechtsdogmatismus brachte Deutschland spätestens mit der „Hallstein-Doktrin“, die besagte, dass die BRD keine diplomatischen Beziehungen mit Ländern aufnimmt, die die DDR anerkennen, zunehmend in eine globale Defensive, denn immer mehr „Entwicklungsländer“ ließen sich von diesem „Entweder-Oder“ nicht mehr beeindrucken. Deutschland-West lief Gefahr, sich zum letzten Eisblock des Kalten Krieges, zur letzten revisionistischen Macht der europäischen Nachkriegsordnung zu entwickeln. Die Herausforderung sieht Bahr darin, die globale Entspannung zu nutzen. Sie sei eher die Voraussetzung einer Wiedervereinigung als diese für die Entspannung. Stelle sich Deutschland dem Wunsch auch der Europäer nach Entspannung entgegen, werde es sich isolieren.
Es gelte die Schwäche des östlichen Systems, dokumentiert im Mauerbau, zu erkennen, zugleich den Austausch, den Handel trotz aller Differenzen zu intensivieren. Eine Politik der Anerkennung der Realitäten sei die Voraussetzung für Veränderungen. Das alles könne man auf die Formel einer selbstbewussten Politik bringen: „Wandel durch Annäherung“.
Die Lehren für heute?
Natürlich ist die heutige Situation mit der vor sechzig Jahren nicht vergleichbar. Da sich Geschichte nie eins zu eins wiederholt, ist es mit dem vielzitierten Lernen aus der der Geschichte auch so schwierig. An Bahrs Rede und die daraus folgende Entspannungs- und Ostpolitik zu erinnern, ist in der gegenwärtigen Diskussion schon deshalb wichtig, weil es gerade deutlich zu machen gilt, dass diese Politik nicht nur notwendig, sondern auch richtig war. Das zu erinnern ist deshalb so wichtig, weil im Zuge des Ukrainekrieges es von konservativer, aber auch von grüner Seite Bestrebungen gibt, Fehler der deutschen Außenpolitik in der jüngsten Vergangenheit auf die gesamte Phase der Ost- und Entspannungspolitik auszudehnen und sie als zu „russlandlastig“ zu desavouieren. Solche Kritiken verkennen nicht nur die damals entscheidenden Kontexte und drücken sich zugleich um die Frage herum, wie sie denn künftig nach einem Ende des Ukrainekrieges mit dem wohl kaum aus der Welt zu schaffenden Faktum Russland – schlimmstenfalls sogar mit Putin – umzugehen gedenken. Das Mantra „die Ukraine muss siegen“ entpuppt sich mehr und mehr als Leerformel, die sich um die eigentlich unangenehmen Fragen herumdrückt.
Was uns der „Wagner-Aufstand“ lehrt, ist lediglich dies, dass Putins autokratisches Regime nicht ganz so monolithisch ist, wie es den Anschein hat. Aber eine Alternative zu Putin, die nur ein wenig den westlichen Vorstellungen entgegenkäme, ist da weit und breit nicht zu sichten. Und daraus folgt, dass die Stunde nicht mehr allzu fern ist, wo ein neuer Realismus gefragt sein wird. Da wird es nicht nur um Werte, sondern vor allem um Interessen gehen. Die Kunst der Diplomatie besteht darin, wie man mit seinen Gegnern, ja mit seinen Feinden unterhalb des Krieges zu Arrangements kommt. Und da kann man in der Tat bei Egon Bahr durchaus noch etwas lernen.
Und dieses Lernen sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert, dazu gehört zunächst die Erkenntnis, dass das heutige Russland Putins nicht die Fortsetzung der Sowjetunion ist, das gilt hier vor allem für die Außenpolitik. Die Sowjetunion war, entgegen allen Behauptungen Kalter Krieger, sie strebe als „Vaterland der Werktätigen“ immer noch nach der „kommunistischen Weltrevolution“, faktisch eine Status-quo-Macht, die ihre Einflusszone in Europa verteidigte. Putins Russland dagegen ist in Bezug auf die bestehende Weltordnung eine revisionistische Macht ohne weltrevolutionäre Ambitionen. Putin geht es nicht um Machtverschiebungen innerhalb der bestehenden Ordnung, sondern um eine grundlegende Änderung der Ordnung selbst geht.
Deshalb ist der Ukrainekrieg zugleich auch ein Kampf um die künftige Weltordnung und da geht es um mehr als die Ukraine und das Verhältnis des Westens zu Russland und China, sondern da geht es auch um eine Neuformierung einer „westlichen“ Weltordnung, die den Interessen der Länder des „globalen Südens“ gerecht wird und letztlich auch noch darum, was denn künftig der „Westen“ eigentlich sein soll angesichts der voranschreitenden Krise seines politischen Systems.