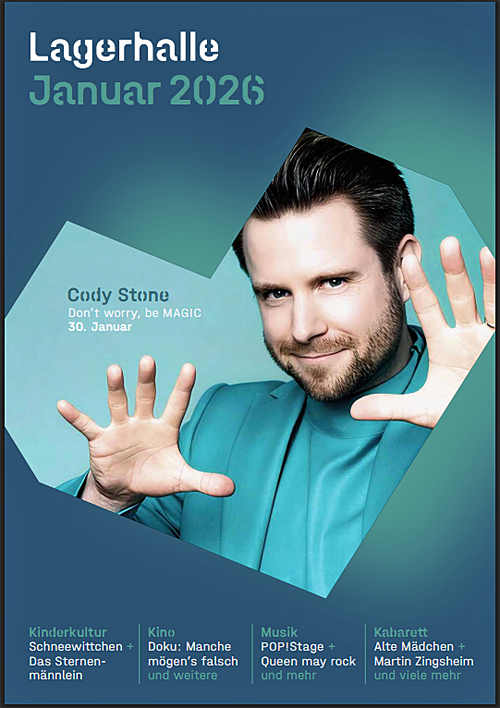Zur Historie der Ukraine im Verhältnis zu Russland
Der Name „Ukraine“ sagt schon viel über die Besonderheit dieses Landes. Er bedeutet „Grenzland“. Im gegenwärtigen Krieg in und um die Ukraine spielt in der Begründung dieses Krieges die Frage, ob und in wieweit die Ukraine eine selbständige Nation immer schon war und nun ist, eine wichtige Rolle. Da hier die Geschichte als Argument für Besitzansprüche (der Russen) und Recht auf Eigenständigkeit (der Ukrainer) geltend gemacht wird, begibt man sich auf das Gebiet der „Geschichtspolitik“.
Während Putin der Ukraine ihre staatliche Exisenz abstreitet, weil sie schon immer ein Teil Russlands gewesen sei, argumentieren die Ukrainer, dass sie nicht nur ein wesentlicher Teil der historischen Genese des späteren Russlands waren, sondern sich ethnisch und kulturell durch eine eigene Sprache und Religion immer auch als eigene Nation verstanden hätten und darum schon mehrfach für einen eigenen Staat gekämpft hätten, aber von „Großrussland“ daran gehindert und somit als eigenständige Nation unterdrückt worden seien.
In der europäischen Kulturgeschichte war (und ist) die Ukraine als das „Grenzland“ Teil der ostslawischen Völker und der orthodoxen Richtung des Christentums. Das wird durch die byzantinische Kirche mitgeprägt, grenzt sich aber auch davon ab. Die ostslawischen Völker liegen territorial im Einzugsbereich Russlands, abgegrenzt von den westslawischen Völkern auf dem Balkan und dem östlichsten Vorposten des lateinischen Europas, dem katholisch-römischen Polen. Für die Identitätsbildung der Ukraine kommt erschwerend hinzu, dass fraglich ist, ob es nur eine oder mehrere ukrainischen Ethnien gibt. Unstrittig ist dagegen, dass ihr Territorium zumeist von „fremden“ Herrschern, vorzugsweise von Polen-Litauen, Polen und vor allem dem Habsburgerreich beherrscht und geprägt wurde. Die ukrainischen Ethnien waren mit ihrem Territorium nie identisch. Die Ukraine wurde die wandernde Westgrenze des großrussischen Zarenreiches.
Die Wiege der ostslawischen Völkergemeinschaft steht in Kiew. Die Steppenlandschaft im Süden war in Urzeiten Tummelplatz sich abwechselnder Nomadenvölker, bekannt als Skythen und Tataren. Eine artikulierte Geschichte setzt ca. 860 mit der Gründung Kiews als der „Stadt aller Städte“ ein. Hier wurde der Grundstein für jenes Russland gelegt, das sich zunächst aus drei ostslawischen Volksstämmen speiste. Zu den „Kiewer Rus“, die später von den dominanten Moskowitern als „Kleinrussen“ bezeichnet wurden und den Weißrussen (relativ konstant bis heute noch in Belarus) kommen noch jene Russen, die später nach dem Intermezzo der Mongolenherrschaft der „Goldenen Horde“ im 13. Jahrhundert und den anschließenden Tartareneinfällen sowie der Abschüttelung der Herrschaft durch Polen-Litauen den Grundstein für das spätere Russland legten. Parallel zum Zusammenbruch des Byzantinischen Reiches (1453) durch den Sieg der Osmanen konstituierte sich das neue Reich der Moskowiter als das „Dritte Rom“ mit der russisch-orthodoxen Kirche als geistliche Macht und dem Zaren als weltliche.
Unter dem ersten russischen Zaren Iwan IV. (1533/47 – 1584) begann dann von dem neuen Machtzentrum Moskau aus, das mit seiner finnischen Sprachwurzel noch von dem Einfluss der nordeuropäischen Wikinger auf die Geschichte Russlands Zeugnis ablegt, ein systematischer Eroberungszug in die Umgebungen zur Erweiterung und Festigung des Herrschaftsgebietes. Das diente nicht zuletzt der Absicherung gegen die permanenten Tartareneinfälle aus dem Osten und Süden. Nach Innen erwarb sich Iwan IV. mit seiner Vernichtung des alten Bojarenadels den Ruf „der Schreckliche“. Seine Zerstörungswut beschränkte sich nicht auf diese Adelsgruppe, sie richtete sich schließlich gegen die gesamte Bevölkerung. Die Zerstörung von Städten wie Twer und Nowgorod gehen ebenfalls auf sein Konto und die massenhaften Deportationen führten zu Massenfluchten und zugleich zur Entstehung einer „zweiten Leibeigenschaft“. Während in Westeuropa die Leibeigenschaft ihrem Ende zuneigte, erlebte sie in Russland zur gleichen Zeit ihre stärkste Blüte.
Auf den Schrecken Iwans folgte eine als „Zeit der Wirren“ genannte Periode des Übergangs der Zarenherrschaft zu der Dynastie der Romanows. Mit ihr begann eine neue raumgreifende Expansionswelle nach Süden und Osten. Die Eroberung Sibiriens vollzog sich unter der Ägide des Nowgoroder Kaufmanns Stroganow ab 1582, schon 1648 war der Pazifik erreicht. Im selben Jahr brach der „Chmelnitzki-Aufstand“ der „Dnjeprkosaken“ aus und beflügelte die Expansion in den Südwesten des Reiches.
Die Kosaken waren das Ergebnis entlaufender Bauern, die der drückenden Leibeigenschaft in Richtung Süden entflohen, sich dort mit den eingerückten Tartaren verbündeten und eigene auf persönlicher Freiheit beruhende Herrschaftsverbände gründeten, die ihre „Hetmane“ (Hauptmänner) selbst wählten. Aber mit ihrer halbnomadischen Lebensform gerieten sie immer wieder zwischen sämtliche Fronten, zunehmend mit den von Polen beherrschten Gebieten.
Hier nun spielte der Aufstand unter dem ukrainischen Nationalhelden Bogdan Chmelnitzki gegen die Polen (1648-1654) sowie der Krieg gegen Russland (1654-1667), der 100.000 Juden in schrecklichen Massakern das Leben kostete, eine für den ukrainischen Nationalmythos herausragende Rolle. Seither gilt die Ukraine als „Kleinrussland“ und somit als Teil Großrusslands.
Um diese Frage gibt es einen massiven Streit, denn die ukrainische Geschichtsschreibung sieht diesen Akt als erzwungenen Unterwerfungsakt an, die großrussischen Historienmaler dagegen interpretieren es als freiwilligen Beitritt und Befreiung.
Mit der späteren Annexion des Krimhanats im Jahre 1783 durch Katharina der Großen kam ein Teil des Südens der heutigen Ukraine zu Russland, und danach begann unter Potemkin die Umwandlung der Steppe in die heute vertraute „Kornkammer“ Ukraine. Mit der Russifizierung der Ukraine einher ging dann im auslaufenden 19. Jahrhunderts die Industrialisierung mit dem Schwerpunkt im Donezbecken im Osten der Ukraine. Die im Westen der Ukraine liegende Kornkammer der Ukraine diente mit ihren Exporten primär der Finanzierung der Industrialisierung und provozierte bei Missernten schwere Hungersnöte bei den Bauern, eine der schlimmsten ereilte die Bevölkerung 1891/1892.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich auch in der Ukraine ein kultureller und politischer ukrainischer Nationalismus, der sich vor allem gegen Russland richtete. Man sprach auch von einer „Dekomposition“ Russlands. Aber erst im Zuge der russischen (Februar-) Revolution 1917 während des Ersten Weltkrieges entstand die erste unabhängige Ukrainische Republik. Sie schloss Anfang Januar 1918, als die Friedensverhandlungen zwischen Russland und Deutschland in Brest-Litowsk platzten, mit den Mittelmächten einen Separatfrieden. Die Ukraine wurde zu diesem Zeitpunkt weder von den Bolschewiki noch von den Deutschen kontrolliert.
Nach dem Sturz des Zaren hatte sich in Kiew mit der Rada ein eigenes Parlament als Vertreter der souveränen Ukraine konstituiert, das sich zwar auf die von Lenin propagierte Forderung der Bolschewiki nach dem Recht auf Selbstbestimmung der Nationen bzw. Völker, das explizit gegen den großrussischen Imperialismus gerichtet war, stützen konnte, dies aber nicht nur für den Ausstieg aus der Abhängigkeit Großrusslands nutzte, sondern nun mit dem Separatfrieden aus Sicht der Bolschewiki der Revolution zugunsten der feindlichen Mächte in den Rücken fiel. Von dem „Brotfrieden“, der am 9. Februar 1918 geschlossen wurde, erhofften sich dagegen die Deutschen sowie deren Verbündete, insbesondere Österreich-Ungarn, die dringend notwendigen Getreidelieferungen. Fortan wurde die Ukraine bis zu ihrer Eingliederung in die UdSSR nach dem Sieg der Bolschewiki 1922 Kampfplatz innerer Kämpfe während des Bürgerkrieges einerseits, sowie der sich daran anschließenden Kämpfe gegen die auswärtigen Interventionen und der Ententemächte.
Die unter Stalin verursachte „künstliche Hungersnot“ (Holdomor) 1931/32 im Zuge der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die mittlerweile vom Deutschen Bundestag als Völkermord anerkannt wird, trug vermutlich maßgeblich mit dazu bei, dass sich erhebliche Teile der ukrainischen Bevölkerung den Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Juni 1941 eine Befreiung vom Bolschewismus versprachen. Und in der Tat stellten die Ukrainer einen erheblichen Teil der Freiwilligen, die für die Nazis kämpften und sich an Massenexekutionen gegen Juden und Funktionäre des „jüdischen Bolschewismus“ beteiligten. Sie übersahen geflissentlich, was die Bevölkerung dagegen unmittelbar bald zu spüren bekam. Hitlers Schergen kamen nicht als Befreier, sondern als Eroberer und Unterdücker. Auf ausdrücklichen Befehl des Führers sollte hier kein „normaler“ Krieg geführt werden, er wurde als ein „Weltanschauungskrieg“ deklariert, der die Regeln des Kriegsvölkerrechts außer Kraft setzte und als Vernichtungskrieg geführt wurde. Für die Nazis gehörten die Ukrainer als Slawen zu einer minderwertigen Rasse, die entweder auszurotten waren oder als Arbeitssklaven dienen sollten.
Ein erneuter Anlauf zur Selbständigkeit als Staat ergab sich für die Ukraine 1991 im Zuge der allgemeinen Dekomposition der UdSSR, womit der komplette Zusammenbruch der Sowjetunion besiegelt wurde. Aber die mit großer Zustimmung erfolgte Unabhängigkeit gebar vorerst keine einträchtige Nation, sondern ein faktisch zunächst kulturell, ökonomisch und auch politisch wie geografisch gespaltenes Land, das seinen Weg zwischen Ost und West neu finden musste und darin zunehmend zerrissen wurde, weil die Entscheidung zu einer Himmelrichtung zugleich eine Entscheidung von weltpolitischer Bedeutung wurde.
Paradoxerweise hat Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 die historisch wie ethnisch umstrittene Frage nach der Existenz einer eigenständigen ukrainischen Nation in sehr moderner Weise entschieden. Der Widerstand gegen diesen russischen Barbarenakt konstituiert die Ukraine als eine Staatsbürger- und nicht mehr als eine problematische „Abstammungsnation“. Die Herausforderung liegt nun darin, dass die Feindschaft zu den russischen Okkupanten nicht zum alleinigen und entscheidenden Kern einer nationalen Identität wird, sondern das politische Bekenntnis zu einer demokratischen freiheitlichen Ordnung. Kulturpolitische Maßnahmen, alles Russische aus der ukrainischen Kultur zu entfernen, sind dabei keine ermutigenden Wegzeichen.
Ein paar Literaturtipps:
- Creuzberger, Stefan: Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Beziehung. Hamburg 2022
- Eltchaninoff, Michel: In Putins Kopf. Logik und Willkür eines Autokraten. Stuttgart 2022
- Figes, Orlando: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution von 1891 bis 1924. Berlin 1998
- Gitermann, Valentin: Geschichte Russlands I-III. Zürich 1944-1949
- Hildermeier. Manfred: Die Sowjetunion 1917-1991. Berlin / Boston 2016
- Hosking, Geoffry: Russland. Nation und Imperium 1552-1917. Berlin 2003
- Jobst, Kerstin J.: Geschichte der Ukraine. Stuttgart 2022
- Kappeler, Andreas: Geschichte der Ukraine. München 2014, aktualisierte Aufl. zuletzt 2022
- Kellmann, Klaus: Dimensionen der Mittäterschaft. Die europäische Kollaboration mit dem Dritten Reich. Wien 2019, insb. S. 377 -408
- Plotkhy, Serhii: Die Frontlinie. Warum die Ukraine zum Schauplatz eines neuen Ost-West-Konfliktes wurde. Hamburg 2021
- Schlögel, Karl: Grenzland Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent. München 2013
- Stökl, Günther: Russische Geschichte. Stuttgart 1990, 5. erw. Aufl.
- Tooze, Adam: Sintflut. Die Neuordnung der Welt 1916 – 1931. München 2015