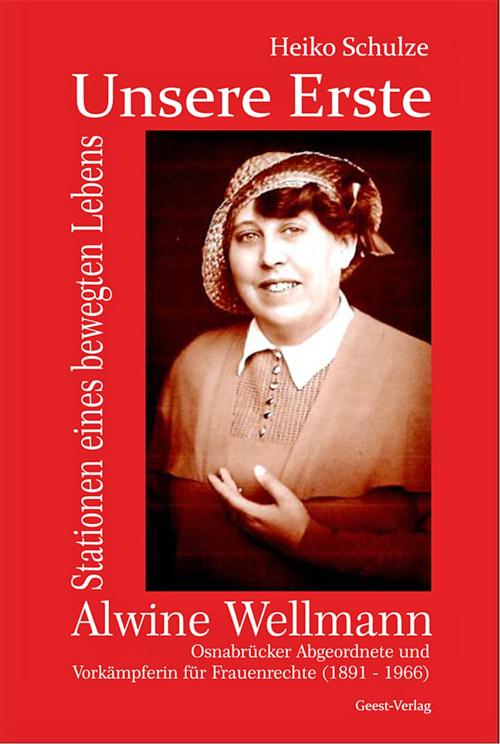Versuch einer Darstellung und Würdigung seines Werkes
(Dritter von fünf Teilen)
Kants politische Philosophie der Freiheit und Gleichheit
Auch wenn Kants Schriften zur politischen Philosophie in das Altenteil seines Schaffens fallen, heißt das nicht, dass er vorher ein unpolitischer Mensch war. Ganz im Gegenteil. Berichte von Zeitgenossen belegen sein lebhaftes Interesse an der Gegenwartspolitik, wobei der siebenjährige Krieg, der ihn auch räumlich unmittelbarer berührte, denn Königsberg war streckenweise von Russland besetzt, kaum Erwähnung findet. Verbürgt ist seine Parteinahme für die Unabhängigkeit der englischen Kolonien in Nordamerika vom Mutterland und die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kunde von der Revolution in Frankreich elektrisierte ihn so sehr, dass er alle Neuigkeiten in sich aufsog.
Kants Beiträge zur politischen Philosophie standen lange Zeit ganz im Schatten seiner Vernunftkritik und Ethik. Sein Traktat Zum ewigen Frieden ist nach wie vor das bekannteste und meistdiskutierte Werk. Seine anderen Beiträge zum Politischen verteilen sich auf kleinere Schriften. Mit einem Schwerpunkt auf die Rechtslehre und den Staat findet sich das systematisch in der Metaphysik der Sitten, die allerdings erst in jüngster Zeit verstärkte Beachtung finden. Bertrand Russell beispielsweise hielt Kants Beiträge zur Politik für „nicht bedeutend“, nahm etliche seiner späten Schriften aber wie viele andere auch gar nicht zur Kenntnis. (Russell, 715) Keine Partei hat Kants liberale Grundeinstellung dazu animiert, ihn als einen ihrer großen Vordenker zu vereinnahmen.
Sein politisches Denken hat dem Anschein nach nicht die Qualität wie seine Bestimmung dessen, was wir wissen können und tun sollen. Zwar entsprechen seine politischen Gedanken keiner „kopernikanischen Wende“ wie seine Erkenntnistheorie, aber sie sind in manchen Bereichen neu und „radikal“, weil sie – besonders ausgeprägt in der Friedensschrift – tiefer bohren und sich nicht scheuen, scheinbar Unmögliches zu denken und zu fordern. Er bewegt sich zwar auch in einem der Aufklärung entsprechenden politischen Mainstream, der individuelle Freiheit und Herrschaft des Rechts propagiert, aber darin allein erschöpfen sich seine Analysen und Vorschläge nicht. Seine wichtigsten theoretischen Bezugspersonen waren Thomas Hobbes (1588 – 1679) und Jean- Jacques Rousseau (1712 – 1778), also zwei gegensätzliche Positionen, und weniger Montesquieu (1689 – 1755), obwohl die Lehre von der Gewaltenteilung bei Kant eine zentrale Rolle einnimmt.
Kants Beiträge zur politischen Philosophie, zur aktuellen Politik im engeren Sinne hat er sich nicht geäußert, sind untrennbar verbunden mit seinen kurzen Abhandlungen, die disziplinär der Geschichtsphilosophie zugeordnet werden. Sie bilden die Basis seines politischen Denkens und durch sie wird auch erkennbar, dass schon die Vernunft für sich etwas sehr Politisches ist.
Kant als Philosoph der Aufklärung
Nichts verbindet sich mit dem Namen Kant mehr als die Idee der Aufklärung. Im September 1784 erscheint in der „Berlinische Monatsschrift“, eine der renommiertesten Zeitschriften des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, ein Aufsatz mit dem Titel: „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ Mit dieser preisgekrönten Schrift brachte Kant eine Epoche mit dem Leitspruch „sapere aude“ (wage es, selbst zu denken) auf den Begriff.
Was dem nach Kant entgegensteht, ist „Faulheit und Feigheit“, denn für einen „großen Teil der Menschen“ ist es einfacher und bequemer für sich denken zu lassen (auch gegen Bezahlung), als selber zu denken. Aber Kant beschränkt seine Hoffnungen eines Erfolges der Aufklärung nicht auf die Überwindung dieser Faulheit. Erforderlich ist dafür viel mehr, nämlich die Herstellung von Rahmenbedingungen und die sind politischer und gesellschaftlicher Art.
Das zu erreichen, erschien ihm noch ein gutes Stück Arbeit. Aber er war sicher, dass sich die Befähigung des Menschen dazu, die er in der Gattungsgeschichte der Menschheit zumindest für nicht ausgeschlossen hielt, verwirklichen werde. Der Weg aus der Unmündigkeit ist für den Einzelnen umso schwieriger wie er sich darin eingerichtet hat. „Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu wickeln, und dennoch einen sicheren Gang zu tun.“ (VI. 54) Deshalb sei es eher möglich, „daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit läßt, beinahe unausbleiblich.“ Denn es werden sich immer einige „Selbstdenker“ finden, die das „Joch der Unmündigkeit“ abwerfen und sich auch gegen Widerstand verbreitern, weshalb das „Publikum nur langsam zur Aufklärung“ gelangt. (VI. 55) Kant setzt dabei aber nicht auf eine Revolution, denn sie wird „wohl ein Abfall von persönlichen Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart“ zu Stande bringen, sondern nur neue Vorurteile für „einen gedankenlosen großen Haufen“ liefern. (VI. 55) Diese Sätze schreibt Kant knapp fünf Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution.
Zur Aufklärung gehört für Kant nichts weiter als Freiheit, und zwar die „unschädlichste unter allen, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.“ (VI. 55) Dagegen stehe von allen Seiten das Gebot: „räsonniert nicht“, allerdings mit der Ausnahme des einzigen Herrn, der da sage: „räsonniert, so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; aber gehorcht!“ Und hier erweist sich der „große Dulder“ auf dem preußischen Königsthron als Gewinn für die Aufklärung, denn seine Haltung sei ihr förderlich. Denn: „der öffentliche Gebrauch (der) Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung unter Menschen zu Stande bringen“. (VI. 55)
Der „Privatgebrauch“, das sind Restriktionen für bestimmte Berufsgruppen mit Rücksicht auf ihr Amt, dürfe eingeschränkt werden, ohne dass der Fortschritt der Aufklärung dadurch leide. Kant sieht den öffentlichen Gebrauch der Vernunft denjenigen, der „als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt“ Gebrauch macht, gibt aber auch jenen das Recht auf Teilnahme, wenn sie es außerhalb ihres Amtes als Teil der „Weltbürgergesellschaft“ tun. Doch alle denkbaren Restriktionen, die Kant, akribisch wie er ist, aufführt, finden auch Schlupflöcher und selbst der „Geistliche“ erfreut sich als „Gelehrter“ des Rechts zum öffentlichen Vernunftgebrauch, wenn er zum „eigentlichen Publikum, nämlich der Welt“ spreche. (VI. 57) Und spitzfindig setzt er hinzu: „Denn daß die Vormünder des Volks (in geistlichen Dingen) selbst wieder unmündig sein sollen, ist eine Ungereimtheit, die auf Verewigung der Ungereimtheiten hinausläuft.“ (VI. 57)
Alle Versuche die Aufklärung durch Beschlüsse zu behindern, wäre „ein Verbrechen wider die menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung gerade in diesem Fortschritt besteht.“ Und der „Probierstein alles dessen, was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, liegt in der Frage: ob ein Volk sich selbst wohl solch ein Gesetz auferlegen könnte?“ (VI. 58) Dieser Passus zeigt in Verbindung mit einem weiteren, der das Recht eines Monarchen bestreitet, etwas gegen den gesamten Volkswillen zu beschließen, dass Kant einen Volkswillen unterstellt, dem es aber noch an Klarheit fehlt und die Frage nach dem Souverän impliziert. (VI. 59)
Vorerst aber lobt und bezeichnet er die Aufklärung als das Zeitalter seines obersten Landesherrn. Kant befindet, man lebe zwar noch nicht in einem „aufgeklärten Zeitalter“, „aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung“ und das sei eben das Jahrhundert Friederichs II., denn dieser sei selber aufgeklärt wie insbesondere seine Toleranz in Religionsdingen belege. (VI. 59 f.) Kant unterschlägt nicht, dass auch dieser Herr allem freien Räsonnieren zum Trotz auf den Gehorsam seiner „Untertanen“ bestehe, aber dennoch sei „ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit“ für die „Freiheit des Geistes des Volkes“ vorteilhaft für die weitere Ausbreitung der Aufklärung durch den öffentlichen Gebrauch der Vernunft. (VI. 61)
Der Mensch und seine Geschichte
Kants Skepsis gegenüber Revolutionen in Sachen Fortschritt des Vernunftgebrauchs hat einen einfachen Grund. Die Aufklärung vollzieht sich gemächlich und durchaus diskontinuierlich. Das erlebte Kant leibhaftig in seinem Heimatland Preußen zwei Jahre nach seiner Lobeshymne auf Friedrich den Großen. Als der die Erde verließ bereitete sein stark religiös geprägten Nachfolger Friedrich Wilhelm II. der Ära der Toleranz ein jähes Ende, indem er fortan das Gehorchen auch auf das Räsonnieren ausdehnte.
Da stellt sich die Frage, aus welchen Grundannahmen, außer einem Selbstläufer des Weges der Menschheit aus dem „Gängelwagen der Instinkte zur Leitung der Vernunft“ (VI. 92), bezieht Kant seinen Optimismus einer Entwicklung zum Besseren? In welchem Verhältnis steht er zum allgemeinen Glauben an den Fortschritt im Zeitalter der Aufklärung? Wie positioniert er eine Fortschrittsidee mit dem Glauben an die Vernunft als Trägerin ewiger Wahrheiten mit dem Relativismus der geschichtlichen Entwicklung, denn die Aufklärung glaubt zwar an den Fortschritt, ist aber zugleich wenig „historisch“ orientiert, was auch für Kant selbst gilt.
Klar ist für Kant, dass es keine Geschichte a priori gibt. Die sei nur möglich, wenn der „Wahrsager die Begebenheiten selber macht und veranstaltet, die er zum voraus ankündigt.“ (VI. 351) Einen solchen großen Wahrsager schließt Kant aus, da er die Geschichte der Menschheit keiner transzendentalen Macht übergibt, sondern sie in die Hände und vor allem in die Köpfe der Menschen legt. Mit der unterstellten Freiheit des Willens als anthropologischer Prämisse liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Menschen ihre Geschichte selber machen. Ganz so einfach stellt sich Kant das aber nicht vor. Denn neben „dem Spiel der Freiheit des menschlichen Willens“ gibt es im großen betrachtet einen „regelmäßigen Gang“ einer die Gattung als Ganze betreffende allmähliche „stetig fortgehende obgleich langsame Entwicklung der ursprünglichen Anlagen derselben.“ (VI. 33)
Kant unterstellt hier, dass eine dem Schein (phaenomena) verborgene Naturabsicht (noumena) der Gattung ihre Anlagen „vollständig und zweckmäßig“ zur Entfaltung bringt. So verläuft die Geschichte nicht nach einem von der Vernunft der Menschen erdachten Plan. Der Mensch hat zwar den „Gängelwagen der Instinkte zur Leitung der Vernunft“ verlassen (VI. 92), aber sie sind deshalb noch keine „vernünftigen Weltbürger“, die „nach einem verabredeten Plane, im ganzen verfahren“. Ergo scheint ihnen „keine planmäßige Geschichte“ möglich zu sein. (VI. 34)
Kant zieht daraus den kühnen Schluss, da er bei den „Menschen und ihrem Spiel im großen gar keine vernünftige eigene Absicht voraussetzen könne“, versuche er, „ob er nicht eine Naturabsicht in diesem widersinnigen Gange menschlicher Dinge entdecken könne; aus welcher, von Geschöpfen, die ohne eigenen Plan verfahren, dennoch eine Geschichte nach einem Plane der Natur möglich sei.“ (VI. 34) Aus diesem Widersinn heraus entwickelt Kant seine Anthropologie und Geschichtsphilosophie. In konzentrierter Form finden wir sie in Kants Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht ebenfalls aus dem Jahre 1784. (VI. 31 – 50)
Der Ausgangspunkt ist die teleologische Naturlehre, die besagt, dass alle Naturanlagen eines Geschöpfes dazu bestimmt sind, sich „einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln“. Das ist für Kant eine notwendige Annahme, weil wir andernfalls von einer gesetzlosen und zwecklos spielenden Natur ausgehen müssten, womit ein „trostloses Ungefähr an die Stelle des Leitfadens der Vernunft“ treten würde. Dass dies eine sehr weitreichende Grundannahme ist, die Zündstoff für umfangreiche Debatten bietet, sei hier nur am Rande vermerkt.
Der Mensch ist nun das einzige mit der Befähigung zur Vernunft ausgestattete Geschöpf auf Erden, woraus Kant folgen lässt, dass sich die Vernunft deshalb vollständig nur durch deren Gebrauch entwickeln kann und muss, dies aber nur in der Gattung insgesamt vollzogen werden kann, nicht im Individuum. Die Vernunft entwickelt sich nicht instinktmäßig, sondern, wie bei allen anderen Organen auch, nur durch ihren Gebrauch, durch permanente Übung. Wie Muskeln, die nicht gebraucht werden, verfällt auch die Vernunft bei Nichtgebrauch. Da zudem für die volle Entfaltung der Naturanlage der Menschen ein Menschenleben zu kurz ist, vollzieht sie sich allein in der Gattung, wo jeder einzelne an dem erreichten Stand durch Weitergabe partizipiert und dann immer mehr Raum zur Entfaltung benötigt. (VI. 35 f.)
Die „ungesellige Geselligkeit“ als Motor der Menschheitsgeschichte
Nun steht den Chancen der Menschen durch die Vernunft das mögliche Manko der Instinkte oder Leidenschaften gegenüber. Da die Natur nichts Überflüssiges tut, hat sie den Menschen mit ihrer Vernunftausstattung auch die gesamte Lebensgestaltung übergeben. Moderner gesprochen vertritt Kant die Position, dass der Mensch durch die Vernunft und gleichzeitigen Instinktmangel dazu verdammt ist, vom Natur- zum Kulturwesen zu werden, das seine eigne von ihm gestaltete Welt hervorbringt. Um diese Entwicklung zu ermöglichen bedient sich die Natur als Mittel eines „Antagonismus“. Damit meint Kant einen inneren Widerspruch im Menschen an sich, den Widerstreit zwischen Einzelwesen mit seinen eigenen Bedürfnissen und als Sozialwesen, der Angewiesenheit auf die anderen, um überleben zu können. Kant hat für diesen Antagonismus die wunderbare Formulierung der ungeselligen Geselligkeit des Menschen kreiert. (VI. 37) Hier liegt die treibende Kraft für die menschlichen Antriebe, den Zustand der „Rohigkeit“ zu verlassen und zur „Kultur“ zu gelangen, die „eigentlich in dem gesellschaftlichen Wert des Menschen besteht“. (VI. 38) Hier entwickeln sich alle Talente und Anlagen inklusive der Aufklärung mit einer allgemeinen Moral. Aber die Natur meldet sich in der Ungeselligkeit. Sie will Zwietracht statt Eintracht.
Und so zwingt die Natur die Menschengattung zur Lösung ihres „größten Problems“: „die Errichtung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft.“ (VI. 39) Diese bürgerliche Gesellschaft, die „größte Freiheit“ für alle ihre Mitglieder schafft, gesichert durch „äußere Gesetze“ in einer „gerechten Verfassung“, ist die „höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattung“. Nur durch die Lösung dieser Herausforderung kann die Natur ihre „übrigen Absichten mit unserer Gattung erreichen.“ (VI. 39)
Hier liegt das größte und zugleich schwerste Problem der Menschengattung. Der Mensch muss sich selbst überlisten, denn alle „Kultur und Kunst“, die ganze Zierde der Menschen sind „Früchte der Ungeselligkeit“, die uns nötigen, sie zu überwinden. Denn der Mensch ist auch ein Tier, das einen Herrn nötig hat. Er bedarf um seiner eigenen Freiheit willen eines Herrn, dem er sich unterwirft ohne dessen Knecht zu werden. „Das höchste Oberhaupt soll aber gerecht für sich selbst, und doch ein Mensch sein.“ Kant nennt dies die schwierigste Aufgabe und ihre „vollkommene Auflösung ist unmöglich: aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert werden.“ (VI. 41) In dieser herrlichen, geradezu poetischen Definition des Menschen ist das ganze Drama des menschlichen Daseins auf den Begriff gebracht. Mehr als eine Annäherung zu dieser Idee hat uns die Natur nicht auferlegt, die Antwort ist erst spät zu erwarten, sie bedarf auch der Vorbereitung durch neue Erfahrungen und die richtigen Begriffe.
Kant steigert das Problembündel mit einem weiteren Satz, dass die „vollkommene bürgerliche Verfassung“ von den „Problem eines gesetzmäßigen äußeren Staatsverhältnisses abhängig ist“ und ohne diese nicht gelöst werden könne. Hier vollzieht Kant den Übergang von der Lösung des Ordnungsproblems auf der Staatsebene, also durch Gewaltmonopol und Rechtsstaat, auf die Weltebene, der Überwindung der Anarchie der Staatenwelt. Also jene Problemlage, die wir im Teil 2 mit der Beschäftigung seines Traktats Zum ewigen Frieden schon ausführlicher behandelt haben. Die Fortsetzung der „Ungeselligkeit“ auf der Ebene der Staaten untereinander erfordert eine Überwindung des „gesetzlosen Zustands“ durch einen „Völkerbund, wo jeder, auch der kleinste Staat seine Sicherheit und Rechte, nicht von eigener Macht, oder eigener rechtlichen Beurteilung, sondern allein von diesem großen Völkerbunde von einer vereinigten Macht, und von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens, erwarten könnte.“ (VI. 42)
Aber diese Entwicklung ist kein Selbstläufer. Kant verweist darauf, dass es die Möglichkeit eines Rückfalls in die Barbarei früherer Wildnis gäbe, aber auch die, dass es der Gattung gelinge, sich zur „Weltbürgerlichkeit“ zu entwickeln. Er lässt keinen Zweifel, dass dies unentschieden sei. „Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert. Wir sind zivilisiert, bis zum Überlästigen, zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber, uns für schon moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die Moralität gehört noch zur Kultur; der Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äußeren Anständigkeit hinausläuft, macht bloß die Zivilisierung aus.“ (VI. 44) Es sei hier nur noch angemerkt, dass bei Kant die komplexe Geschichte der Unterscheidung von Kultur und Zivilisation angelegt ist, er aber deshalb natürlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, was insbesondere in Deutschland im Umfeld des Ersten Weltkrieges daraus zum Zwecke der Sinngebung des Gemetzels gemacht wurde.
Was Kant hier entwickelt ist ein wesentliches Element seiner Philosophie. Es ist das Auseinanderfallen des zivilisatorischen und kulturellen Fortschritts, wobei im letzteren die Entwicklung der Moral ins Zentrum gerückt wird. Entscheidend ist für Kant, dass dieser Zustand nur durch eine Moral entsteht, die nicht von außen aufgepfropft wird. Sie muss durch innere Einsicht einer von der Vernunft gewollten Erkenntnis entstehen, wie man sich durch Selbstgesetzgebung aus dem chaotischen Zustand herausarbeiten kann, um so den „verborgenen Plan der Natur“ entsprechend, „einen innerlich- und zu diesem Zwecke, auch äußerlich-vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu bringen.“ (VI. 45) Denn die „Geschichte der Menschengattung“ ist im Großen „die Vollziehung eines verborgene Plans der Natur“, eine „Staatsverfassung“ zu schaffen, „in der sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann.“ (VI. 45)
Das von Kant als Telos der Menschheit unterstellte Ziel der Geschichte folgt einer „Naturanlage“, die er nicht biologisch versteht. Die Frage, was diese „Naturanlage“ ist und woher sie kommt, hat Interpretationen hervorgerufen, hier einen versteckten Plan eines höheren Wesens zu vermuten. So wie in seiner Moralphilosophie Gottes Hilfe von Nutzen wird, so bildet sich auch in Bezug auf seine Geschichtsphilosophie die Vermutung, dass hier „höhere Mächte“ ins Spiel gebracht werden, die schließlich eine Heilsgeschichte offenbaren. (Burg, 242 f.) Auch wenn Kant trotz allen von ihm vorgebrachten Widerlegungen der Gottesbeweise kein Atheist war, aber gegen einen göttlichen Heilsplan gar noch christlicher Provenienz steht Kants Ausgangspunkt, das Axiom von der Freiheit des Menschen als anthropologisches Prinzip, das sich dann in der Geschichte als nicht geradlinig verlaufender Prozess realisieren kann, aber nicht muss. Es ist eine „Bedingung der Möglichkeit“, mehr nicht. Keine Notwendigkeit, aber auch nicht ausgeschlossen als „Wider die Natur“, sondern allein eine Frage des freien Willens freier Menschen und ihrer Entwicklung zur und durch die Vernunft.
„Kant sieht die Naturbedingungen mit den Freiheitsbestimmungen ‚einstimmig‘, aber mit der Einschränkung, dass sich diese nur auf das Leben der Gattung und nicht auf das Individuum beziehen. Die Natur hat den Menschen mit der Befähigung zur Vernunft ausgezeichnet, damit er diese vollkommen entwickle, was aber nicht das Werk eines Einzelnen sein könne. Dafür sei das Leben zu kurz, es sei ein unendlich langer Prozess der Gattung, (ein kumulatives Werk des Lernens?), die Weitergabe stellt die späteren höher und in den Genuss des Vorbereiteten, die von ihrem Wert keine Ahnung und keinen Gewinn hatten. Das Medium dieser List ist der Antagonismus der Kräfte in der Gesellschaft, die ungesellige Geselligkeit, der Streit von Individuum und Gemeinschaft“. (Kronenberg, 243) Vor hundert Jahren wurde aus ähnlichem Anlass diese knappe und präzise Zusammenfassung geschrieben.
Von dem großen Endziel, so Kant, mögen wir noch weit entfernt sein, so wirken doch ohne Absicht viele Dinge in diese Richtung, was für Kant selbst für den Krieg geltend macht, der durch seine eigenen Nachteile, misslichen Folgen und Kosten seine Selbstverständlichkeit verliere. Auch wenn der vollkommene Staatskörper erst als „roher Entwurf“ vorhanden sei, so wirken doch immer mehr Kräfte mit an dem Werk der „höchsten Absicht der Natur“, „ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand, als der Schoß, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung“ sich entfalten können. (VI. 47) Aber Kant verweist auch darauf, dass es sich hier nicht um chiliastische Naherwartungen handelt, sondern mit Blick auf den realen Verlauf der bisherigen Menschheitsgeschichte um eine wirkliche Entwicklung, aber keinesfalls will er der Weltgeschichte einen Leitfaden a priori verordnen und damit die Empirie der Historie verdrängen.
Kants Geschichtsphilosophie im Kontext der Aufklärung
Versucht man aus dieser kurzen Skizze seiner Geschichtsphilosophie eine Bilanz zu ziehen, so fällt zunächst auf, wie weit schon früher die zentralen Gedankengänge, die insbesondere in seiner Schrift Zum ewigen Frieden so bedeutsam sind, hier vorausgedacht sind. Für Ernst Cassirer kommt Kants kleineren Schriften zur Geschichtsphilosophie für den „inneren Fortgang des deutschen Idealismus“ eine „kaum geringere Bedeutung zu wie die Kritik der reinen Vernunft.“ (Cassirer: Kant, 237) Die Abhandlung der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht ist ein Schlüsseltext in Kants gesamter politischen Philosophie, denn darauf läuft alles hinaus.
Bevor wir uns dieser im engeren Sinne widmen, um den Kern seiner „Rechts- und Staatstheorie“ und seinen Begriff von der „Republik“ im Verhältnis zur „Demokratie“ näher untersuchen, sollen in einem Zwischenfazit seine all dem zugrundeliegenden geschichtsphilosophischen und anthropologischen Voraussetzungen im Kontext der Aufklärung im 18. Jahrhundert kurz gewürdigt werden.
Was Kant vorfindet, sind leicht vereinfacht zwei konkurrierende Theorien über das „Wesen“ des Menschen oder auch seiner „Natur“ und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für das Zusammenleben der Menschen. Während der Engländer Thomas Hobbes von der denkbar asozialsten Ausstattung des Menschen im fiktiven Naturzustand ausgeht, ihn mithin als „Böse“ qualifiziert, widerspricht ihm Rousseau mit der Gegenposition der „natürlichen Güte“, die er in seinem Emile begründet und entwickelt und in seinem Contrat social voraussetzt.
Kant bewegt sich hier in der Mitte. Er spitzt seine Überlegungen auf die Frage zu, ob es mit dem Menschengeschlecht insgesamt zum Besseren gehe oder nicht. Für Kant geht es – wie er im Streit der Fakultäten darlegt – beim Fortschritt allein um die Sittengeschichte und zwar „dem Ganzen der gesellschaftlich auf Erden vereinigten, in Völkerschaften verteilten Menschen (universorum), wenn gefragt wird, ob das menschliche Geschlecht (im großen) zum Besseren beständig fortschreite.“ (VI. 351)
Drei mögliche Varianten lassen sich über die Entwicklung des Menschengeschlechts vorhersagen: Rückgang, Fortgang und Stillstand. „Das menschliche Geschlecht ist entweder im kontinuierlichen Rückgange zum Ärgeren, oder im beständigen Fortgange zum Besseren in seiner moralischen Bestimmung, oder im ewigen Stillstande auf der jetzigen Stufe seines sittlichen Werts unter den Gliedern der Schöpfung (mit welchem die ewige Umdrehung im Kreis um denselben Punkt einerlei ist)“. (VI. 353)
Die Hypothese des Stillstands bedeute, „geschäftige Torheit (sei) der Charakter unserer Gattung.“ (VI. 354) Hier verschmelzen die gegensätzlichen Anlagen nicht, sie neutralisieren sich. Zudem ist diese Variante kaum möglich, weil es ewigen Stillstand weder gibt noch geben kann.
Ein „Rückgang zum Ärgeren“ ist als gesamter Verlauf der Menschheitsgeschichte nicht vorstellbar, „denn bei einem gewissen Grade desselben würde sich (die Menschheit) selbst aufreiben.“ Probleme und Gräuel würden sich türmen und zur Umkehr mahnen.
Bliebe als dritte Variante der Fortgang zum Besseren, den Kant als Eudämonismus bezeichnet. Hier stellt sich das ähnliche Problem wie zuvor, nur anders herum. Das Fortschreiten zum Besseren ist möglich, aber kein Selbstläufer der menschlichen Natur. (alle Zitate VI. 353) Kant hat das in seiner Replik auf Moses Mendelssohn dahingehend präzisiert, dass die Entwicklung zum Besseren zwar unterbrochen, aber unmöglich abgebrochen werden könne. (VI. 167) Andernfalls verlöre alles Dasein und menschliches Handeln jeglichen Sinn. Auch alle Zweifel an der Besserung werden mit Übeln jeglicher Art konfrontiert, die als Beweise der Herrschaft des Bösen gelten und doch nach einer Veränderung und Verbesserung rufen. Und so lassen Fatalismus wie Pessimismus zwar „das Elend zu hohen Jahren kommen“, aber sie rufen auch nach Taten und Ideen, um uns aus dem Elend zu befreien. Und so wie die Menschen nicht als Engel, aber eben auch nicht als Teufel, sich in den Zustand der bürgerlichen Verfassung des Rechts, der Freiheit aller und der Rechtsgleichheit aller begeben, so wird die „Not aus den beständigen Kriegen“ sie „zuletzt dahin bringen, selbst wider Willen, entweder in eine weltbürgerliche Verfassung zu treten“ oder zumindest in einen „rechtlichen Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht.“ (VI. 169)
Die Dialektik dieses „Antagonismus“, die das Böse ins Gute verkehrt, ist eine dem 18. Jahrhundert vertraute Denkfigur. Goethe übertrug sie Mephisto, „als Teil von jener Kraft, / die stets das Böse will und stets das Gute schafft“. In Mandevilles Bienenfabel von 1705 verwandeln sich „private Laster“ in „öffentliche Wohlfahrt“, bei Adam Smith mehrt der allerdings „wohlverstandene Eigennutz“ den Reichtum der Nationen.
Albert O. Hirschman hat in seiner faszinierenden Abhandlung unter dem Titel Leidenschaften und Interessen dargestellt, wie im 18. Jahrhundert in der Moral- und Sozialphilosophie angesichts der neuen Verkehrsformen in der sich bildenden bürgerlichen Gesellschaft die Menschen nicht mehr primär als Träger von Leidenschaften bestimmt werden, die es durch mächtige und kräftige Institutionen unter Kontrolle zu bringen gilt (beispielhaft dafür Thomas Hobbes‘ Leviathan), sondern als Vertreter von Interessen. Diese sind kalkulierender Art und können auch durch imaginäre Medien, wie vorzugsweise die Mechanismen des Marktes, hinter dem Rücken der Akteure beispielsweise den Eigennutz ins Gemeinwohl überführen. Jedenfalls ist das der Glaube, mehr noch die „Ideologie“ des Bürgertums an die „prästabilierte Harmonie“ in ihrer individualistischen Konkurrenzgesellschaft.
Kant folgt solchen Überlegungen nur bedingt. Ideengeschichtlich bewegt sich Kant überwiegend im Kontext der angelsächsisch geprägten Moralphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, ohne dem Utilitarismus zu folgen. Er folgt partiell Adam Smiths Theorie der ethischen Gefühle (1759), aber seine sozialökonomische Theorie The Wealth of Nations, dem Klassiker des nicht nur ökonomischen Liberalismus schlechthin, übergeht er. Das ist angesichts der gegenüber England gänzlich unterentwickelten gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse im damaligen Preußen auch nicht verwunderlich. So entstehen bei Kant zwar Bezüge zu gesellschaftlichen Konflikten als Triebkräfte der Geschichte, aber in Kants Anthropologie übersetzt erscheinen sie nicht als „Klassenkämpfe“, sondern als Vertreter anthropologischer Repräsentanten in dem Gegensatzpaar von Engeln und Teufeln, zwischen denen Kant die Menschen als Möglichkeiten ansiedelt. Kants Argumentation verbindet und scheidet die beiden konträren Sozialtheorien von Hobbes und Rousseau, indem er sie allerdings mit einem nahezu metaphysischen Begriff der „Natur“ überwindet als einem Fahrplan, der keiner ist, aber „hinter dem Rücken“ der Akteure zur Entfaltung kommt.
Wie oben gezeigt, entkommt er damit auch den geschichtsphilosophisch fatalen Konstruktionen von Verfall oder Aufstieg der Entwicklung vom Guten zum Schlechteren und vice versa. Alles andere widerspräche auch dem Weg vom „Gängelwagen der Instinkte zur Leitung der Vernunft“ als Möglichkeit zu nutzen. (VI. 92) Es liegt in unserem freien Willen, was wir aus dem Vermögen auch der menschlichen Vernunft machen. Insofern ist Kants Geschichtsphilosophie frei von „Gesetzen“, sie ist frei von jeglichem Determinismus und sie ist kontingent, zukunftsoffen.
Kants Geschichtsdeutung schafft Raum für Hoffnung. Damit sich die Vernunft in einer Sphäre der Aufklärung entfalten kann, sind allerdings ein paar Rahmenbedingungen erforderlich. Was die Vernunft zu ihrer freien Entfaltung bringt, ist eine Öffentlichkeit, die den freien Austausch der Gedanken erlaubt und ermöglicht. Es handelt sich hier nicht um ein originäres Menschenrecht, sondern um die Bedingung der Möglichkeit der Entfaltung der Vernunft überhaupt. Eine rein private Vernunft ist ein Widerspruch in sich. Vernunft ist das Allgemeine. Der Philosoph und Soziologie Georg Simmel hat deshalb das 18. Jahrhundert auch zu Recht als das „Jahrhundert des Allgemeinen“ bezeichnet.
Was heißt das? Die Vernunft entfaltet sich im intersubjektiven Austausch der denkenden Geister nur im freien öffentlichen Diskurs, im friedlichen Streit jedem zugänglicher Argumente kann sich allein eine Wahrheitsfindung und reflektierte Meinungsbildung konstituieren. Wahrheit und vernünftige Lösungen für Probleme zu finden, Weltorientierungen zu erkunden, moralische Urteile wie auch die ästhetischen zu schärfen und zu begründen, all das ist ohne Publizität nicht vorstellbar. Deshalb ist Öffentlichkeit die zentrale Institution für die Entfaltung der Vernunft.
Kant und die Französische Revolution
Als „zwiespältig“, aber nicht „widersprüchlich“ bezeichnet Willaschek (Willaschek, 159) Kants Verhältnis zur Französische Revolution. Er begrüßt sie nahezu emphatisch als eine große Tat eines „geistreichen Volkes, die wir in unseren Tagen haben vor uns gehen sehen, mag (sie) gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greueltaten derart angefüllt sein, daß ein wohldenkender Mensch sie, wenn er sie, zum zweitenmale unternehmend, glücklich auszuführen hoffen könnte, doch das Experiment mit solche Kosten zu machen nie beschließen würde – diese Revolution, sage ich, findet doch in den Gemütern aller Zuschauer (die nicht selbst in diesem Spiele verwickelt sind) eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiasm grenzt, und deren Äußerung selbst mit Gefahr verbunden war, die also keine andere, als die moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann.“ (VI. 358)
Kant erklärt auch, dass der Eingriff von außen, die Verfassung der Revolution mit Gewalt, also Krieg, rückgängig zu machen, Unrecht ist. Aus der Tatsache, dass die Revolution nun stattgefunden und sich behauptet habe, folgert Kant, dass sie auch bleiben solle. So hat er sie gegen die meisten von denen als einen großen Schritt zum Besseren verteidigt, die entweder bei der Enthauptung des Königs oder der Terrorherrschaft abfielen und sogar ins Gegenlager übergingen wie sein früherer Schüler Friedrich Gentz.
Eine positive Erwähnung findet sich schon in einer Fußnote seiner Kritik der Urteilskraft von 1790. In einem Abschnitt (§ 65) über „Naturzwecke“ hebt der das Wort Organisation hervor, das „bei einer neuerlich unternommenen gänzlichen Umgestaltung eines große Volkes zu einem Staat“ (auch so kann man das umschreiben) bei der Einrichtung des neuen „Staatskörpers“ eine Rolle spiele und zum Ausdruck bringe, das „jedes Glied soll freilich in einem solchen Ganzen nicht bloß Mittel, sondern zugleich auch Zweck, und, indem es zu der Möglichkeit des Ganzen mitwirkt, durch die Idee des Ganzen wiederum, seiner Stelle und Funktion nach, bestimmt sein.“ (V. 487) Kant wird damit nicht zum Vordenker der hundert Jahre später aufkommenden reaktionären „organischen Staats- und Gesellschaftslehre“ eines Othmar Spann. Im Zentrum seiner Bewunderung steht, dass sein moralischer Grundsatz, Menschen nie als Mittel zum Zweck zu missbrauchen, hier in einem „Staatskörper“ Folge geleistet werde.
In Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft weist er 1793 sogar das verbreitete und bei Revolutionsgegnern beliebte Argument zurück, die Menschen, gemeint ist das einfache Volk, sei für das Unternehmen einer Revolution zum Zwecke der Selbstregierung nicht reif, mit dem Einwand zurück, diese Reife erwerbe man sich nur dadurch, dass man sich das Recht und die Freiheit dazu nehme, denn Freiheit lerne man eben nur in Freiheit und durch den Gebrauch derselben. Dass die „ersten Versuche“ auch „roh“ erfolgen, was sich in Frankreich mit Beginn der Jakobinerherrschaft gerade abzeichnete, verteidigt Kant sogar als quasi schwer vermeidbar. (zit. nach Fetscher, 273)
Kants Dilemma bestand nicht primär darin, dass er die Jakobinerherrschaft ebenso wie die Enthauptung des Königs verabscheute, sondern darin, dass das gesamte Unternehmen Revolution eigentlich im kompletten Widerspruch zu seiner Rechtslehre stand. Denn die schloss so etwas deshalb aus, weil dadurch ein bestehender Rechtzustand – gewaltsam oder nicht – aufgelöst wird, ohne einen neuen zu installieren und dadurch entstehe der Rückfall in jenen Naturzustand der Rechtlosigkeit, der um jeden Preis verhindert werden müsse. Jeder revolutionäre Akt ist mithin ein Verbrechen gegen das geltende Recht, auch wenn es – wie im Falle der Französischen Revolution – in der Entwicklung des Rechts einen Fortschritt darstellt. Kant stellt hier die Funktion des Staates als Garanten des Rechts über das bessere Recht, das der Staat schützen soll. (Willaschek. 159) Aber da eine wünschenswerte Reform der Verfassung zuvor nicht möglich war, wünschte er dennoch die Unumkehrbarkeit der Revolution. (VI. 361)
Hier wird schon ganz deutlich, dass für Kant der staatsbürgerliche Zustand, das heißt das Gewaltmonopol bzw. die Rechtssicherheit und die Freiheit auf einen Staat und seine Bürger bezogen, nur ein Zwischenschritt sein kann. Solange Krieg zwischen Staaten herrscht oder möglich ist, fehlt die entscheidende Bedingung: der Friede ist die Abwesenheit der Bedrohung der Freiheit von außen. Die Intensivierung der Kriege ist für Kant eine sich abzeichnende Konstante der damaligen Entwicklung, der nur durch einen großen Sprung ein Ende bereitet werden könne. Dieser große Sprung war die Französische Revolution, denn hier wurde das „Unbeschreibliche getan“, Kant akzeptiert zwar kein „Recht auf Revolution“ mit Berufung auf das Naturrecht, um die Freiheit durchzusetzen, aber da die Revolution nun in einen Rechtsstaat münde und im übrigen unumkehrbar sei, erteilt er ihr doch die Absolution.
Die Französische Revolution hat Kants politisches Denken mindestens insofern selber radikalisiert, als er die Gesetzgebung nicht mehr einem Herrscher zugestand, der Gesetze nach dem Prinzip des „Als ob“ das Volk sie sich geben würde, sondern dies dem Volk selbst als Souverän überträgt. Das sollte aber nicht in Form der Demokratie geschehen, worunter Kant immer noch eine direkte Demokratie verstand (etwa in kleinen Staaten oder Städten als Volksversammlung wie sie Rousseaus Modell unterstellt wurden), der es an Gewaltenteilung ermangele und damit für Kant unter den Begriff der Despotie fiel.
In seinem Spätwerk Metaphysik der Sitten hat er den „kategorischen Rechtsgehorsam“ für alle Staaten weiter präzisiert. Es ist die Errungenschaft der Herrschaft des Rechts, die uns aus dem Naturzustand gehoben hat, und die ist an keine inhaltlichen Kriterien wie die „Menschenrechte“ gebunden. „Wider das gesetzgebende Oberhaupt des Staats gibt es also keinen rechtmäßigen Widerstand des Volks; denn nur durch Unterwerfung unter seinen allgemein-gesetzgebenden Willen ist ein rechtlicher Zustand möglich.“ (IV. 439) Das ist Kants Credo und die logische Konsequenz lautet: „also kein Recht des Aufstands (seditio), noch weniger des Aufruhrs (rebellio)“ und auch nicht gegen einzelne Personen, nicht einmal gegen „Tyrannen“, all das sei „Hochverrat“ wofür er die Todesstrafe fordert. (IV. 439 f.) Als Begründung für diese „rechtspositivistische“ Sichtweise, die jedes geltende Recht für Recht gegen jede Legitimationsforderung als Gehorsamspflicht einklagt, führt Kant den Widerspruch an, dass ein gegen den Souverän rebellierendes Volk sich selber zum Souverän und damit Richter in eigener Sache machen wolle. In einer langen Fußnote demonstriert er dieses Argument verbunden mit seiner Abscheu am Beispiel der Hinrichtung von Karl I. in der englischen und Ludwig XVI. in der französischen Revolution. (IV. 440 ff.)
Kant ist hier unerbittlich in seiner Rechtslehre. Aufruhr ist unter keinen Umständen ein rechtmäßiges Mittel für ein Volk. Tyrannen, die das Volk kränken, geben kein Recht auf diese Art sein Recht zu suchen. (VI, 245) Kant schließt das als Widerspruch in sich aus. Kant kennt innerhalb des Rechts nur die Legalität, dessen Legitimität verschwindet in einer Morallehre, die keine Bedingungen zum Widerstandsrecht oder zur Widerstandpflicht vermittelt.
Dieser prinzipiellen Ablehnung der Revolution widersprach einer seiner Schüler 1795 in einer damals viel beachteten Kampfschrift, deren Titel das Programm beinhaltet: Über das Recht des Volks zu einer Revolution. Der Verfasser, Johann Benjamin Erhard, bewies damit, dass man „Kantianer“ und zugleich „Jakobiner“ sein konnte. Aber für Kant gab es keine „naturrechtliche Legitimation“ der Revolution. (Fetscher, 276) Das ist der Grund, warum Kant statt der Revolution, die immer mit der Gefahr des Rückfalls in den Naturzustand befrachtet ist, als praktische Politik zur Verbesserung des Menschengeschlechts den Weg der Reformen empfiehlt.
Kants Ideal wurde die britische Verfassung. Eine konstitutionelle Monarchie als Rechtsstaat, mit klarer Gewaltenteilung und einer repräsentativen Demokratie. Das war auch das, was er unter „republikanisch“ verstand. Gemeint war damit eine Regierungsform, keine Staatsform. Nur so konnte bei ihm auch eine Monarchie „republikanisch“ werden. Der Begriff umfasst das Ensemble dessen, was wir heute als „westliche liberale Demokratien“ verstehen mit freier Meinungsäußerung und Öffentlichkeit. Zu seiner Zeit war Kant mit Blick auf die Parteiungen der Französischen Revolution ein Girondist. Der Abbé Sieyès stand ihm wohl am nächsten.
Da Kant aber auch nicht bezweifelt, dass auch das Recht zuweilen einer Änderung bedarf, und der friedliche Weg der Reform auch am Widerstand gegenläufiger Mächte scheitern kann, stellt sich die Frage, was denn zu tun ist, wenn Recht gegen Recht steht? Hier sieht man Kant auf der Seite des geltenden Rechts, letztlich war dann ein „schlechter Staat“ immer noch besser als gar keiner, also die Anarchie. Es war nicht nur die Furcht vor einem Bürgerkrieg, es war ein prinzipielles Argument das besagte, dass es unmöglich ist, in eine Rechtsordnung zugleich das Recht auf Widerstand gegen diese Rechtsordnung einzubauen.
Nun war Kant aber auch der Zeitzeuge eines solchen großen Vorfalls, den er bekanntlich deshalb begrüßte, weil da Prinzipien zum Durchbruch gebracht wurden, die er sehr wohl guthieß. Kant fand dafür einen Ausweg, der seine vorhergehende Argumentation allerdings auf den Kopf stellt: „Übrigens, wenn eine Revolution einmal gelungen, und eine neue Verfassung gegründet ist, so kann die Unrechtmäßigkeit des Beginnens und der Vollführung derselben die Untertanen von der Verbindlichkeit, der neuen Ordnung der Dinge sich, als gute Staatsbürger, zu fügen, nicht befreien, und sie können sich nicht weigern, derjenigen Obrigkeit ehrlich zu gehorchen, die jetzt die Gewalt hat.“ (IV. 442) Herrscht hier nun die Macht über das Recht? Jedenfalls spricht Kant der Reaktion und den Restaurationsversuchen in Frankreich das Recht zur Wiederherstellung der alten Ordnung mit dem gleichen Argument ab, wie vorher den Revolutionären das Recht zum Sturz der alten Ordnung. Die aktuelle Frage, ob die auswärtigen Mächte ein Interventionsrecht zur Wiederherstellung der alten Ordnung hätten, delegiert er ans Völkerrecht. Die Antwort kennen wir aus dem Vertrag zum ewigen Frieden: ein kategorisches Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten.
In Kants Ausführungen zum Staatsrecht kommt weniger seine „zwiespältige Rolle“ zur Französischen Revolution zum Vorschein. Das Problem liegt in einem Rechtsbegriff, der zwar Freiheit und Gewaltenteilung als materiale Rechtsprinzipien einführt, aber auch offenlässt, ob es ein Widerstandrecht wenigstens dann gibt, wenn diese Prinzipien nicht vorhanden sind. Da es nicht einmal gegen Tyrannen ein solches gibt, wäre das negativ zu beantworten. Womit sich die Frage stellt, wie es überhaupt zu Fortschritten im Recht kommen konnte und künftig soll. Letztlich unterliegt Kant hier einem Staatsrechtspositivismus der dem moralischem Impetus des kategorischen Imperativs und dem Prinzip des Sollens widerspricht. Für den Kampf um das Recht bedarf es weiterer Kriterien als Kant geliefert hat. Welches Desaster aus seinen Maximen im Staatsrecht angesichts der totalitären Errungenschaften des zwanzigsten Jahrhunderts folgen, braucht hier nicht ausgebreitet zu werden.
Nicht nur die Besserwisser der Nachwelt stellen mit ihren Erfahrungen Kant Fragen, die er in seinem logisch so bestechenden Argumentationssystem nicht befriedigend beantworten kann.
Der Streit über die „Metaphysik der Sitten und des Rechts“
Es gibt in Kants Werk nichts Strittigeres als seine Rechtsphilosophie, die er in der Metaphysik der Sitten präsentiert. Der Rechtstheoretiker Franz L. Neumann stand lange Zeit mit seiner Fundamentalkritik nicht allein, nichts habe in im politischen Denken in ‚Deutschland „verheerendere Folgen“ gehabt als die Staats- und Rechtslehre Kants, denn sie habe die „Rechtsidee in die Sphäre der Transzendentalität verbannt“ und das wirkliche Recht den „blinden Kräften des Traditionalismus „übergeben“. (Neumann, 165) Im Unterschied zu diesem harten Verdammungsurteil eines sozialistischen, liberalen Rechtstheoretikers, der der „kritischen Theorie“ nahestand, erfreut sich in jüngster Zeit ausgerechnet Kants Rechtstheorie einer Würdigung als Baustein eines liberaldemokratischen Rechtsstaates.
Der Grund für solch konträre Wertungen liegt ein Stück weit nicht nur bei den Interpreten, sondern auch im Werk selbst. Kant bewegt sich scheinbar ganz im Trend des 18. Jahrhunderts und gründet seine Staatstheorie auf dem Gedankenkonstrukt eines ursprünglichen Vertrages, der die Menschen aus welchen Gründen auch immer aus dem Naturzustand in die „wohlgeordnete Freiheit“ des bürgerliche Rechtszustandes führt. Hier beschreitet Kant in seinem Vertragskonstrukt, den „Sozialkontrakt“, einen etwas anderen Weg als seine für die liberale Lösung wichtigen Vorläufer Thomas Hobbes und John Locke (1632 – 1704). Rousseau, der dritte Klassiker der „Vertragstheorie“, entfällt hier eigentlich, weil Rousseaus Contrat social von ganz anderen Prämissen ausgeht und auch keine liberalen Schlüsse zulässt, sondern mehr oder weniger zu Recht als Vordenker der Jakobiner in der Französischen Revolution gilt.
Eine zentrale Frage ist, was ist der Zweck des Vertragsschlusses. Dabei spielt insbesondere im Kontext der Ideengeschichte des Liberalismus das Recht auf Eigentum als Quelle der Freiheit eine zentrale Rolle. Bei Hobbes entsteht das Recht auf Eigentum erst mit der Überwindung des absolut rechtlosen Naturzustandes, wo jeder ein Recht auf alles hatte. Erst in den bürgerlichen Rechtszustand kann das Recht auf Privateigentum entstehen und dann auch gewährleistet werden. Aber rein theoretisch muss das bei Hobbes nicht sein, denn die für ihn wesentliche Leistung des Gesellschaftsvertrages, der ja eigentlich ein „Unterwerfungs- bzw. Herrschaftsvertrag“ ist, ist allein die Herstellung des staatlichen Gewaltmonopols. Und das hat nicht zwingend auch die Einführung des Privateigentums zur Konsequenz. Die Garantie des Privateigentums folgt bei Hobbes seinem frühliberalen Gesellschaftsmodell des „Besitzindividualismus“, also der Antizipation der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft, die entgegen dem späteren liberalen Glauben an einen schwachen Staat genau das Gegenteil, nämlich einen starken, Ordnung schaffenden Staat benötige.
Dass ist bei John Locke anders, weshalb er auch der „eigentliche“ frühe Theoretiker des Liberalismus ist. Für Locke gibt es ein vorstaatliches Naturrecht auf Eigentum, begründet als das Ergebnis eigener Arbeit. Das originäre Recht auf Eigentum und seine Absicherung als Kern der persönlichen Freiheit ist das Herzstück des Gesellschaftsvertrages und geht somit vom Naturzustand in die bürgerliche Verfassung in nun gesicherter Form über. Hinzu kommt bei Locke noch das Prinzip der Gewaltenteilung, um den unkalkulierbaren Absolutismus auszuschließen, der in Hobbes Modell lauert. In diesem Sinne ist Locke der Vater des „liberalen Rechtsstaats“.
In Kants „Sozialkontrakt“ sind die Dinge verworrener. Das Problem liegt darin, dass die Unterscheidung des „Natur- vom Rechtszustand“ bei Kant nicht eine zwischen Anarchie und Ordnung ist. Bei Kant gibt es auch im Naturzustand eine Rechtsordnung, aber eine die auf Verträgen des Privatrechts basiert. Damit finden wir hier schon „Rechtspersonen“ als Träger von subjektiven Rechten zu denen logisch auch schon Eigentum an Sachen gehören muss, denn andernfalls gäbe das „originäre“ Rechtssystem als Summe von Privatrechtsverträgen keinen Sinn. Was hier fehlt, ist ein „öffentliche Recht“, um diese Summe des Privatrechts verbindlich, nämlich als Staat, zu ordnen und dem ganzen als Rechtsstaat Rechtssicherheit zu gewähren, als dessen Kern sich nun die Sicherung des Privateigentums entpuppt. Aus dem Provisorium des Eigentumsrechts im privatrechtlichen Naturzustand wird nun eine staatliche geordnete Eigentümergesellschaft. Mit dieser Argumentationskette, wie sie u.a. Franz L. Neumann lieferte, sei Kants „Rechts- und Staatstheorie nichts weiter als eine dogmatische Kette von Behauptungen von der Art, wie sie bei allen Naturrechtstheoretikern zu finden sind.“ (Neumann, 171) Nach Iring Fetscher setzt Kant im „Naturzustand“ eine Ansammlung warenproduzierender Bürger voraus, die nach einem verlässlichen Rechtszustand suchen, der ihre friedliche Koexistenz und ihre jeweiligen Freiheitsrechte mit und gegen einander absichert. (Fetscher, 277)
Kants „Sozialkontrakt“ und die Teilung der Staatsbürger
Ausgehend davon, sich auf minenreichem Gelände zu bewegen, soll nun versucht werden, Elemente des Kantschen „Sozialkontrakts“ zu rekonstruieren, die es ermöglichen die kontroversen Deutungen dieses Teils des Werkes von Kant verständlich zu machen. Damit begeben wir uns in jenes sperrige Werk mit dem Titel Metaphysik der Sitten.
Wir überspringen hier seine umfangreichen begrifflichen Vorarbeiten und erwähnen nur, dass auch dieses Gebiet der praktischen Philosophie allein der gebieterischen Vernunft jenseits aller Erfahrungen dem reinen Reich des Sollens zufällt. Kant unterscheidet die Legalität als das äußere Recht von der Moralität und der Sittlichkeit, das ist die Befolgung des Rechts als Pflicht aus innerer Überzeugung. Eine Unterscheidung, die uns vertraut ist, wenn es zu unterscheiden gilt, ob ich nicht töte, weil da eine Strafe droht oder ob ich aus innerer moralischer Überzeugung, was man das „Gewissen“ zu nennen pflegt, so etwas verabscheue und nicht tue. (IV. 324) Das „Gewissen, der innere Gerichtshof im Menschen“, ist ein Schwergewicht in Kants Ethik, dessen nähere Bestimmung wir in den nächsten Teil, der sich mit Kants Ethik beschäftigt, überweisen.
Die alles bestimmende Voraussetzung Kants ist, dass die Freiheit das einzig „angeborene Recht des Menschen“ ist. (IV. 395) Dass es überhaupt eines Staats bedarf, erklärt Kant nicht mit der Erfahrung der Schlechtigkeit oder einer „Böswilligkeit“ der menschlichen Natur, sondern jenseits von Gut und Böse erzwinge allein der unterstellte „freie Wille“ des Menschen, der sich schon definitionsgemäß unterschiedlich artikulieren könne, ein Reglement, diese auch widerstreitenden Willen in eine Ordnung durch das Recht zu bringen.
Dieses ist die vorzüglich Daseinsbestimmung und zu erbringende Leistung des Staates, der dann die ganz unpathetische Definition erfährt: „Ein Staat (civitas) ist eine Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen.“ (IV. 431) Jeder Staat besteht zudem aus den uns bekannten drei Gewalten, die es sorgfältig zu teilen gilt, damit keine die absolute Macht über die anderen erhält. Innerhalb dieses Machtgleichgewichts gilt unser Interesse der gesetzgebenden Gewalt, weil sie ins Zentrum der politischen Zentralfrage führt: Wer ist mit welchem Recht der Souverän und Träger des politischen Willens?
Kant erklärt hier zunächst, dass die „gesetzgebende Gewalt (…) nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen“ könne. (IV. 432) Wo hier scheinbar Rousseaus volonté generale draufsteht, ist aber kein Rousseau drin. Leider hat es der große Franzose unterlassen, aus welchem Grund auch immer, uns zu verraten, was er unter dem „Volk“ verstand. Kant löst für sich das Rätsel, indem er die „zur Gesetzgebung vereinigten Glieder einer solchen Gesellschaft (societas civilis), d.i. eines Staates, Staatsbürger“ nennt. Der unterliegt als Gesetzgeber „unabtrennlichen Attributen: der „gesetzlichen Freiheit“, d.h. „keinem anderen Gesetz zu gehorchen, als zu welchem er seine Beistimmung gegeben hat“, zweitens die „bürgerliche Gleichheit“ aller vor dem Gesetz und drittens, als uns noch nicht vertraute Maxime Kants, die „bürgerliche Selbständigkeit“. (IV. 432)
Diese hier erstmals aufgeführte Kategorie erscheint zunächst wie ein Kuriosum, denn Kant teilt die Staatbürger fortan in aktive und passive. Passiv, als Objekte des Rechts sind alle Staatsbürger gleichermaßen vom Recht betroffenen, darin besteht ihre Gleichheit vor dem Gesetz. Das ist übrigens gegenüber dem früheren Standesrecht mit seinen Privilegien ein nicht zu unterschätzender Fortschritt. Wer aber glaubt, darin für eine in der Logik liegende weitergehende Gleichheit in Kant einen Anwalt zu haben, wird nun bitter enttäuscht. „Denn daraus, daß sie fordern können, von allen anderen nach Gesetzen der natürlichen Freiheit und Gleichheit als passive Teile des Staats behandelt zu werden, folgt nicht das Recht, auch als aktive Glieder den Staat selbst zu behandeln, zu organisieren oder zur Einführung gewisser Gesetze mitzuwirken“. (IV. 433 f.) Nur ein Recht dürfen die „aktiven“ den „passiven“ nicht verwehren, sich aus dem einen Zustand in den anderen „empor arbeiten“ zu können. Das heißt also, die Betroffenen des Rechts entscheiden nicht selbst darüber, welchem Recht sie sich beugen sollen. Aber wie verträgt sich das mit Diktum, die gesetzgebende Gewalt könne nur dem „vereinigten Willen des Volkes“ zukommen? Oder es stellt sich die Frage vielmehr, wer ist eigentlich das Volk? Oder ist das etwas anderes als der „Staatsbürger“?
Damit kommen wir unabdingbar zu der Frage, was konstituiert den Unterschied zwischen aktiven und nur passiven Staatsbürgern? Das ist für Kant die bürgerliche Selbständigkeit. Aber was ist das? Die „Fähigkeit zur Stimmgebung macht die Qualifikation zum Staatsbürger aus; jene aber setzt die Selbständigkeit dessen im Volk voraus, der nicht bloß Teil des gemeinen Wesens, sondern auch Glied desselben, d.i. aus eigener Willkür in Gemeinschaft mit anderen handelnder Teil desselben sein will.“ (IV. 432) Wird mit dieser kryptischen Formulierung in schlechter liberaler Tradition die formelle Gleichheit ausgehebelt, indem einige doch „gleicher sind als andre“? Traditionell begründeten die Liberalen die eingeschränkten Staatsbürgerrecht der Besitzlosen mit der Koppelung von Besitz und Bildung. Diesem Pfad folgt Kant aber nicht. Den Widerspruch, der in der Teilung der Staatbürger liegt, erkennt er durchaus. Der um Definitionen eigentlich nie verlegene Kant gerät hier nicht ganz zufällig ins Straucheln, denn er greift in seiner Erklärung zu einem seltsamen Mittel. Er nennt Beispiele, die in Ermangelung einer begrifflichen Unterscheidung den Unterschied illustrieren und dadurch Evidenz verschaffen sollen
Den Mangel an bürgerlicher Selbständigkeit exemplifiziert er an Gesellen eines Kaufmans oder Handwerkers, an Dienstboten, außer denen die im Dienst des Staates stehen, Unmündige, alle „Frauenzimmer“ und „jedermann, der nicht nach eigenem Betrieb, sondern nach der Verfügung anderer (außer der des Staats), genötigt ist, seine Existenz (Nahrung und Schutz) zu erhalten.“ (IV. 433) Um Kant auf den Begriff zu bringen: Wer im sozialökonomischen Sinne nicht sein eigener Herr ist, muss sich als „Staatsgenosse“ erst noch „empor arbeiten“, um Staatsbürger zu werden. Allein, es darf diese Möglichkeit nicht künstlich unterbunden werden. Sollte man das „Chancengerechtigkeit“ nennen?
Ein solcher Bürger muss eine wesentliche Voraussetzung erfüllen, nämlich Herr seiner selbst zu sein. Sein eigener Herr (sui generis) zu sein, heißt nicht abhängig in seiner Existenz von jemand anderem zu sein. Die Frage ist nun, wodurch wird das Rechtssubjekt sein eigener Herr? Da Kants Antworten auch summarisch auf diese Fragen keineswegs eindeutig sind, bieten sich verschieden Lesarten an, ob Besitz und Eigentum letztlich die entscheidenden Kriterien sind? Das ist in der unterstellten dezidierten Form bei Kant aber nicht der Fall. Dennoch bleibt Kant eine Antwort darauf schuldig, was der genaue Sinn und Zweck der Unterscheidung in aktive und passive Staatsbürger mit unterschiedlichen Mitbestimmungsrechten eigentlich ist, wodurch er sich begründet und er liefert nicht einmal ein deutliches Kriterium dafür, wer aufgrund welcher Umstände zum „vereinigten Willen des Volkes“ und damit zum „Souverän“ gehört und wer nicht.
Es ist nicht die einzige Leerstelle des „Philosophen des Bürgertums“, wie Karl Marx ihn nannte. Eine weitere Unklarheit besteht in dem Kern von Rechten des Staatsbürgers. Als dessen normativer Kern gelten gemeinhin die bürgerlichen bzw. universellen Menschenrechte. Kant hat zwar das „natürliche Recht“ des Menschen auf Freiheit begründet, einen Katalog von Menschenrechten als normative Rechtsprinzipien als Staatsbürger sucht man bei ihm vergebens. Allein aus einem jedem Menschen kraft seines Menschseins und der ihm als moralische Person zukommenden „Würde“ entstehen für ihn neben dem „angeborenen“ Recht weitere Rechte.
Die hat Otfried Höffe, einer der prominentesten Kant-Interpreten der Gegenwart, als „Quasi- Menschenrechte“ aus dem kategorischen Rechtsimperativ der gleichen Freiheit aller abgeleitet. Er eruiert einen Katalog von vier negativen Freiheitsrechten. Erstens das Verbot von Privilegien und Diskriminierungen. Das Recht sein eigener Herr zu sein, was bestimmte Formen sozialer Abhängigkeit wie Sklaverei und Leibeigenschaft kategorisch ausschließt. (Lohnarbeit übrigens nicht!) Die strafrechtliche Unschuldsvermutung regelt den Schutz der Ehre der Person und die Beweislastverteilung. Schließlich das Recht zu tun, was anderen keinen Schaden zufügt, insbesondere die Achtung des inneren Mein und Dein. Ergänzend nennt Höffe noch das nicht eindeutige Recht auf Eigentum sowie den Genuss der Rechte als Bürger und „Weltbürger“. (Höffe, 307 f.)
Dieser nachgereichte Katalog zeigt, dass Kants Radikalität durchaus Grenzen hat. Aus seiner Zeit heraus spiegelt seine Aus- und Abgrenzung gegenüber dem Volk, das bei ihm immerhin nicht als „Pöbel“ firmiert, die allgemeine Sorge der „Leistungsträger“ von Besitz und Bildung (durchaus in dieser Reihenfolge) vor dem Zugriff der „leeren und hungrigen Mägen“ auf die Politik und die damit verbundene Gefahr, dass die sozialen Besitzstände gefährdet werden könnten. Dem steht aber auch entgegen, dass er den noch nicht aktiven Staatsbürgern das Recht und die Möglichkeit einräumt, sich zum „eigenen Herrn“ empor zu arbeiten.
Kants zwiespältige Rolle in der politischen Theorie seiner Zeit, zeigen sich auch in weiteren Teilen seines Staatsrechts. Etwa seine These, dass der „Ursprung der obersten Gewalt für das Volk, das unter derselben steht, in praktischer Absicht unerforschlich“ ist. Woraus folgt, dass der „Untertan“ über diesen Ursprung mit der Konsequenz, die Rechtmäßigkeit in Zweifel zu ziehen, nicht „werktätig vernünfteln“ solle. (IV. 437) Die Begründung ist so einfach wie erstaunlich: Da das Volk unter einem bestehenden Rechtszustand lebe, könne es nur dem Herrscher folgen oder sich gegen ihn erheben, was aber kategorisch ausgeschlossen wird. Unter der Herrschaft des Rechts, als dem Kern des Staates, gelte der unbedingte Rechtsgehorsam, analog dem Satz: „alle Obrigkeit ist von Gott“. Darin würde kein „Geschichtsgrund der bürgerlichen Verfassung“ geliefert, sondern eine „Idee, als praktisches Vernunftprinzip“ ausgesagt: „der jetzt bestehenden gesetzgebenden Gewalt gehorchen zu sollen, ihr Ursprung mag sein, welcher er wolle.“ (IV. 438) Und Kant geht noch weiter, der Herrscher im Staat habe „gegen den Untertan lauter Rechte und keine (Zwangs-) Pflichten.“ Das schließt an die oben schon erörterten Darlegungen auch zum „Widerstandsrecht“ an. Vielleicht war Kant von der Gestaltungsfähigkeit des Volkes doch nicht so richtig überzeugt. Immerhin befand er im Streit der Fakultäten: „Das Volk will geleitet, d.i. (in der Sprache der Demagogen) es will betrogen sein.“ (VI. 294)
Wirkungsgeschichte und Rezeption
Natürlich war Kant kein Jakobiner. Er wäre politisch am ehesten dem liberal-republikanischen Bürgertum zuzuordnen. Karl Marx sah in ihm den Philosophen der französischen Revolution, einen Vertreter des aufstrebenden Bürgertums, der seinen Liberalismus auf den Rechtsstaat und den Citoyen konzentrierte und nicht den Bourgeois bediente. Zwar maß er dem Eigentum eine große Bedeutung bei, aber als Wirtschaftsliberaler hat er keine Karriere gemacht.
Sieht man in Kants philosophischen Werken nicht allein einen Begründer der modernen Erkenntnistheorie, sondern einer reflexiven Vernunftphilosophie, die sich zugleich als den philosophischen Inbegriff der Aufklärung versteht, dann sind darin Folgerungen für die Politik und die Gesellschaft wie auf die gesamte Kultur nicht zu unterschätzen. Zu den Fragen nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis, der Frage danach, was ich tun soll und was ich hoffen kann und schließlich der Frage schlechthin, was der Mensch ist, gehört als Ergebnis und Grundbedingung die Freiheit des Subjekts, das sich durch Bedienung des eigenen Verstandes aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ verabschiedet. Dieses Subjekt tritt als Trägerin der Vernunft in potentia auf die Bühne, das erkenntnistheoretische Subjekt ist zugleich ein gesellschaftliches nach Autonomie und damit nach Emanzipation strebendes Individuum und somit ein eminent politisches Wesen.
Dass die Menschen mit ihrer Befähigung zur Vernunft noch nicht selbst vernünftig sind, ist für Kant so selbstverständlich wie die Tatsache, dass man noch nicht in einem „aufgeklärten Zeitalter“ lebe. Aber der Gebrauch und die Entfaltung der Vernunft ist ein geschichtlicher Prozess, den der Einzelne nicht für sich isoliert vollziehen kann. Das gelingt nur in der Gattung, und zwar in der Weise, dass sich die Vernunft erst durch freies Räsonieren im öffentlichen Diskurs vollziehen kann. Die Befreiung von Autoritäten als Ursache der Unmündigkeit führt nicht sogleich zu einer Autonomie, wo der Einzelne mit seiner Vernunft den leuchtenden Pfad zur Wahrheit findet. Die allgemeine Vernunft konstituiert sich intersubjektiv, im freien öffentlichen Diskurs, in dem die Argumente nach den Regeln der Vernunft geprüft, entwickelt und in praxi dann durch Einsicht und Überzeugung gelebt werden. Dieses Ideal der bürgerlichen Öffentlichkeit freier Menschen ist jener „idealtypische“ Begriff, den Jürgen Habermas in seinem Standardwerk Strukturwandel der Öffentlichkeit als den Kern des normativen Selbstverständnisses der bürgerlichen Gesellschaft der Freien und Gleichen mit Rückgriff auf Kant entfaltete.
Aber damit war noch keine Aufarbeitung der politischen Philosophie Kants verbunden. Verborgen blieb schon Kants unmittelbaren Nachfolgern, dass er der Widerpart zur aufkommenden Romantik auch in der politischen Philosophie war. Der zum Verständnis des „ganzen“ Kant äußerst wichtige geschichtsphilosophische Beitrag genießt schon deshalb in der Rezeptionsgeschichte einen problematischen Stellenwert, weil er vom Status der Anerkennung der Geschichtsphilosophie selbst abhängt. Die geriet im Zwanzigsten Jahrhundert immer mehr in den Verdacht, ein Vehikel totalitärer Ideologien zu sein, wie es exemplarisch Karl R. Poppers Kampfschrift Die offene Gesellschaft und ihre Feinde demonstrierte. Zwar war Kant für Popper ein positiver Bezugspunkt, aber weder seine geschichtsphilosophischen noch seine politischen Überlegungen wurden hier breiter rezipiert. Kant Favorisierung des Weges der schrittweisen Reformen findet hier den größten Beifall.
Auf intensivere Versuche, Kant für die politische Theorie fruchtbar aufzuarbeiten, trifft man vermehrt erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Erwähnenswert sind hier insbesondere Hannah Arendt, die sich zum Ende ihres Schaffens sehr intensiv mit Kant als politischen Theoretiker beschäftigt hat. Und ebenfalls in den USA wurde Kant von John Rawls mit enormer Breitenwirkung in einer bis dahin unbekannten Intensität für seine Theorie der Gerechtigkeit und seiner Gesamtbegründung einer liberalen Moralphilosophie rezipiert, womit er eine Renaissance der in Vergessenheit geratenen praktischen Philosophie insgesamt einleitete.
Die wurde dann von Jürgen Habermas in seiner Diskursethik einerseits und in seiner rechtsphilosophischen Begründung des liberal-demokratischen Rechtsstaates andererseits fruchtbar weiterentwickelt. Kants zunehmende Wahrnehmung als politischer Denker erhielt für die Gegenwart durch Ingeborg Maus‘ Arbeiten über Kants Beitrag zur modernen Demokratietheorie einen zusätzlichen Schub. Insofern kann man sagen, dass der sehr lange verkannte Teil des Werkes von Kant sich gegenwärtig einer außerordentlichen Beachtung und zum Teil auch Aktualität erfreut, was leider kein Indiz dafür ist, dass es um die Dinge, um die es dem Kosmopoliten Kant vor allem ging, den Frieden und die universellen Rechte des Menschen, zum Guten steht.
Zitierte Literatur von Kant:
Kant, Immanuel: Kant Werke. Hg. Wilhelm Weischedel, Bde. I. bis VI. Frankfurt a.M. 1964, römische Ziffern ist die Bandangabe, arabische Ziffern die Seitenzahlen. Die gleiche Seitenangabe findet sich jeweils in zwei Halbbände unterteilt in der 12 Bände umfassenden Ausgabe im Suhrkamp Verlag in der „stw“ Reihe, nach der hier zitierten Ausgabe gilt dann Band I. = 1. und 2, Band II. = 3. und 4. etc.
Kritik der praktischen Vernunft (1788), IV. 103 – 302
Die Metaphysik der Sitten (1797), IV. 303 – 634
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), IV. 645 – 879
Kritik der Urteilskraft (1790), V. 235 – 620
Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), VI. 31 – 50
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784), VI. 51 – 62
Mutmaßlicher Anfang des Menschengeschichte (1786), VI. 83 -102
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793), VI. 125-172
Zum ewigen Frieden (1795/6), VI. 191 – 252
Streit der Fakultäten (1798), VI. 261 – 394
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht /1798 /1800), VI. 395 – 690
Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, VI. 779 – 806
Literatur:
Arendt, Hannah; Das Urteilen. Texte zu Kants politischer Philosophie. München – Zürich 1985
Burg, Peter; Die Französische Revolution als Heilsgeschehen, in: Materialien zu Kants Rechtsphilosophie. Hg. Zwi Batscha, Frankfurt a.M. 1976, S. 237 – 268
Cassirer, Ernst: Kants Leben und Lehre. Darmstadt 1975 (1921)
Erhard, Johann Benjamin; Über das Recht des Volkes zu einer Revolution. (1795) mit anderen Schiften Hg. H.G. Haasis. München 1970, S. 7 – 98
Fetscher, Iring; Immanuel Kant und die Französische Revolution, in: Materialien zu Kants Rechtsphilosophie. Hg. Zwi Batscha, Frankfurt a.M. 1976, S. 269 – 290
Habermas, Jürgen; Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt a.M. 1992
Habermas, Jürgen; Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1990 (1962)
Höffe, Otfried; Geschichte des politischen Denkens. München 2016
Höffe, Otfried: Immanuel Kant. München 1996, 4. durchg. Aufl.
Kronenberg, Moritz; Kant. Sein Leben und seine Lehre. München 1922, 6. durchg. Aufl.
Maus, Ingeborg; Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an Kant. Frankfurt a.M. 1992
Neumann, Franz L.; Die Herrschaft des Gesetzes. Eine Untersuchung zum Verhältnis von politischer Theorie und Rechtssystem in der Konkurrenzgesellschaft. Frankfurt a.M. 1980 (1936)
Rawls, John; eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M. 1975 (1971)
Rawls, John; Die Idee des politischen Liberalismus. Frankfurt a.M. 1992
Regenbogen, Arnim; Chronik der philosophischen Werke. Von der Erfindung des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert. Hamburg 2012
Russell, Bertrand; Philosophie des Abendlandes. Ihr Zusammenhang mit der politischen und der sozialen Entwicklung. Wien 1975 (1950)
Willaschek, Marcus: Kant. Die Revolution des Denkens. München 2023