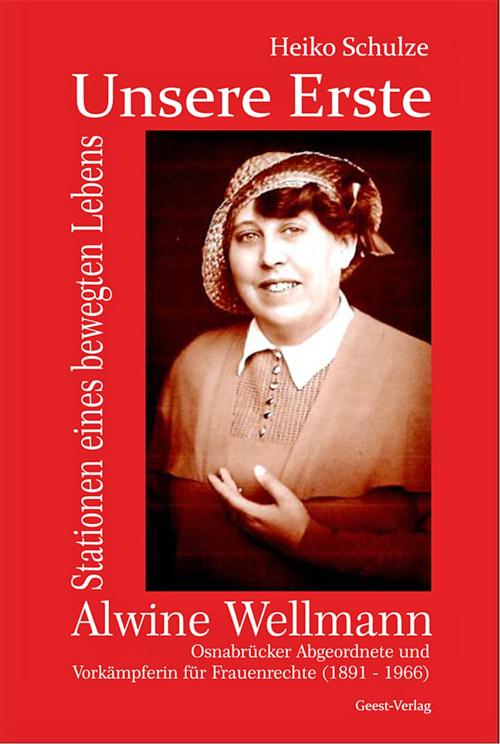Versuch einer Darstellung und Würdigung seines Werkes
(Fünfter von fünf Teilen)
Kants Erkenntnistheorie oder die Besichtigung der Kritik der reinen Vernunft
Immanuel Kants (1724 – 1804) Kritik der reinen Vernunft aus dem Jahre 1781, in zweiter revidierter Auflage 1787 ist eines der wichtigsten und schwierigsten Bücher der gesamten Philosophiegeschichte. Heinrich Heine stellte es neben Robespierres Rolle in der Französischen Revolution. Es war zwar nur eine Gedankenrevolution, die Kant vollzog, aber die war für den Klerus schon so gefährlich, dass die Katholische Kirche das Werk 1827 auf den Index der verbotenen Bücher setzte. Diese Ehrung kam allerdings viel zu spät, um die Bedeutung dieses Werkes noch zu beeinträchtigen. Möglicherweise bewirkte die Kirche damit, wie so oft, nur das Gegenteil.
Wenn wir hier Kants Kritik der reinen Vernunft als letzten Teil in unserer Würdigung seines Gesamtwerkes zum Gegenstand machen, dann kann es nur darum gehen, den Stellenwert in der Ideengeschichte und die Grundgedanken herauszuarbeiten. Eine Gesamtdarstellung dieses gedankenreichen Buches ist in dem hier vorgegebenen Rahmen nicht leistbar und möglicherweise auch nicht von verallgemeinerbarem Interesse.
Imposant an diesem Werk ist die logisch klar begründete Gesamtarchitektur des Baus der menschlichen Erkenntnis. Und doch erscheint es nicht wenigen Lesern wie in Labyrinth, in dem man sich verläuft, weil einem der Faden der Ariadne zuweilen abhandenkommt. Dem Autor dieser Zeilen ist dieses Leseerlebnis auch widerfahren, dass er damit nicht alleinsteht, hilft in der Sache nicht weiter. Daraus ergibt sich, dass es zunächst nur darum geht, Kants „Revolution der Denkart“ herauszuarbeiten und sie in den Problemkontext zu stellen, von dem er in seinen Überlegungen ausging. Das führt uns zunächst in die Philosophiegeschichte der Neuzeit.
Die Entwicklung eines neuen Weltbildes durch die Naturwissenschaft
Keine wissenschaftliche Disziplin ist wie die Philosophie, wenn sie denn eine solche ist, so sehr mit ihrer Geschichte verbunden wie sie. Ein Studium der Philosophie ist immer auch zugleich ein Studium ihrer Geschichte. Kritiker meinen, dass liege auch daran, weil sie außer einer Kette von Irrtümern nichts zu bieten habe. Aber selbst wenn auch Kant sich hier, als ein Glied in diese Kette begeben muss, um ihn und seine möglichen Irrtümer zu begreifen, müssen wir sie erkennen und dazu müssen wir erst einmal verstehen, um was es ihm eigentlich ging. Und das bezieht sich auf Problemlagen, die seine Vorfahren vorbereiteten und hinterließen.
Kant bezieht sich auf eine Vorgeschichte, die sich mit Beginn der Neuzeit als ein Bruch mit der Vorgeschichte davor verseht. Bis dahin ging man mit Aristoteles von der Voraussetzung aus, dass die menschliche Vernunft die Welt (das Sein) zu erkennen vermag, wie sie ist. Das nicht hinterfragte Postulat war die Identität von Sein und Denken. Die Beobachtung und Unterscheidung der Welt in ihre verschiedenen Substanzen war die Aufgabe der Ontologie. Sie verstand sich als die „Lehre vom Sein insofern es seiend ist“. Die Metaphysik war dagegen die Frage nach den letzten Gründen, Ursachen und dem Wesen des Seins und mündet letztlich in der Sinnfrage: Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?
Woran Kant ansetzt, ist die von der modernen Naturwissenschaft eingeleitete neue Form der Erkenntnisgewinnung. Der Siegeszug der modernen mathematischen Naturwissenschaft, ihre absolute Wahrheit und Gültigkeit ist die Voraussetzung, von der Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft ausgeht und ihr gilt die Frage, nach der Bedingung ihrer Möglichkeit. Um die Antworten besser zu verstehen, ist es angebracht kurz darauf zu verweisen, worin diese „wissenschaftliche Revolution eigentlich bestand.
Sie vollzog sich keineswegs so, wie in der Wissenschaftsgeschichte häufig behauptet, mit der Galilei zugeschriebenen Bedeutung, er habe mit seinen berühmten Experimenten der Erfahrungswissenschaft zum Durchbruch verholfen. Mit seiner Hinwendung zur Erfahrung sei das von Spekulationen geprägte Wissensideal des Aristoteles überwunden worden.
Diese Sichtweise ignoriert, dass es vielmehr „die Hauptschwäche des Aristoteles war, dass er zu empirisch war. Deshalb brachte er es nicht zu einer mathematischen Theorie der Natur. Galilei tat seinen großen Schritt, indem er wagte, die Welt so zu beschreiben, wie wir sie nicht erfahren.“ (von Weizsäcker: 1999, 95) Mit Galilei beginnt eine Lesart der Natur, die eben nicht einfach der sinnlichen Erfahrung folgt. Die gefundenen Gesetze werden in mathematisch einfacher Weise ausgedrückt, sie sind aber so gerade nicht zu beobachten. Sie unterstellen sogar Bedingungen (wie den luftleeren Raum), die es in der sinnlichen wahrnehmbaren Realität gar nicht gibt, sondern der Natur vom erkennenden Subjekt willkürlich für kontrollierbare Beobachtungszwecke übergestülpt werden, um so der Natur ihre innersten Geheimnisse zu entreißen. Dieser aktive Teil des Subjekts im Erkenntnisprozess der modernen Naturwissenschaft spielt bei Kant in abstrakter erkenntnistheoretischer Form eine entscheidende Rolle.
Gerade die mathematisch arbeitende exakte Naturwissenschaft, die moderne Physik, gewinnt ihre Erkenntnisse in der Form allgemeiner Gesetze nicht primär durch Induktion und sinnliche Erfahrung, sondern durch eine zielgerichtete Konstruktion des Erkenntnisobjektes für eine mathematische Analyse. Dieser neuen Form der Empirie liegt ein ganz anderer Begriff von Erfahrung zu Grunde. Aristoteles wäre nie auf die Idee des Experimentes der schiefen Ebene für die Erforschung der Fallgesetze gekommen, weil bei ihm selbstverständlich Empirie gleichbedeutend war mit „lebensweltlicher Erfahrung“, basierend auf unseren fünf Sinnen und nicht „künstlich“ hergestellter „Erfahrung“.
„Bei Galilei ist die lebensweltliche Erfahrung dagegen zu einer vorwissenschaftlichen Erfahrung geworden, und als eigentliche wissenschaftliche Erfahrung gilt nur noch technisch erzeugte, instrumentell kontrollierte Erfahrung, das Experiment. Während bei Aristoteles die Naturphilosophie dank ihres genetischen Zusammenhanges der lebensweltlichen Praxis noch einer auf die Alltagswelt bezogenen Orientierungssicherung dienen konnte, fällt derartiges in der neuzeitlichen Naturwissenschaft weg. Die Naturwissenschaft dient seit der Galilei-Zeit vorwiegend einer technischen Praxis; diese bedeutsame Neuerung hat zur Folge, dass mit der neuen Erfahrungsbasis lebensweltliche Erfahrung und wissenschaftliche Erkenntnis auseinanderfallen. Dieses Auseinanderfalle wird als epistemologischer Bruch bezeichnet.“ (Hieber, 1982, 176 f.) Da diese Entfremdung der modernen Wissenschaft von der Erfahrung der Alltagswelt auch kulturelle und gesellschaftliche Folgen hat, bedarf sie eigentlich einer eigenen Betrachtung.
Dieser Bruch hat zur Folge, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nun geradezu im Widerspruch zu den unmittelbaren lebensweltlichen Erfahrungen stehen können. Der Zugang zu den Wissenschaften wird zudem durch die zunehmend erforderlichen technischen Hilfsinstrumente der Erkenntnisgewinnung nicht erleichtert, sondern erschwert und dank der kontra-intuitiven Erkenntnis nicht nur dem Verständnis des Normalmenschen, sondern mit voranschreitender Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Wissenschaften selbst den fachfremden Wissenschaftlern entzogen.
Die neuartige, revolutionäre Verbindung von Erfahrung und Mathematik feierte dann ihre Hochzeit in der einzigartigen wissenschaftlichen Leistung Isaac Newtons. (Hazard, 1949, 195 ff.) Newtons methodische Leistung besteht darin, die von Descartes begründete Identität von Physik und Geometrie aufzugeben, ohne Preisgabe des Anspruchs, die beobachtbaren Phänomene in eine erklärende mathematische Formel zu fassen. Dies wird das Ziel des Bemühens der exakten Wissenschaften. Zugleich verzichtete er aber auf „letzte” Erklärungen. Warum es überhaupt Schwerkraft gibt, ist eine Frage, die angesichts des Wissens darüber, wie sie wirkt, nun als „metaphysisch“ und damit als unwissenschaftlich gilt. Nicht mehr der Wesens- und Substanzbegriff des Aristoteles, sondern das Funktionieren der Natur wird zum Leitbild für die Erkenntnis der Naturgesetze und damit zum Leitbild der wissenschaftlichen Erkenntnis schlechthin. Ernst Cassirer beschreibt diesen „Paradigmenwechsel“ später als den Übergang vom Substanz- zum Funktionsbegriff. (Cassirer, 1910)
Mit der Trennung der Physik von der Geometrie entwickelt sich die Physik mit ihrer Methodik der Erkenntnisgewinnung zur Leitwissenschaft der Neuzeit: Mathematik und Erfahrung wird mit der Methode des Experiments und des Induktionsschlusses verbunden. „Der Weg der physikalischen Betrachtung führt nicht von oben nach unten, nicht von den Axiomen und Prinzipien zu den Tatsachen, sondern er führt umgekehrt von diesen zu jenen.” (Cassirer, 1932, 68) Das Ideal der Deduktion, das Descartes und über alle hinausreichend Spinoza zu einer so wunderbaren gedanklichen Architektur ausgebaut hatten, weicht einem neuen Ideal: der Analyse. „Die Phänomene sind das Gegebene, die Prinzipien das Gesuchte.” (Cassirer, 1932, 7) Die Analyse ist prinzipiell unabschließbar und eröffnet den Zugang zur Empirie und zum Experiment. Mit der methodisch gesicherten Entzifferung der Natur, der Erkenntnis ihrer Funktionsweise, die die allerletzten Fragen des Warum den Theologen überlässt, aber gestützt auf das Wie in der Lage ist, sie kalkulierbar, beherrschbar und schließlich auch manipulierbar und nutzbar zu machen, scheint sich der alte Menschheitstraum von der Herrschaft des Menschen über die Natur zu erfüllen. Und was in der Physik so vorzüglich gelang, warum sollte das nicht auch woanders möglich sein? Warum sollte man nicht eines Tages auch ganz andere Rätsel lösen können? Könnte man nicht auch die menschliche Seele, dieses Universum des Inneren, durch Analyse dechiffrieren? Und warum sollte nicht auch das menschliche Zusammenleben durch die Erkenntnis seiner Gesetze zu einer wissenschaftlichen Lehre von der richtigen Gesellschaft führen, wie es dem späteren Namensgeber der Soziologie Auguste Comte vorschwebte?
Der Streit der Philosophien über die wahren Quellen der Erkenntnis
Kant hat in der Regel die Philosophiegeschichte nicht besonders bemüht, wenngleich ihm die Leistungen seiner Vorläufer vertraut waren. Die Philosophie der Neuzeit, ausgehend von Francis Bacons Plädoyer vom „Wissen als Macht“ durch die Beherrschung der Natur und dann mit René Descartes‘ Suche nach der einzig richtigen Methode der Wahrheitsfindung verabschiedete sich in einem weiteren Punkt von der herrschenden Lehre des Aristoteles, dass die Methode der Erkenntnisgewinnung vom jeweiligen Erkenntnisobjekt abhänge. Die neue Frage lautet nun: Was ist der gesicherte Weg zur Wahrheitsfindung, und was sind die Quellen gesicherter Erkenntnis. Zwei Kandidaten stellen sich in der Folgezeit dem Wettbewerb: der Verstand und die Sinne, der Rationalismus versus Erfahrung bzw. Empirismus.
Der neuzeitliche Rationalismus erhebt sein Haupt mit René Descartes (1596 – 1650), der auch zugleich als der Begründer der neuzeitlichen Philosophie überhaupt gilt. Er ging davon aus, es könne nur eine einzige richtige Methode zur Wahrheitsfindung geben und die alleinige Quelle der gesicherten Erkenntnis sei die Ratio, die Verstandeserkenntnis. Deren vollendeste Form ist die Mathematik, genauer noch die Geometrie, denn deren von Euklid begründete Axiomatik ist das in sich geschlossene logische Gebäude gesicherter Erkenntnis.
Mit Descartes verlagert sich die Frage nach der Wahrheit auf das erkennende Subjekt. Der von Descartes entwickelte legendär gewordene methodische Zweifel wird im 4. Teil seiner Abhandlung über die Methode systematisch entfaltet. Der Ausgang ist, dass „alle Dinge, die je in meinen Geist gelangt waren, nicht wahrer seien als die Trugbilder meiner Träume.“ (Descartes IV.2./31) Man könne alle sinnlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen in Zweifel ziehen, aber nicht, „daß ich, der es dachte, etwas sei. Da ich mir nun darüber klar wurde, daß diese Wahrheit ‚ich denke, also bin ich!‘ so fest und so sicher war, daß selbst die überspanntesten Annahmen der Skeptiker nicht imstande waren, sie zu erschüttern, so urteilte ich, daß ich sie unbedenklich als erstes Prinzip der von mir gesuchten Philosophie annehmen könnte.“ (Descartes IV.3./31)
Dieser so genannte „methodische Zweifel“ besagt, dass absolute Gewissheit als Ausgangspunkt nur dadurch möglich ist, indem ich an allem zweifle. Nach Descartes kann und muss ich so auch die Existenz der realen Welt und damit die sinnliche Gewissheit der Anschauung leugnen, aber ich kann eben nicht daran zweifeln, dass ich es bin, der zweifelt. Daraus zieht er den kühnen Schluss, der in dem berühmten Satz mündet: Cogito, ergo sum. „Ich denke, also bin ich!“
Um die logische Stringenz dieses scheinbar messerscharf geschlossenen Cogito, ergo sum ist viel Tinte vergossen worden, die wir auf sich beruhen lassen. Festzuhalten ist dagegen, dass Descartes‘ Trennung der Welt in eine geistige und materielle Substanz ein neues Problem für das erkennende Ich offenbarte. Wie kann es zu einer wahrhaftigen Erkenntnis der Welt kommen, wenn es zwei streng geschiedene Sphären gibt? Descartes rettete sich mit der Behauptung, es gäbe „eingeborene Ideen“, die das erkennende Denken mit der materiellen Welt in Übereinstimmung brächten. Dieses Geheimnis bot ihm eine willkommene Chance, das Wirken Gottes dafür verantwortlich zu machen.
Aber die wegweisende Botschaft war für die weitere Entwicklung der Wissenschaft „der Gedanke der Einheit der Wissenschaft“, er „gehört zu den Grundpostulaten der Cartesischen Philosophie. Descartes hat nirgends versucht, von diesem Postulat eine besondere Begründung zu geben; es gehörte vielmehr für ihn zu jenen Sätzen, die von selbst einleuchten, die den Beweis der Wahrheit mit sich führen, weil sie unmittelbar ‚aus dem Licht der Vernunft‘ entspringen.“ (Cassirer, 1995, 39)
Kant und der Empirismus Humes
Dieses Licht ging anderen nicht nur nicht auf, sie sahen in der Verabsolutierung des Verstandes mehr Probleme als Lösungen. Vor allem in England formierte sich eine Gegenpartei für die Rechte der sinnlichen Wahrnehmung im Besonderen und der Erfahrung im Allgemeinen. Ihr Wortführer wurde John Locke (1632 – 1704), der in seinem Versuch über den menschlichen Verstand feststellte, es sei nichts in den Gedanken, was nicht zuvor in den Sinnen gewesen wäre. Er wurde zum Gralshüter dieses Gedankens, den schon Leibniz mit dem Zusatz kommentierte: außer dem Verstand selber. Und der sei kein tabula rasa, sondern gefüllt mit Wahrnehmungen, Sinnesempfindungen und hier sei die Quelle aller Erkenntnis, die dann in Gedanken assoziativ verarbeitet werden. Aber ohne diese Sinnesdaten sei der Verstand leer, lautete der Einwand Lockes, wie es ihm aber gelingt, zu allgemeinen logischen Schlüssen zu kommen, das brachte die dem Alltagsverstand so plausible Lehre in größte Bedrängnis. Wie die Dinge der Welt sich dann im Verstand „abbilden“ konnten, da verfiel Locke interessanterweise auf den gleichen Einfall wie sein Widerpart Descartes: auch Locke griff auf „angeborene Ideen“ zurück.
John Lockes Nachfolger in der Entwicklung des englischen Common sense, der sich alltagstauglich als „gesunder Menschenverstand“ gegen die weltfremden Kopfgeburten der überwiegend französischen Rationalisten präsentierte, wurde David Hume (1711 – 1776). Er wurde zum Höhe- und zum vorläufigen Endpunkt des Empirismus. Er bescherte den Erfahrungsanhängern die Erkenntnis einiger Probleme, die sich ergeben, wenn sich aus der Erfahrung allein wissenschaftliche Erkenntnis von strikter Allgemeinheit und Notwendigkeit ergeben soll. Das Problem entzündete sich an der Kausalitätsfrage. Die Verknüpfung von Ursache und Wirkung, die zunächst als Wahrnehmung von „Gewohnheit“ verarbeitet wurde, entpuppte sich als ein innerhalb des Empirismus nicht lösbares Problem. Die kausale Verknüpfung von Ereignissen oder Dingen, die auch mehr oder weniger gesicherte Prognosen erlauben, entspringt nicht der Erfahrung. Das gilt auch für die Gesetze der Gravitation. Sie entspringen nicht einer sinnlichen Erfahrung und daran ändert auch die hübsche Geschichte vom Newton unter dem Apfelbaum nichts. Das zwingt zu der Erkenntnis, dass das Kausalprinzip selbst nicht aus der Erfahrung stammt, sondern seine objektive Gültigkeit aus dem Verstand bezieht. Das war letztlich auch die Erkenntnis Humes, die er aber nicht begründen konnte.
Hegel hat in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie im Scheitern der Erfahrungsphilosophie Humes den Ausgangsunkt der Philosophie Kants erkannt. Indem Hume die „angeborenen Ideen“ zurückgewiesen hatte, gab es auf der Basis der reinen Erfahrung keine Möglichkeit mehr, die „Allgemeinheit und Notwendigkeit“ zu erklären, denn Ursache und Wirkung aus „Gewohnheit“ zur Verknüpfung verschiedener Erfahrungen zu machen, damit jegliche Erkenntnis jenseits der sinnlichen Erfahrung und somit jede Metaphysik auszuschließen, sah auch Kant als definitiv gescheitert an. (Hegel, 277)
Kants Anspruch und die Aufgaben der Kritik der reinen Vernunft
Wie Kant später in seiner Prolegomena bemerkte, war es der „scharfsinnige“ David Hume, der ihn aus seinem „dogmatischen Schlummer“ (III, 118) gerissen habe. Hume habe die fundamentale Kritik an der Metaphysik allein an der Verknüpfung von Ursache und Wirkung entfaltet. Er befragte die Vernunft, mit „welchem Recht sie sich denkt: daß etwas so beschaffen sein könne, daß, wenn etwas gesetzt ist, dadurch auch etwas anderes notwendig gesetzt werden müsse; denn das sagt der Begriff der Ursache.“ (III, 115) Seine Skepsis bewies ihm, „daß es der Vernunft gänzlich unmöglich sei, a priori (d.h. vor aller Erfahrung), und aus Begriffen eine solche Verbindung zu denken“ (III, 115 f.) Doch was Hume als einen Schluss aus der Erfahrung als „Gewohnheit“, weil die Wiederkehr von „Verknüpfungen“ wie z.B. Tag und Nacht dazu einlade, begründe, reiche nicht einmal aus die Wiederkehr, geschweige denn ihre strenge Notwendigkeit zu begründen. Erfahrung erlaube nur Urteile über Geschehenes, Zukünftiges könne nicht aus der Erfahrung entspringen, außer man appelliere an die Unabänderlichkeit des schon „Gewohnten“. Alles außerhalb dieser Erfahrung, sei aber bei Hume Metaphysik, während die Physik sich auf die sinnlich wahrnehmbare Welt der Dinge begrenze. Auf diesem Wege aber wären Naturgesetze mit ihrer strengen Allgemeinheit und Notwendigkeit, ihrer Begründung von Ursachen und Schlüsse auf Folgen einschließlich ihrer Überprüfbarkeit unmöglich und unzulässig. Gleichwohl gelte es auf der anderen Seite der spekulativen Vernunft, also jener Metaphysik, die jenseits aller Erfahrung liegende Erkenntnis ihr Eigen nennt, ebenfalls in ihre Grenzen zu verweisen.
Diese doppelte Frontstellung, die Kant als seinen Ausgangspunkt für die Kritik der reinen Vernunft darstellt, bedarf noch einer zusätzlichen Erläuterung. In allen Interpretationen der Philosophie Kants wird hervorgehoben, dass er in seiner „vorkritischen Phase“ sich zuerst an der nur in Deutschland vorherrschenden Leibniz-Wolffschen Schule orientierte und sich daran abarbeitete. Er bezichtigte sie des Dogmatismus, nannte sie später abfällig „Schulmetaphysik“, die sich dadurch auszeichnete, auf den völligen Verzicht jeglicher Empirie zu pochen. Der oben skizzierte Rationalismus Descartes‘ und Spinozas spielte dagegen bei Kant keine wesentliche Rolle. Die Lektüre Humes in den 1760er Jahren öffnete ihn für den empirischen Ansatz, manche Interpreten sehen ihn zu dieser Zeit ganz auf dieser Seite und ihn Abschied nehmen von seiner „geliebten Metaphysik“, wie Kant sie selber nannte.
Aber die sich aus Humes Ansatz ergebenden Probleme öffneten eine auch eine andere Perspektive, dass es um die Metaphysik nicht ganz so hoffnungslos stehe, wenn man sie den neuen Herausforderungen entsprechend einer selbstkritischen Renovierung unterzöge. Dabei wird in Kants Entwicklung möglicherweise ein wichtiger Aspekt unterbewertet, auf den zuerst Kuno Fischer (Fischer I, 275 ff.) aufmerksam gemacht hatte. Der damals berühmte „Geisterseher“ Emanuel Swedenborg (1688-1772) beschäftige Kant in den 1760er Jahren offenbar in einer erstaunlichen Intensität, denn Kant hatte dessen sehr umfangreiches Werk von ca. einhundert Büchern eingehend studiert. Die besondere Herausforderung lag darin, dass Swedenborg eine ganz andere Welt repräsentierte, nämlich jene Welt, die Böhme & Böhme (261 ff.) die „andere Seite der Vernunft nennen. Die Welt der Träume, Dämonen und des Wunderglaubens war noch etwas anderes, als die Welt der Religionen und der metaphysischen Probleme der Gottesbeweise. Uns begegnet ihr gegenwärtig in etwa vergleichbar mit der Welt der Querdenker, Esoteriker und dergleichen, deren „Rationalität“ aus der Sicht der Vernunft eben die „Irrationalität“ ist. Mit dieser Welt der Träumereien sah sich Kant aber deshalb herausgefordert, weil seine „geliebte Metaphysik“ gegen diese Einfälle des Unsinns keineswegs immun war. Es bedurfte also einer „bereinigten“ Metaphysik mit klarer Abgrenzung gegen diese Traumwelten. In den Träumen eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Metaphysik polemisierte er unter dem Motto des Horaz, den „Träumen eines Kranken werden Wahngebilde erdichtet“, 1766 gegen Swedenborg in einer umfangreichen Broschüre. (I, 921 – 989) Von diesem Einfallstor musste er eine Metaphysik befreien, die den Anspruch erheben konnte, „künftig als Wissenschaft“ aufzutreten. Aus diesem Ansinnen avancierte diese neue Metaphysik zur „Wissenschaft der Grenzen der Vernunft“.
Die eigentliche Aufgabe der Kritik der reinen Vernunft, den Streit zwischen dem Rationalismus und Empirismus vor dem „Richterstuhl der Vernunft“ zu entscheiden, erweitert sich dahin, die Grenzen der Metaphysik jenseits des Leibniz-Wolffschen Dogmatismus zu bestimmen. Der Kampfplatz dieser endlosen „Streitigkeiten heißt nun Metaphysik“. In einer Fußnote, die den allgemeinen „Klagen über Seichtigkeit der Denkungsart unserer Zeit und den Verfall gründlicher Wissenschaft“ die Erfolge der Mathematik und der „Naturlehre“ gegenüberstellt, verlängert er diese Erfolgsgeschichte mit der Forderung nach mehr Kritik, die auch für die „Berichtigung ihrer Prinzipien“ sorgt. „Kritik“ ist für ihn nicht eine „Kritik der Bücher und Systeme“, sondern die des „Vernunftvermögens überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig aller Erfahrung, streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der Quellen, als des Umfanges und der Grenzen derselben, alles aber aus Prinzipien.“ (II. 13)
Dieses Unternehmen der Kritik erweitert er in einer weiteren Fußnote zu einem umfassenderen Unternehmen. „Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß. Religion, durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung, durch ihre Majestität, wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich, und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.“ (II. 13) In dieser Fußnote wird ein Programm der Kritik entfaltet, dass mehr impliziert als eine neue Erkenntnistheorie.
Eingangs der Vorrede zur ersten Auflage wird die Vernunft zur Selbstüberprüfung aufgefordert, die auch den Umgang mit jenen „belästigen Fragen“ einschließt, „die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.“ (II. 11) Hier ist das Programm der Kritik der reinen Vernunft in aller Klarheit umrissen. Und Kant „schmeichelt“ sich, auf seinem Weg „die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien Gebrauche mit sich selbst entzweiet hatte.“ (II. 13 Und er „erkühnt“ sich zu sagen, „daß nicht eine einzige metaphysische Aufgabe sein müsse, die hier nicht aufgelöst, oder zu deren Auflösung nicht wenigstens der Schlüssel dargereicht worden.“ (II. 14)
In der längeren und bedeutenden Vorrede zur zweiten, stark veränderten Auflage tritt der Bezug zur modernen mathematischen Naturwissenschaft als der „sichere Gang der Wissenschaft“ expliziter in den Vordergrund mit der Frage: Wie ist reine Mathematik und reine Naturwissenschaft möglich? Wenn es nur um den Forschungsprozess seines Vorbildes Newton gegangen wäre, hätte die Frage auch lauten können, wie war Newton möglich? Doch um den „Forschungsprozess“ oder eine „Forschungslogik“ ging es Kant nicht, und wie die genannten Hinweise der ersten Vorrede belegen, ist der Anspruch ambitionierter.
Aufgabe der Kritik der reinen Vernunft
An dieser Problemstellung, die wir hier in aller Kürze aus der Ideenhistorie rekonstruiert haben, setzt Kant sein Werk der Kritik an, das 1781 im Todesjahr Lessings in Königsberg erscheint. Die erste Auflage erfreute sich geringer Beachtung und dazu noch schlechter Kritiken. Da das Werk offensichtlich nicht verstanden wurde, schob Kant 1783 eine „populäre“ Fassung unter dem nicht gerade einladenden Titel Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können nach, die sich ausdrücklich „nicht zum Gebrauch vor Lehrlinge, sondern vor künftige Lehrer“ eigne. (III. 113)
Kant konzedierte den Kritikern seines Werkes, das mehr „durchblättert“ als „durchdacht“ werde, dass es dazu einlade, nicht verstanden zu werden, denn es sei „trocken, weil es dunkel, weil es allen gewohnten Begriffen widerstreitend und über dem weitläufig“ sei. (III, 120) Den Wunsch nach „Popularität“ weist er entschieden zurück, wie auch den Appell an den unzuverlässigen Gesellen des „gesunden Menschenverstandes“, der nicht zufällig ein „schlichter“ heiße.
In der Vorrede zur zweiten Auflage beginnt er mit der Feststellung, ob die „Bearbeitung der Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäfte gehören, den sicheren Gang der Wissenschaft gehe“ oder „bloßes Herumgetappe“ werde, darüber entscheide der Erfolg. (II. 20) „Daß die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her gegangen sei“, erkenne man daran, dass sie seit Aristoteles „keinen Schritt rückwärts hat tun dürfen“, aber „merkwürdigerweise“ auch hat „keinen Schritt vorwärts tun können.“ (II. 20) So scheint sie vollendet und geschlossen. Das gelte auch für neuere Versuche, sie durch psychologische. anthropologische und metaphysische Kapitel zu erweitern. Aber die Grenzen ineinander laufen zu lassen, sei keine „Vermehrung“, sondern eine „Verunstaltung“ der Wissenschaften. (II. 20 f.) Die Grenze sei genau gesteckt, sie ist die Wissenschaft, die „nichts als die formalen Regeln alles Denkens“, gleichgültig ob a priori oder empirisch, „ausführlich darlegt und strenge beweiset.“ (II. 21) Das verdankt sie allein der Tatsache, dass „sie von allen Objekten der Erkenntnis und ihren Unterschieden“ abstrahierte und sich der Verstand mit nichts anderem, als „mit sich selbst und seiner Form“ beschäftige. (II. 21)
„Mathematik und Physik sind die beiden theoretischen Erkenntnisse der Vernunft, welche ihre Objekte a priori bestimmen sollen, die erstere rein, die zweite wenigstens zum Teil rein, denn aber auch nach Maßgabe anderer Erkenntnisquellen als der der Vernunft.“ (II. 21 f.) Ausgiebig hebt er die Erfolge der Mathematik hervor. (II. 22) Mit den Naturwissenschaften ging es dagegen weit langsamer voran, bis sie den „Heeresweg der Wissenschaft“ betrat. Dies sei erst anderthalb Jahrhundert her, als Baco von Verulam die Naturwissenschaft auf Erfahrung gründete und daraus schnell eine „Revolution der Denkart“ erklärt wurde. (II. 23) Durch Galileis Experimente mit den Kugeln auf einer schiefen Ebene und Torricellis Versuch, der Luft ein Gewicht zu geben, ging den „Naturforschern ein Licht auf.“ „Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt, daß sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse.“ (II. 23) Andernfalls hängen „zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem notwendigen Gesetze zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf.“ (II. 23) Was Kant hier beschreibt, ist nichts anderes als die Methode der modernen experimentellen Naturwissenschaft. Soweit sie in diesem Verfahren ihren „sicheren Gang der Wissenschaft“ nahm, verabschiedete sie sich von den Jahrhunderten des „Herumtappens“. (II. 24)
Die Rede von „den Bedingungen der Möglichkeit“ ist eigentlich rhetorischer Art, denn was als Möglichkeit erscheint, wird als absolute Wahrheit vorausgesetzt. Theodor W. Adorno sieht Kants Philosophie bestimmt von einem „ungeheuren Vertrauen auf die mathematische Naturwissenschaft.“ Kern der „Kritik“ sei die Erkenntnis, dass „die Anstrengungen der Metaphysik, gewisse absolute Erkenntnisse aus sich heraus, aus bloßem Denken heraus zu spinnen, gescheitert sind, – und insofern Hume daran Kritik geübt hat, hat er recht gehabt.“ (Adorno, 19) Aber das ist kein Grund zu verzweifeln, denn die Mathematik und die theoretische Physik produzieren einen solchen „Stamm von Erkenntnissen, die dem Kriterium der absoluten Wahrheit“ genügen, weil sie für „alle künftigen Erfahrungen absolut verbindlich gelten sollen.“ (Adorno, 19)
Kant selbst sieht sein Werk als eine „Revolution der Denkart“, denn warum man nicht vorangekommen sei, habe einen einfachen Grund: „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, ging unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten“. Damit ist eine komplette Umkehrung des bisherigen Denkens verbunden, dass er nicht ganz unbescheiden mit dem Gedanken des Kopernikus vergleicht, „der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.“ (II. 25) Diese süffisante Anspielung macht deutlich, dass der eigentlich bescheidene und uneitle Kant sehr wohl wusste, was er mit seinem Buch anrichtete. Hier in der Vorrede ist der Kern, die „Revolution der Denkart“ in aller Kürze verkündet. Der Rest ist Ausführung zur Begründung dieser Absicht. Der wird eine weitere hinzugefügt. Mit der Setzung der Grenzen der Vernunft wird zugleich die Metaphysik in ihre Schranken gewiesen und das Wissen streng vom Glauben getrennt. (II. 33)
Die Unterscheidung der Erkenntnisarten
„Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung gebracht werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren.“ Mit dieser Feststellung eröffnet Kant die Einleitung. „Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alle an.“ Aber darauf folgt der entscheidende Einwand, wenngleich „alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.“ (II. 45) Hier nicht dem „ersten Anschein“ zu folgen, ist die Aufgabe einer „näheren Untersuchung“, ob es nicht von den Sinnen und der Erfahrung „unabhängige Erkenntnis gebe.“ Diese Erkenntnis nennt Kant a priori im Unterschied zu solchen, die ihre Quelle im empirischen haben, also aus der Erfahrung entspringen und a posteriori genannt werden. (II. 45) Wie die Quellen unserer Erkenntnis, die sinnliche Wahrnehmung und Anschauung einerseits und der ordnende Verstand zusammenkommen, ist die Kernfrage, die sich in einem Satz verdichtet: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“ (II. 58 f.)
Um den Argumentationsweg dorthin nachvollziehbar zu machen, bedarf es einiger einführender begrifflicher Unterscheidungen. (II. 52 ff.) Erkenntnis unabhängig aller Erfahrung nennt Kant a priori (von vornherein = priori = früher), Erkenntnis aus Erfahrung heißt a posteriori (von post = im Nachhinein). Da Erkenntnisse sich sprachlich in Sätzen ausdrücken, die in der Logik als Urteile fungieren, bedarf es zunächst einer Unterscheidung zweier Urteilsarten. Alle Urteilssätze bestehen (grammatikalisch wie logisch) aus einem Subjekt und Prädikat. Kant unterscheidet zunächst Wahrnehmungsurteile von Erfahrungsurteilen. Erstere gelten nur für das einzelne empirische Subjekt, ihnen kann durchaus „Subjektives“ anhaften. (z.B. „Das Bild ist schön.“) Damit alle unsere Wahrnehmungsurteile aber in „Erfahrungsurteile“ mit objektiver Gültigkeit überführt werden können (z.B. „Das Bild ist bunt.“), müssen „alle Urteile über denselben Gegenstand auch untereinander übereinstimmen“ und so bedeutet die „objektive Gültigkeit des Erfahrungsurteils nichts anderes, als die notwendige Allgemeingültigkeit desselben.“ (III, 163 f.)
Kant unterscheidet die Urteile in analytische und synthetische. Analytische Urteile sind solche, wo das Prädikat im Subjekt schon enthalten ist. (z.B. „Der Schimmel ist weiß.“). Solche Urteile enthalten keinen zusätzlichen Informationswert und auch keine Empirie, sie sind unabhängig von jeder Erfahrung und somit apriorische Urteile. Sie heißen auch Erläuterungsurteile und sind eigentlich „Tautologien“.
Das synthetische Urteil ist dagegen ein „zusammengesetztes“ oder „erweitertes“, d.h. das Prädikat sagt über ein Subjekt etwas aus, was nicht schon begrifflich im Subjekt vorhanden ist. (z.B. „Der Schimmel ist schnell.“) Es ist ein Erweiterungsurteil, da es zur Erweiterung unserer Erkenntnis (aus der Erfahrung) beiträgt. Kombiniert man die Urteilsformen mit den Erkenntnisformen, dann ergeben sich vier Varianten: Analytische Urteile sind a priori und synthetische a posteriori möglich. Analytische Urteile a posteriori sind widersinnig und somit unmöglich und so kommen wir zu der für Kant alles entscheidenden Frage: Sind synthetische Urteile a priori möglich?
Und mit der Beantwortung dieser Frage, an der David Hume scheiterte, wird zugleich die Frage beantwortbar: Wie ist reine Mathematik und reine Naturwissenschaft möglich? (II. 59) Was an dieser Stelle mit der Begründung der Bedingung der modernen mathematischen Naturwissenschaft eingeführt wird, verbindet sich an anderer Stelle mit der notwendigen Begrenzung des gänzlich auf Empirie verzichtenden Dogmatismus und der damit einhergehenden „Rettung“ einer Metaphysik, die dann als „Wissenschaft wird auftreten können“. Allerdings führt Kant die Metaphysik nicht als notwendige Wissenschaft, sondern als eine menschliche „Naturanlage“ ein, die dem Umstand geschuldet ist, dass es in der menschlichen Natur liege, Fragen zu stellen, wie Anfang und Ende der Welt, Freiheit des Willens, Unsterblichkeit der Seele, Existenz Gottes, die allesamt Fragen der Leistungsfähigkeit der Metaphysik aufwerfen, die für die Beantwortung dieser Fragen zuständig ist und bleibt. (II. 60 f.)
Das System der Transzendental-Philosophie
Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt unter dem Titel der Transzendental-Philosophie. Damit ist nichts Esoterisches, Übersinnliches gemeint. Transzendental nennt Kant alle unsere Erkenntnis, die sich in den Worten Kants nicht sowohl mit den Gegenständen der Erkenntnis, sondern mit „unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll“, beschäftigt. (II. 63) Transzendental heißt „übersinnlich“ nur insofern, dass damit keine psychologische oder biologische Analyse des Erkenntnissubjekts angestrebt wird. Es ist vielmehr die Zergliederung der Gesetzlichkeit der Erkenntnisgehalte selbst, wovon die transzendentale Methode ausgeht. Die „Transzendental-Philosophie“ enthält den gesamten „architektonisch Plan“ dessen, was das „System aller Prinzipien der reinen Vernunft“ ausmacht. (II. 64)
Der sich daraus ergebenden Plan des Gesamtgebäudes der Erkenntnis lässt sich entlang der drei Elemente der Logik in eine Hierarchie der Erkenntnisstufen bringen. Die drei Elemente der Logik sind die Lehre vom Begriff, vom Urteil und die Lehre von den richtigen Schlüssen. Sie dienen als Basis eines Aufbaus einer Hierarchie der Erkenntnisstufen. Im untersten Stockwerk sitzt die Sinnlichkeit, sie bringt subjektive Wahrnehmungen und Urteile hervor, die sich der Verallgemeinerung entziehen. Von diesen rein subjektiven Wahrnehmungsurteilen (dieses ist schön, süß etc.) unterscheiden sich (objektive) Erfahrungsurteile, die verallgemeinerbar sind und sie liefern die Mannigfaltigkeit des Anschauungsmaterials, das ist jener Stoff, den eine Etage höher der Verstand in Begriffen erfasst, ordnet und zu Urteilen verknüpft. Die Verknüpfung der Urteile zu Schüssen fällt dann der obersten Etage zu, die von der Vernunft bewohnt wird. Sie ist die höchst Stufe der Erkenntnis, denn aus der Verknüpfung der Urteile durch die richtigen logischen Schlüsse generiert sie aus Bekanntem bis dahin Unbekanntes, eine neue Erkenntnis. Die Vernunft wird so zur Krone der Wissenschaft, wenn sie aus ihren Schlüssen neues Wissen schafft.
Systematisch teilt sich die gesamte Transzendental-Philosophie in eine Elementar– und eine Methodenlehre. Die Transzendentale Elementarlehre, die den größten Teil einnimmt, eröffnet den Argumentationsgang mit der Transzendentalen Ästhetik, das ist die „Wissenschaft von allen Prinzipien der Sinnlichkeit a priori.“ (II. 70) Sie macht den ersten Teil der „transzendentalen Elementarlehre“ aus. Es mag diesem ersten Teil, der sich unter dem Begriff der Ästhetik nicht dem uns gebräuchlichen Reich des Schönen widmet, sondern im weitesten Sinne seiner ursprünglichen Bedeutung der Sinnlichkeit und Anschauung folgt, hilfreich sein, wenn man ihm als zweiten Teil gleich die Transzendentale Logik erwähnend zur Seite stellt. Der erste Teil liefert die Anschauungsformen aller Erkenntnis, der zweite die Denkformen.
Die transzendentale Ästhetik oder Raum und Zeit
Die Suche nach den Prinzipien der Sinnlichkeit a priori nennt Kant also die transzendentale Ästhetik. Kant entdeckt zwei reine Formen sinnlicher Anschauung als Prinzipien unserer Erkenntnis: Den Raum als äußeren Sinn, und die Zeit als inneren Sinn. Beide entspringen nicht der Erfahrung, sondern begleiten unsere Wahrnehmung immer schon. Der Raum wird vorgestellt als „unendliche gegebenen Größe“, die für uns nicht „Begriff“, sondern „Anschauung a priori“ ist. (II. 73) Was wir im Raum anschauen, sind „Erscheinungen“ von Dingen, aber eben nur die Erscheinungen, nicht die Dinge selbst. Deren „wahres Correlatum“, das „Ding an sich selbst“ wird dadurch gar nicht erkannt und kann auch gar nicht erkannt werden, „nach welchem aber auch in der Erfahrung niemals gefragt wird.“ (II. 78)
Und gleich dem Raum ergeht es der Zeit. Auch sie ist kein „empirischer Begriff“, der aus irgendeiner Erfahrung „abgezogen“ werden könnte. Sie ist in der Ordnung von „zugleich“ und verschiedener Zeit als „nach-einander“ eine Vorstellung a priori und „als reine Form der sinnlichen Anschauung“ notwendig. (II. 78 ff.)
„Zeit und Raum sind demnach zwei Erkenntnisquellen, aus denen a priori verschiedene synthetische Erkenntnisse geschöpft werden können, wie vornehmlich die reine Mathematik in Ansehung der Erkenntnisse vom Raume und dessen Verhältnissen ein glänzendes Beispiel gibt.“ (II. 84) Beide zusammengenommen sind sie „reine Formen aller sinnlichen Anschauung, und machen dadurch synthetische Sätze a priori möglich.“ (II. 84 f.) Aber dadurch, dass sie als Erkenntnisquellen a priori „bloße Bedingungen der Sinnlichkeit“ sind, bestimmen sie die Grenze, die darin liegt, nur die Erscheinungen der Gegenstände und Dinge, nicht aber die „Dinge an sich selbst“ darzustellen. (II. 85) Doch daraus resultiert für Kant keine Beeinträchtigung der Erkenntnisleistung, denn die „Realität des Raumes und der Zeit läßt übrigens die Sicherheit der Erfahrungserkenntnis unangetastet: denn wir sind derselben genau so gewiß, ob diese Formen den Dingen an sich selbst, oder nur unsrer Anschauung dieser Dinge notwendiger Weise anhängen.“ (II. 85) In diesem Abschnitt wird Kants Teilung der Welt in eine der „Erscheinungen“, die er auch „Phaenomena“ und der uns verborgen bleibenden Welt der „Dinge an sich“, die er die „Noumena“ nennt, entfaltet.
Dass Raum und Zeit allein die beiden Elemente der transzendentalen Ästhetik sind, begründet Kant damit, dass „alle andren zur Sinnlichkeit gehörigen Begriffe, selbst der der Bewegung, welcher beide Stücke vereinigt, etwas Empirisches voraussetzten“. (II. 86) Denn „im Raum an sich selbst betrachtet ist nichts Bewegliches“, somit müsse das als etwas zusätzlich Empirisches dem Raum durch Erfahrung beigegeben werden. Gleiches gilt für den Begriff der Veränderung, der in den Bereich er Zeit fällt. Aber die Zeit selbst verändere sich nicht, folglich komme auch die Veränderung nur durch etwas Empirisches in die Zeit, aber nicht die Veränderung durch sich selbst. (II. 86)
Das Ergebnis der Suche nach den Prinzipien der Sinnlichkeit a priori, also das, was Kant die transzendentale Ästhetik nennt, führt uns dahin, dass Raum und Zeit die beiden reinen Formen der sinnlichen Anschauung als Prinzipien unserer Erkenntnis sind. Der Raum ordnet alle Gegenstände der Erfahrung nebeneinander, die Zeit nacheinander, ohne selbst als räumlich oder zeitlich zu erscheinen. Beide entspringen nicht der Erfahrung, sondern begleiten alle unsere Wahrnehmung immer schon, sie sind daher auch keine Begriffe des Denkens, sondern haben reinen Anschauungscharakter.
Kategorien sowie Raum und Zeit sind also Formen, die unsere Erfahrungen strukturieren, diesen vorausgehen, nicht zeitlich, sondern logisch. Das Erkennen mit Sinnen und aus Erfahrung ist kein passiver Prozess, sondern sie hängen von den Strukturen der Wahrnehmung ab, die wie Filter wirken. Dieser Gedanke drängt sich schon mit Blick auf alle Lebewesen rein physiologisch auf, aber darauf kommt es Kant genau nicht an. Es geht nicht um die psychologischen und biologischen Grundlagen der menschlichen Erkenntnis, sondern um die „Logik“ des Erkenntnisprozesses als Denkvorgang selbst. Es geht um die Selbstreflexion des Denkens als theoretische Vernunft und ihre Grenzen.
Karl R. Popper hat in seiner Gedenkrede zu Kants hundertfünfzigsten Todestag Kants Ausgliederung von Raum und Zeit als erfahrbare Größen erläutert. Sie gehören nicht der empirisch wahrnehmbaren Welt der Dinge und Vorgänge an, obwohl sie in beiden Dimensionen als Werke der Quantifizierung Triumphe feiern. Aber die Messungen sind gerade der Beweis dafür, dass die Messformen nicht aus der Erfahrung resultieren, sondern vom erkennenden Subjekt der „Natur“ vorgeschrieben werden. Nach Kant sind Raum und Zeit Teile jenes Rüstzeugs des Verstandes, mit denen die reale Welt geordnet wird und dieses Ordnungssystem muss sich immer wieder in den Grenzen der Erfahrungen als Erkenntnismittel bewähren. Insofern gehören Raum und Zeit zu jenen „Kategorien“, die all unseren Erfahrungen immer schon vorausgehen und sie begleiten, denn jenseits von ihnen gibt es keine Erfahrung von Dingen oder einem Etwas, weil alles nur in den Dimensionen von Raum und Zeit ist und stattfindet. (s. Popper 1957) Deshalb sind m.E. die späteren Einwände im Lichte der Relativitätstheorie gegen das „A priori“ von Raum und Zeit als Voraussetzung aller Erfahrung nicht zwingend.
Die transzendentale Logik
Jede Erkenntnis hat zwei Standbeine: Sinnlichkeit und Verstand. Sie bedingen einander. Und so folgt auf die transzendentale Ästhetik nun die transzendentale Logik als Äquivalent. Ihr Gegenstand ist der Verstand als Ordnungsinstanz.
„Unsere Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, d.i. die Art enthält, wie wir vom Gegenstand affiziert werden.“ Der Verstand ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken. „Keine sinnliche Eigenschaft ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe blind. (…) Beide Vermögen, oder Fähigkeiten, können auch ihre Funktionen nicht vertauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann Erkenntnis daraus entspringen.“ (II, 97 f.) Für die weitere Analyse vollzieht Kant eine Scheidung der Ästhetik, als der Wissenschaft von den Regeln der Sinnlichkeit überhaupt von der Logik, als der Wissenschaft von den Verstandesregeln überhaupt.
Daraus entwickelt er nun Ordnungsfaktoren, die er unter Abstraktion von jeglichem Urteilsinhalt als bloße Verstandesformen unter vier Titeln „Funktionen des Denkens“ benennt. Ihnen entsprechen jeweils reinste Begriffe, die rein sind, weil sie keinen empirischen Inhalt haben. Sie werden von Kant Kategorien genannt. Einer Tafel der Urteile in der formalen Logik stellt Kant eine daran angelehnte Tafel der Kategorien zur Seite. Die zwölf Urteilsformen bzw. Kategorien, die Kant in begrifflicher Anlehnung, aber nicht dem Inhalt nach, an Aristoteles entwickelte und sich nicht sicher war, ob sie damit auch abgeschlossen seien, werden hier nebeneinandergestellt und durch Beispielsätze „veranschaulicht“.
Urteilstafel Beispielsatz Kategorientafel
Quantität Quantität
Allgemeine Alle M. sind sterblich Allheit
Besondere Einige Menschen sind Frauen Vielheit
Einzelne Frau Arm ist reich Einheit
Qualität Qualität
Bejahende Das Haus ist hoch Realität
Verneinend Das Haus ist nicht hoch Negation
Unendlich Das Haus ist keine Kirche Limitation
Relation Relation
Kategorische Der Kreis ist rund Substanz-Akzidenz
(unbedingtes U.)
Hypothetische Wenn die Sonne scheint, Ursache-Wirkung
(bedingtes U.) erwärmt sich der Boden
Disjunktive Der Hund ist entweder ein Pudel Wechselwirkung
(ausschließendes U. oder Dackel oder…
Modalität Modalität
Problematisches Heute könnte Schnee fallen Möglichkeit -Unmöglichkeit
(vermutendes U.)
Assertorisches U. Es wird heute schneien Dasein – Nicht Dasein
(behauptendes U.
Apodiktische Ich werde irgendwann sterben Notwendigkeit – Zufall
(notwendiges U.
Vor einer Definition der Kategorien hat sich Kant aus guten Gründen gedrückt: „Der Definition dieser Kategorien überhebe ich mich (…) geflissentlich, ob ich gleich im Besitz derselben sein möchte.“ (II. 120) Ihm war die logische Unmöglichkeit bewusst, denn die Kategorien sind „Letztbegriffe“, die nicht mehr durch andere, allgemeinere Begriffe als besondere abgeleitet und dadurch definiert werden können. Es ergeht ihnen wie beispielsweise dem Begriff des „Seins“, auch er ist als Allgemeinbegriff nicht durch andere bestimmbar, weil nicht begrenzbar, denn „definieren“ impliziert „unterscheiden“.
Bei Aristoteles lieferten die Kategorien die Einteilung der Welt, sie waren das Grundgerüst seiner Ontologie. Den letzten Versuch dieser Art hat im zwanzigsten Jahrhundert m. W. Nicolai Hartmann unternommen. Hartmann kritisiert an Kants Kategorien, da er keine Ontologie anstrebte, fungieren sie bei ihm nur als „unverbindliche Reflexionsbegriffe“. (Hartmann, 210) Der Bezug auf diesen gänzlichen anderen Zugang mit den gleichen Begriffen, verdeutlicht die Andersartigkeit des Kantschen Ansatzes.
Die Kategorien sind für Kant reine Ordnungsfunktionen des Verstandes, keine Mittel zur Kategorisierung der Welt. Sie führen ins Zentrum dessen, was Kant seine „kopernikanische Wende“ nannte. Wir ordnen unsere Erfahrungen nach den Regeln unseres Verstandes. D.h. wir nehmen nicht passiv die Realität durch unsere Sinne vermittelt in unserem Denken auf. Während Aristoteles seine Kategorien auf Objekte bezog, gibt es bei Kant nicht Kategorien, weil es Objekte gibt, sondern es gibt Objekte, weil wir sie durch unsere Kategorien erst konstituieren. Wir prägen mit unserem Verstand wie ein Stempel Kategorien – z.B. die der Kausalität – in das Rohmaterial der sinnlichen Wahrnehmung hinein und finden sie dann in der Wahrnehmung wieder.
Es gibt also keine von uns getrennte Realität, die wir mit den Kategorien und unseren Verstandesformen erfassen, sondern wir erkennen nur das, was wir vorher mit unseren Denkformen in die Realität hineingelegt haben. Deshalb kommt Kant zu der Schlussfolgerung, dass wir die Dinge an sich nicht erkennen können. Mit diesem Schluss hat Kant das erkennende Subjekt und sein Erkenntnisvermögen zum Schlüssel unseres Weltverständnisses gemacht. Wir nehmen die Dinge wahr, wie sie uns erscheinen, aber nicht wie sie uns rein sinnlich, sondern wie sie uns durch unsere Denkformen erscheinen. Die synthetische Leistung, Anschauungen und Begriffe zu verbinden, kommt also weder aus den Sinnen noch aus den Objekten. Aus der Erfahrung kann ich nicht wissen, dass jede Wirkung eine Ursache hat, die Kausalverknüpfung entspringt unseren Denkformen und im Lichte dieser Denk- und Verstandesformen erscheinen uns die Objekte der Welt so wie sie für uns sind. Wir erkennen also nur das in der Welt, was wir zuvor in sie hineingelegt haben.
Damit hat Kant die Methode und die daraus folgende Weltsicht der modernen Naturwissenschaften beschrieben. Wir gelangen zu den allgemeinen Naturgesetzen nicht durch rein sinnliche Wahrnehmung, sondern indem wir der Natur experimentell begegnen, d.h. wir manipulieren sie für unsere Erkenntniszwecke. So gesehen gibt es nicht die Gesetze der Natur, sondern der erkennende Mensch ist ihr Gesetzgeber, der durch seine Denkformen die Natur „macht“, um sie dann so zu erkennen, wie sie ihm an sich zu sein scheint. In dem Wort Tatsache drückt sich das eigentlich aus, denn die Tat ist die Beigabe des erkennenden Subjekts zur Kreation der Sache, die erst durch uns zum Faktum wird. Wie Fischer ihre Netze in den See oder das Meer werfen und dadurch nur das fischen, was in die Netze geht, so werfen wir unser Erkenntnisvermögen in die Welt und fangen nur das ein, was in dieses passt.
Indem Kant die Identität von Denken und Sein nicht nur nicht voraussetzt, sondern geradezu bezweifelt, rückt die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis an den Anfang. Darin besteht seine kritische Methode. Bevor wir etwas über die Welt aussagen, müssen wir uns Rechenschaft ablegen über die Möglichkeiten und Grenzen unserer Erkenntnis. Die Erkenntnis richtet sich also nicht nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände richten sich nach unserer Erkenntnis. Diese scheinbar absurde Konsequenz widerspricht unserer unmittelbaren (naiven) Weltsicht aber genauso wie die Erkenntnis des Kopernikus, die Sonne drehe sich nicht um die Erde (oder den Zuschauer), sondern umgekehrt. Die Selbstprüfung der Vernunft und des Erkenntnisvermögens, somit die Erkenntnistheorie wird nun zur wichtigsten Teildisziplin der Philosophie.
Mit Kants Verkehrung der Weltsicht vom Objekt auf das erkennende Subjekt ist die Philosophie als klassische Ontologie (Lehre vom Seienden) am Ende. Fortan setzt die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft und Erkenntnis mit der kritischen Selbstreflexion unseres Erkenntnisvermögens an. Aber damit ist das schwindelerregende Werk des Denkens bei Kant noch nicht beendet, denn nun folgt die Prüfung der theoretischen Vernunft. So wie der Verstand mit seinen Kategorien unsere Anschauungen regiert, so herrscht die Vernunft noch über den Verstand. Mit ihr prüft er die Grenzen der Metaphysik. Es ist in der Metapher des Gerichtsverfahrens jener kritische Punkt, wo die Selbstbetrachtung der Vernunft sie zu ihrem Ankläger, Angeklagten und Richter zugleich macht.
Die große Herausforderung ist nun innerhalb des Kantschen Systems, wie schafft es der reine Verstand, die empirische Mannigfaltigkeit der Anschauungen unter die richtige der zwölf Kategorien zu subsumieren. Eine ausführliche Begründung für diese zwölf Kategorien gibt es nicht. Versuchen wir die Verbindungsleistung dieser Kategorien mit dem chaotischen Anschauungsmaterial durch den Verstand zu erklären, begeben wir uns in das Kapitel der Transzendentalen Deduktion der Verstandesbegriffe. Es gehört unbestritten zum schwierigsten Teil des insgesamt schon schwierigen Werkes. In dem großen Gedankengebirge Kants stehen wir hier vor einem Berg, den nicht wenige Kant-Darstellung gern „überspringen“. Auch für unsere Zwecke erscheint dieser Berg in dem Gedankengebirge als zu steil und zu hoch, insbesondere für eine kurze und einfache Darstellung bietet sich eigentlich eine Umwanderung an. Wer sie bevorzugt, lasse das folgende Teilstück hinter sich.
Die Idee der „Transzendentale Deduktion der Verstandesbegriffe“
Versuchen wir es also ohne einen geübten Bergsteiger, d.h. in diesem Falle, einen guten Didakten, den weiteren Pfad zu erkunden. Hilfreich ist da ausgerechnet eine Autorität wie Hegel, der zwar schon den Ausdruck „Transzendentalphilosophie“ für barbarisch hielt (Hegel, 337) und Kants erster großer Gegner wurde, der sich aber anbietet, da er in knapper Form durch dieses Kapitel führt. Allein es ist zu bezweifeln, ob es für sich allein auch nur dem groben Verständnis dieses Teiles dienlich wäre. Angesichts dieser Skepsis, folgen wir weiter dem Kantschen Original mit gelegentlicher Hilfe Hegels.
Der Ausgang ist, wie die Mannigfaltigkeit der Anschauungen mit dem reinen Verstand der Kategorien zur Erkenntnis verbunden werden. Diese Synthese geschieht durch die „transzendentale Apperzeption des Ichs.“ „Apperziepieren ist mehr die Tätigkeit, wodurch etwas in mein Bewußtsein gesetzt wird.“ (Hegel, 343 f.) In Kants Worten heißt es „das Vermögen des Bewusstseins überhaupt“ inclusive des Verstandes und der Vernunft, aus dem die „allgemeingültige und notwendige Einheit aller Verstandes- und Vernunfterkenntnisse“ resultieren. „Synthesis“ nennt Kant die Verbindung der mannigfaltigen Anschauungen und Begriffe. „Aber der Begriff der Verbindung führt außer dem Begriffe des Mannigfaltigen, und der Synthesis desselben, noch den der Einheit desselben bei sich. Verbindung ist Vorstellung der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen.“ (II. 135) Entscheidend ist aber, dass diese „Einheit“, die a priori „vor allen Begriffen der Verbindung gedacht werden muss, aber nicht als „Kategorie“ auftritt, denn diese „Einheit“ müsse als „qualitativ“ höhere gesucht werden und wird in demjenigen gefunden, „was selbst den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urteilen, mithin die Möglichkeit des Verstandes, sogar in seinem logischen Gebrauche, enthält.“ (II. 136) Und diese scheinbar rätselhafte „höhere Einheit“ hat auch einen Namen: „Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können.“ (II. 136) Dass Hegel dieses „Ich soll begleiten“ eine „barbarische Exposition“ nennt, sei nur am Rande erwähnt. (Hegel, 343)
Damit hätten wir den Übergang zu einem empirischen Subjekt als Träger des gesamten Erkenntnisprozesses, ohne dieses könnte die zentrale Verknüpfungsleistung gar nicht vollzogen werden. Das heißt aber nicht, dass Kant hier nun (endlich) in eine „empirische Psychologie“ springt. Die Entdeckung des Ichs ist kein Schritt in unsere vertraute Welt, es ist nur ein Schritt der Logik. Man könnte dieses Ich auch ein „transzendentales Ego“ nennen.
Wir bleiben also im Abstrakten. Alle „mannigfaltigen Anschauungen“ haben eine „notwendige Beziehung“ auf dieses „Ich denke“ und diese Vorstellung ist „ein Actus der Spontaneität“, die als „reine“ und nicht als empirische „Apperzeption“ das „Selbstbewußtsein“ ist, „indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alles andere muß begleiten können, und in allem Bewußtsein ein und dasselbe ist.“ Das ist die „transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen.“ (II. 136) Die „synthetische Einheit der Apperzeption (ist) der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganz Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie (sich) heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst.“ (II. 137)
Was nun folgt ist eine auf knappen Raum nicht mehr erzählbare Reise aller Beziehungen des Denkens und der Anschauungen zum denkenden Ich, einschließlich dessen Selbsterkenntnis, wenn es sich selbst zum Objekt seiner Anschauung macht und zwischen dem unterscheidet, wie man ist und wie man sich selbst erscheint. (II. 152 f.) Doch das ist schon fast alles, was uns noch „alltagsvertraut“ erscheint.
Die Quintessenz lautet, dass die notwendige Übereinstimmung der Erfahrung mit den Begriffen von ihren Gegenständen nur so gedacht werden könne, dass entweder die „Erfahrung macht diese Begriffe, oder diese Begriffe machen die Erfahrung möglich.“ (II. 158) Ersteres ist ausgeschlossen, denn die Kategorien sind Begriffe a priori. Woraus folgt, dass die „Kategorien von Seiten des Verstandes die Gründe der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt enthalten.“ (II. 158) Wie sie dann aber Erfahrung überhaupt ermöglichen, das erklärt der „transzendentale Gebrauch der Urteilskraft“.
An dieser Stelle beendet Kant eine wesentliche Form seiner Darstellung: die „Paragraphen-Abteilung“. Sie sei nun nicht mehr nötig, da es nicht mehr um Elementarbegriffe gehe. (II. 159)
In der weiteren Darstellung finden wichtige Begriffe wie die Einbildungskraft (II. 175 f.), die die Mannigfaltigkeit der Anschauung in ein „Bild“ bringt, ihren Einzug, um die Vermittlung der Kategorien mit den Anschauungen zu ermöglichen. Der Dreiklang der formalen Logik Begriff, Urteil und Schluss trifft nun auf Verstand, Urteilskraft und Vernunft. Herausgenommen wird die Prüfung der Urteilskraft als dem Vermögen, zu unterscheiden, ob etwas unter eine Regel subsumierbar ist oder nicht. Die Urteilskraft soll zeigen, wie reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen angewendet werden können. Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, dass diese Fähigkeit, etwas unter Regeln zu identifizieren, nicht gelehrt, sondern nur „geübt sein will.“ (II. 184) Damit die Übung sich nicht gänzlich der präzisen begrifflichen Ordnung entzieht, wird sie dem „Schematismus der reinen Verstandesbegriffe“ übergeben.
In der Kurzfassung Hegels lautet der Argumentationsgang so: Der denkende Verstand ist die Quelle der Kategorien, das sind die ganz allgemeinen Denkbestimmungen. Für sich sind diese leer, sie werden gefüllt durch den Stoff der Anschauungen und die bilden deren Inhalt. „Sie sind die Beziehung, das In-Einheit-Setzen der mannigfaltigen Stoffe, und haben nur Bedeutung durch ihre Verbindung mit diesen Stoffen. Diese Erfüllung kommt uns aus der Sinnlichkeit, der Wahrnehmung, Anschauung, dem Gefühle usf. Dieser Inhalt, als das Mannigfaltige, wird vom Verstand auf seine Weise verbunden, durch die transzendentale Apperzeption des Ich synthetisiert; und das ist Erkenntnis, Erfahrung.“ (Hegel, 346) Erfahrung ist aber etwas anderes als Wahrnehmung, erst wenn diese unter die Kategorien gebracht sind, kommt die synthetisierende Leistung des Ich zum Tragen.
Der Übergang der Kategorien in die Empirie, wie reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen angewendet werden können, erfolgt durch die transzendentale Urteilskraft.
„Im Gemüte, Selbstbewußtsein sind also reine Verstandesbegriffe und reine Anschauungen; die Beziehung beider aufeinander ist der Schematismus des reinen Verstands, die transzendentale Einbildungskraft, welche die reine Anschauung, der Kategorie, dem reinen Verstandesbegriffe gemäß, bestimmt, so den Übergang zur Erfahrung macht.“ (Hegel, 347)
Wer Kant bis in seine Untiefen studieren will, wird auch an dem Schematismus nicht vorbeikommen, den wir uns hier ersparen und den Experten anheimgeben.
Die Grenzen der reinen Vernunft und der Glaube
Bevor wir zu einer Gesamtbetrachtung der Kantschen Erkenntnistheorie übergehen, müssen aber zwei Teile der Kritik der reinen Vernunft noch unbedingt erwähnt werden. Da ist zum einen das Kapitel der „Antinomien“ der reinen Vernunft, die auf der „negativen“ Seite, das ist die der Transzendentalen Dialektik untergebracht sind. Es sind jene Sätze über Fragen, die zu sich widersprechenden Aussagen führen und logisch gemäß dem Satz vom Widerspruch nicht entschieden werden können, weil sie außerhalb der Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung angesiedelt sind. (II. 399 ff.) Was Kant „negativ“ mit Dialektik als Widerspruch, also dem logischen Grundsatz, dass zwei sich widersprechende Aussagen nicht zugleich wahr sein können, verbindet, wird für Hegel positiv gewendet als Motor eines Prozesses, der sich gerade durch „Widersprüche“ entwickelt. Die Negativität der Dialektik als Begriff (oder gar als Wort) entsteht bei Kant aus dem antiken Verständnis dieses Begriffs, der dort als „Logik des Scheins“ verbunden mit der „Sophistik“ einen üblen Ruf hatte.
Logisch gehört für Kant in diese Kategorie auch die Diskussion über die Beweisgründe des „Daseins eines höchsten Wesens“, auch Gott genannt. (II. 523 ff.) Beide besiegeln die Grenzleistungsfähigkeit der reinen Vernunft, weil sich die Beweisgründe widersprechen und logisch nicht entscheidbar sind. In dem Fall der Antinomien wäre möglicherweise die Fragestellung als unsinnig abzuweisen, wie wenn man darüber streiten wolle, ob ein „hölzernes Eisen“ brennen könne. Die Antwort lautet ja, wegen des Holzes und nein, wegen des Eisens.
Mit den Gottesbeweisen verlassen wir bei Kant aber das Spielfeld solcher Logeleien. Hier endet für ihn die Gemütlichkeit, denn diese Frage ist ja, wie wir aus der ersten Vorrede schon erfahren haben, Folge einer „Naturanlage“ des Menschen, sich Fragen zu stellen, die nicht beantwortbar seien. Die Gottesbeweise gehören sicherlich zu diesen Fragen und enden wie die Antinomien. Die Existenz Gottes lässt sich nicht beweisen, dafür erhielt er wahrscheinlich den erwähnten Ehrenplatz auf dem Index der verbotenen Bücher des Vatikans. Aber auch nicht widerlegen, dass erboste die Freidenker. Zwar sprach bei seiner Beerdigungsfeier auf seinen Wunsch kein Pfarrer, aber es muss einen Grund abseits der Logik gegeben haben, warum er in der zweiten Vorrede bekannte: „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“ (II. 33). Damit vollzog Kant die strikte Trennung von Glauben und Wissen, woraus man den Vorteil ableiten könnte, was man nicht wissen könne, darüber lasse sich auch nicht streiten. Faktisch ist es leider eher umgekehrt.
Warum Kant dieses Thema überhaupt mit aufgenommen hat, ergibt sich bestenfalls aus der unterstellten „Naturanlage“, die solche Fragen dem Menschen aufdrängt. Logisch betrachtet untersucht Kant in den Gottesbeweisen nicht den Gott einer (monotheistischen) Religion, sondern einen noch weit abstrakteren „himmlischen Vater, der dort droben übern Himmelszelt“ wohnen muss, einem unpersönlichen Schöpfergott, der eher an den „unbewegten Beweger“ Aristoteles‘ erinnert. Wahrscheinlich liegt die Antwort in der zum Ende des Werkes in Aussicht gestellten und für Kants gesamte Philosophie wesentlichen Frage: Was sollen wir tun und was dürfen wir hoffen? (II. 677)
In der praktischen Vernunft, seiner Moralphilosophie, die auch den Titel einer Metaphysik der Sitten trägt, dem Herzstück seiner Philosophie. werden Gott und der Religion zumindest noch funktionale Dienste zugestanden. Die absolut gebietende praktische Vernunft kann die Tugend der Pflicht für die Realisierung des Sittengesetzes aus eigener Kraft nicht garantieren, da ist die durch Glauben autorisierte Hilfe des höchsten Herrn vielleicht nicht unerlässlich, aber sicherlich hilfreich.
Dieser „letzte Zweck der reinen Vernunft“, nachdem sie ihre Selbstbegrenzung erfahren hat, erfüllt sich erst in dem zentralen philosophischen Anliegen Kants, wo die Vernunft zur absoluten Herrschaft aufsteigen kann: im Reich des Sollens. Die praktische Philosophie verlässt die rauen Berge der Selbstkritik der Vernunft, wo kein Wanderer heimisch wird und führt uns ins Tal des grünenden Hoffnungsglücks, wo die lebenswichtigen Fragen nach dem, was wir tun sollen, einer Antwort harren. Kants Antworten wurden im vierten Teil mit der Darstellung der praktischen Vernunft schon skizziert.
Was leistet die Kritik der reinen Vernunft?
Was Kants primär reflexive Erkenntnistheorie im engeren Sinn leistet, ist schwer zu entscheiden. Hegel, der ihr schärfster Gegner war, hat sie nahezu persifliert: „Das Erkenntnisvermögen untersuchen heißt, es erkennen. Die Forderung ist also diese: Man soll das Erkenntnisvermögen erkennen, ehe man erkennt; es ist dasselbe wie mit dem Schwimmenwollen, ehe man ins Wasser geht. Die Untersuchung des Erkenntnisvermögens ist selbst erkennend, kann nicht zu dem kommen, zu was es kommen will, weil es selbst dies ist, – nicht zu sich kommen, weil es bei sich ist.“ (Hegel, 334) Abseits dieser kryptischen Wendung am Ende, heißt das: Kants Unternehmen beißt sich logisch in den Schwanz und ist als solches unsinnig. Man könnte es auch abwandeln, wer das Denken erklären will, muss immer bedenken, dass er schon denkt. Was man erklären will, wird als Tätigkeit vorausgesetzt, da droht ein unendlicher Regress, ein Zirkel bzw. die Unmöglichkeit eines Anfangs. Letztlich galt Hegels Kritik dem Primat der Erkenntnistheorie selbst, dem er eine von Kant überwunden geglaubte „Onto-Logik“ entgegensetzte. Hegels Kritik ist eine Kritik aus der Perspektive einer völlig anderen Vorstellung von Philosophie und nicht nur philosophiegeschichtlich von großer Relevanz. Wir lassen sie hier auf sich beruhen und widmen uns einer „mehr immanenten“ kritischen Würdigung der Kritik der reinen Vernunft.
Die zentrale Frage, ob „synthetische Urteile a priori“ möglich seien, wurde erwartungsgemäß mit Ja beantwortet. Das war eine Feststellung gegen die Empiristen und eine Zufluchtsstätte für die „geliebte“ Metaphysik, die nun als Wächterin über die Grenzen der reinen Vernunft auftrat. Wozu aber die modernisierte Form der Metaphysik jenseits des verhassten Wolffschen Dogmatismus überhaupt noch erhalten werden muss, selbst wenn sie sich zur alten Metaphysik verhält wie die Astronomie zur Astrologie oder die Chemie zur Alchemie, bleibt eigentlich ein Rätsel, außer man rekurriert auf Kants „Liebe“ zur Metaphysik. Aber dafür hat er sie etwas zu gründlich zertrümmert.
Da mit der ersten Frage auch die anderen mit beantwortet sind, also reine Mathematik und Naturwissenschaft erwartungsgemäß „möglich“ sind, bietet sich die Chance, Kants Antwort auf die Krise der Erkenntnisgewissheit wegweisend als theoretische Grundlage eines „positivistischen Wissenschaftsbegriffs“ zu lesen, wie Theodor W. Adorno vorschlug. Für ihn war Kant zwar ein Revolutionär, der aber keinesfalls alles Vergangene hinter sich ließ. (Adorno; 66) So bleibt die Vorliebe für die erneuerte Metaphysik eine Erblast, die sich angesichts der rigorosen Selbstkritik der Vernunft fast als eine sprachliche entpuppt. Adorno sieht in Kants Werk im Wesentlichen die philosophische Begründung der modernen Naturwissenschaft in erkenntnistheoretischer Form, auch wenn sie sich streckenweise im Kostüm der Metaphysik präsentiert.
Der Angriff auf die traditionelle Logik erfolgt erst später im 19, Jahrhundert, in dem sie durch den Einfluss der Mathematik zur Logistik wird. Einer der Begründer dieser „mathematischen Logik“ war Bertrand Russell, der auch einer der schärfsten Kritiker Kants war. Er hielt nicht nur „das Ding-an-sich für ein unglückliches Element in Kants Philosophie.“ (Russell, 727) Russell hält den gesamten Bau der Kantschen Erkenntnistheorie für nicht tragfähig und in sich widerspruchsvoll. Schon die Konstruktion, Raum und Zeit als „Formen der Anschauung“ zu betrachten und dabei einen absoluten Raum zu unterstellen, analysiert er als unhaltbar, ganz unabhängig davon, dass diese Vorstellungen mit der veränderten Raum-Zeit-Konstellation durch die Relativitätstheorie wissenschaftlich überholt seien. Das Manko Kants besteht darin, dass er der Ansicht ist, „der Verstand ordne den Rohstoff der Empfindung, hält es aber nicht für nötig zu erklären, warum er ihn so und nicht anders ordne.“ (Russell, 725)
Auch Adorno hat sich tendenziell dieser „szientistischen“ Kritik angeschlossen und gegen Kant geltend gemacht, dass die Relativitätstheorie die Apriorität eines absoluten Raumes und einer absoluten Zeit ebenso erschütterte wie die Quantentheorie die Lehre von der Kausalität. Aber andererseits verteidigt er die Kritik der reinen Vernunft gegen „einige philosophische Richtungen“, die sie als großen „Popanz“ abschreiben, denn ihr gebühre immer noch „denkbar großes Interesse.“ (Adorno, 13) Adorno bedient das Missverständnis, Kant habe eine auf die naturwissenschaftliche Forschung bezogene Theorie der Wissenschaft liefern wollen, und er suggeriere damit für die künftige Wissenschaft ein einheitliches „positivistisches“ Wissenschaftsideal nach dem Vorbild der modernen Physik. Von daher müsste es eigentlich erstaunen, dass es im 19. Jahrhundert, wie auch danach, keine große Menge Naturwissenschaftler gab, die versuchten, Kants Erkenntnistheorie für ihre Forschungspraxis fruchtbar zu machen.
Kant ging es um die Frage, was wir wissen können. Die exakte Naturwissenschaft war eher ein Vehikel, eine absolute Wahrheit als Messlatte der Vernunft voraussetzen zu können, hinter die es kein Zurück gibt. Das heißt, es kann kein Wissen geben, das nicht die Möglichkeit dieser Wahrheit der mathematischen Naturwissenschaft impliziert. Heute könnte man diese Bedingung ausdehnen auf die Ergebnisse der Wissenschaft allgemein. Die Philosophie konstituiert keine Wissenschaften, sie reflektiert sie bestenfalls. Diesem Funktionswandel der Philosophie im Verhältnis zu den „positiven“ Wissenschaften war Kant zu seiner Zeit schon viel näher. Das Wissen, das Kant zu erkunden sich anschickte, reichte aber weiter als das Wissen, was der Wissenschaft damals wie heute vorschwebt.
Was bringt in diesem Darstellungskontext Kants transzendentale „Begriffshuberei“, wenn ich das mal so unflätig karikieren darf? Theodor W. Adorno hat in seinen Vorlesungen über Kants „Kritik der reinen Vernunft“ 1959 deutlich gemacht, das Neue bei Kant sei mitnichten die Entdeckung der „synthetischen Urteile a priori“, sondern dass es ihm allein um die „Prüfung“ der „Gültigkeit von bereits als geltend vorausgesetzten Urteilen“ ging. (Adorno, 51) Kant betreibe „eine Art von gigantischer Buchprüfung, die nun feststellen will, wieso diese Erkenntnisse, die zunächst einmal wirklich vorausgesetzt werden, die da sind, wieso die wirklich gültig sind, – ohne daß aber Kant den Versuch machen würde, sie nun selber aus reinem Denken oder aus der spekulativen Philosophie heraus zu entwickeln. (Adorno, 51) Das neue bei Kant ist, dass der Prüfungsprozess der Bedingungen der positiven Wissenschaften in einer kritischen Selbstreflexion der Vernunft in einer Analyse des Erkenntnisvermögens und der Erfahrung mündet. Und in dieser kritischen Selbstreflexion der Vernunft sieht Adorno die „Kopernikanische Wende“. Aber das sei nicht als eine Hinwendung ins Subjektive zu verstehen, denn diese soll gerade reflexiv auf ihre Möglichkeiten und Grenzen bestimmt werden, damit so das Subjekt zum „Schöpfer, jedenfalls der Garant“ von Objektivität wird. (Adorno, 56) Die „Kopernikanische Wende“ führt also weder in einen Subjektivismus noch – modern gesprochen – Konstruktivismus, sondern ist das Ergebnis der tiefgründigsten Selbstreflexion der Vernunft darüber, was das erkennende Subjekt mittels seiner Vernunft aktiv in den Erkenntnisprozess mit einbringt. Denn Erkenntnis ist nicht einfach die Widerspiegelung der realen Welt in unserem Verstand durch die sinnliche Wahrnehmung.
Gelingt es einem vor diesen Hintergrund der mühsamen Arbeit an den Begriffen der transzendentalen Ästhetik, Analytik und Dialektik tiefere Einsichten in die verschiedenen Schichten und Bereiche des Erkenntnisprozesses zu gewinnen, bleiben am Ende Fragen.
Die Bedeutung Kants in unserer Zeit
Der Erkenntnis, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, ist die kritische Prüfung und Selbstbefragung der menschlichen Vernunfterkenntnis vorgeschaltet. Kant, die Personifizierung des Vernunftgedankens in der Zeit der Aufklärung, hat die großen Leistungen dieses „Vermögens“ des Menschen umfassend herausgearbeitet, aber auch zugleich seine Grenzen aufgezeigt. Jenseits dieser hat er ein „Reich des Glaubens“ freigelegt, das nicht nur vom „Glauben“ der Religionen gefüllt wird. Es ist auch ein Refugium eines weiten Feldes von „Weltanschauungen“, Pseudowissenschaften und einer Menge von Weltdeutungen, die Chesterton einmal so erklärte: Seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, ist es nicht so, dass sie nichts mehr glauben, sondern alles! Der „Irrationalismus“ als Begleiterscheinung zur Durchrationalisierung unserer modernen Lebenswelt ist das grassierende Unheil auch unserer Gegenwart. Wie wir damit umgehen und fertig werden, ist vielleicht im tiefsten Sinne „unsere Schicksalsfrage“.
Kant hat das Problem der Wahrheit und die Bedingungen der Erkenntnis wohl nicht endgültig gelöst, was schon allein die immer weiter gehende Debatte nach ihm bis zum heutigen Tage zeigt. Aber er hat den Streit auf ein Niveau und eine Reflexionshöhe gebracht, unter das man ernsthaft nicht wieder unterhertauchen kann. Wer sich also auf dieses schwierige Gebiet begibt, wird sich an dem extrem hohen Standard von Kants Kritik der reinen Vernunft messen lassen müssen.
Das gilt auch für die doppelten Leseweise des Titels. In der Kritik der reinen Vernunft steckt einerseits eine Kritik im Namen der reinen Vernunft und andererseits wird sie zum Gegenstand der Kritik. Mit der Selbstprüfung der Vernunft steigt ihr Wert, sie wurde zum Inbegriff der Aufklärung und zum Ideal des Menschen. Auch wenn sie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts schon auf eine Gegenbewegung stieß, die vor allem in der Literatur einen neuen Zeitgeist ankündigte. Es war das Unbehagen an der Vorherrschaft des Verstandes, der Vernunft, des Rationalismus und die Herabsetzung des Gefühls, der Empfindungen und auch des Irrationalen. In Deutschland nannte sich diese Bewegung „Sturm und Drang“, zu ihnen gehörten anfangs auch Goethe und Schiller. Beide verabschiedeten sich schon bald von dieser später in der Romantik endenden Bewegung. Gegen diesen Abfall von der Vernunft bis hin zur offenen Feindschaft ließ Goethe im Faust I Mephisto vor der „Schülerszene“ die Mahnung ausstoßen:
Verachte nur Vernunft und Wissenschaft,
Des Menschen allerhöchste Kraft,
Laß nur in Blend- und Zauberwerken
Dich von dem Lügengeist bestärken,
So hab‘ ich dich schon unbedingt – (Faust I, Vers 1851-1855)
Dem fügte Immanuel Kant am Ende seiner kleinen, schon im Oktober 1786 in den Berlinischen Monatsschrift erschienen Abhandlung Was heißt: Sich im Denken zu orientieren? mit ungewohntem Pathos sein intellektuelles Credo hinzu, das auch unser Manifest für die Gegenwart sein könnte:
„Freunde des Menschengeschlechts und dessen, was ihm am heiligsten ist! Nehmt an, was euch nach sorgfältiger und aufrichtiger Prüfung am glaubwürdigsten scheint, es mögen nun Facta, es mögen Vernunftgründe sein; nur streitet der Vernunft nicht das, was sie zum höchsten Gut auf Erden macht, nämlich das Vorrecht ab, der letzte Probierstein der Wahrheit (R.W.) zu sein. Widrigenfalls werdet ihr, dieser Freiheit unwürdig, sie auch sicherlich einbüßen, und dieses Unglück noch dazu dem übrigen schuldlosen Teile über den Hals ziehen, der sonst wohl gesinnt gewesen wäre, sich seiner Freiheit gesetzmäßig und dadurch auch zweckmäßig zum Weltbesten zu bedienen.“ (III. 282 f.)
Literatur:
Adorno, Theodor W.; Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Berlin 2022
Böhme, Hartmut & Böhme, Gernot; Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants. Frankfurt a.M.1996 (1983)
Cassirer, Ernst; Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchen über die Grundfragen der Erkenntniskritik. Darmstadt 1980 (1910)
Cassirer, Ernst; Philosophie der Aufklärung. Tübingen 1973 (1932)
Cassirer, Ernst; Descartes. Lehre – Persönlichkeit – Wirkung. Hamburg 1995
Fischer, Kuno; Immanuel Kant und seine Lehre. Erster Theil: Entstehung und Grundlegung der kritischen Philosophie. Heidelberg 1898, vierte neu bearbeitete Aufl.
Hartmann, Nicolai; Der Aufbau der realen Welt. Grundriss einer allgemeinen Kategorienlehre. Berlin 1964, 3. Aufl.
Hazard, Paul: Die Herrschaft der Vernunft. Das europäische Denken im 18. Jahrhundert. Hamburg 1949
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. III.
in ders. Werke Bd. 20, Frankfurt a.M. 1971
Hieber, Lutz: Die aristotelische Naturphilosophie und der epistemologische Bruch der neuzeitlichen Wssenschaft, in: L. Hieber / R.W. Müller (Hg.): Gegenwart der Antike. Frankfurt / New York 1982, S. 170 – 183
Kaulbach, Friedrich; Immanuel Kant. Berlin 1969
Popper, Karl R.; Immanuel Kant. Der Philosoph der Aufklärung. In: ders. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde I., Bern 1957, S. 9 – 19
Russell, Bertrand; Philosophie des Abendlandes. Ihr Zusammenhang mit der politischen und der sozialen Entwicklung. Wien 1975 (1950)
Weizsäcker, Carl Friedrich von: Große Physiker. Von Aristoteles bis Werner Heisenberg. München 1999
Literatur von Kant:
Kant, Immanuel: Kant Werke. Hg. Wilhelm Weischedel, Bde. I. bis VI. Frankfurt a.M. 1964, römische Ziffern ist die Bandangabe, arabische Ziffern die Seitenzahlen. Die gleiche Seitenangabe findet sich jeweils in zwei Halbbände unterteilt in der 12 Bände umfassenden Ausgabe im Suhrkamp Verlag in der „stw“ Reihe, nach der hier zitierten Ausgabe gilt dann Band I. = 1. und 2, Band II. = 3. und 4. etc.
Gedanken über die wahre Schätzung der lebendigen Kräfte (1746 / 1749), I. 7 – 218
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755), I. 219 – 400
Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), I. 919 – 990
Kritik der reinen Vernunft (1781 / 1787), II. 9 – 712
Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783), III. 109 – 264
Was heißt sich im Denken orientieren? (1786), III. 265 – 284
Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen (1800), III. 417 – 582
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), IV. 645 – 879
Kritik der Urteilskraft (1790), V. 235 – 620