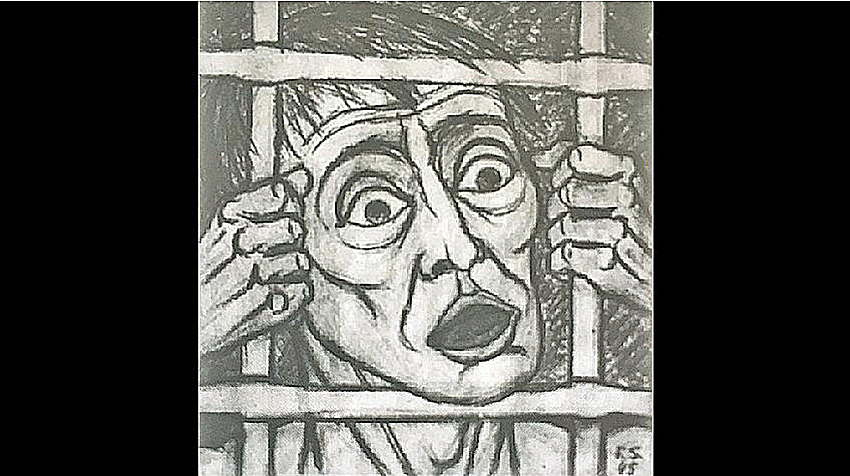Hintergründe der öffentlichen Kranzniederlegung um 11:00 Uhr, Nähe Marcks-Skulptur vor der Kunsthalle
Auch Osnabrück würdigt am 20. Juli jene Opfer des Widerstands gegen die NS-Terrorherrschaft, die unmittelbar und in den Folgewochen des sogenannte Stauffenberg-Attentats ermordet wurden. Vergessen wird dabei oft, dass – speziell auch in Osnabrück – die Opfer vor allem aus der sozialistischen Arbeiterbewegung kamen.
Gern erzählte Legenden
Es zählt zu den gern erzählten Nachkriegslegenden, dass sich Widerstand gegen das Nazi-Regime vor allem in einer angeblich ehrbaren Deutschen Wehrmacht befunden hätte. Auch in Osnabrück dürfte sich nachhaltig der Eindruck halten, rund 200 zum Tode verurteilte Angehörige der Wehrmacht unter Führung von Generaloberst von Stauffenberg hätten im Zuge der Geschehnisse am 20. Juli 1944 die absolute Vorrangrolle im Kampf gegen die Nazi-Diktatur eingenommen.
Dass im Zuge der anschließenden „Aktion Gewitter“ eine weit größere Zahl, nämlich über 5.000 eingekerkerte und vielfach im KZ ermordete Nazi-Opfer aus der sozialistischen Arbeiterbewegung stammte, die – im Gegensatz zu den bürgerlichen Kräften um Stauffenberg – bereits vor 1933 aktiv gegen die Nationalsozialisten gekämpft hatten, gerät dagegen häufig in Vergessenheit. Die OR möchte sich bewusst dieser Menschen anlässlich des Gedenkens an den 20. Juli 1944 – 81 Jahre sind seither vergangen – annehmen.
Im Rückblick: Das Stauffenberg-Attentat
Erinnern wir uns: Das Stauffenberg-Attentat, geschehen am 20. Juli 1944, gilt als letzter von mehreren gescheiterten Versuchen, Reichskanzler Adolf Hitler zu töten und – in diesem Fall getarnt als „Operation Walküre“ – einen Staatsstreich gegen das nationalsozialistische Regime durchzuführen.
Wichtig ist: Der bekannteste Attentäter, Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, ist niemals Demokrat gewesen. Im Gegenteil: Noch Jahre zuvor galt er als überzeugter zunächst Anhänger des Nationalsozialismus, von dessen Rassenlehre und der NS-Kriegsziele. Im Kern der eigenen Zielvorstellung standen andererseits – wie auch bei seinem Bruder Berthold, Lehren des antidemokratischen Theoretikers Stefan George (1868-1933).
Der wiederum hatte in seinem Spätwerk „Das neue Reich“ anno 1928 verkündet, dass eine hierarchische Gesellschaftsreform auf der Grundlage einer neuen geistig-seelischen Aristokratie aufgebaut werden müsse – ohne allerdings, trotz deren Anwerbeversuchen, NSDAP-Anhänger zu werden. Stauffenberg hatte Ende 1933 gemeinsam mit seinem Bruder der Beisetzung Georges beigewohnt.
Stauffenbergs letzte Worte „Es lebe das Geheime Deutschland“ gelten als demonstrativer Treueschwur für die George-Lehren. Der Historiker Eckhart Grünewald definiert dies mit eigenen Worten als Bekenntnis zu einer Gruppe von Personen, die jenes Geheime Deutschland verkörpern oder verheißen.
Wie auch immer: Der Generaloberst hatte sich lange vor dem Tag des Attentats zu einer vorwiegend von Wehrmachtsoffizieren gebildeten Widerstandsgruppe gesellt, zu dem sich rechtkonservative Kreise, aber auch prinzipienfeste Sozialdemokraten wie Julius Leber, Wilhelm Leuschner oder Adolf Reichwein zählten.
Stauffenberg platzierte eine Bombe während einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier Wolfsschanze. Doch Hitler überlebte das Attentat mit nur leichten Verletzungen. Einig waren sich die Attentäter gewesen, das NS-Regime zu stürzen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Der gescheiterte Staatsstreich führte zur Verhaftung und Hinrichtung vieler Beteiligter, darunter Stauffenberg und seiner engsten Mitarbeiter.
Hunderte weiterer Personen wurden in den folgenden Monaten wegen Beteiligung oder Mitwisserschaft hingerichtet. Die genannten Sozialdemokraten Leber (er gilt als politischer Ziehvater Willy Brandts), Leuschner und Reichwein zählten ebenso zu den Opfern der von NS-Chefankläger Freisler bestialisch geführten Prozesse und der folgenden Hinrichtungen.
Die „Aktion Gewitter“ – indirekte Folge des Stauffenberg-Attentats
Eine „Aktion Gewitter“ war in Ansätzen bereits zuvor vom Reichsführer der SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, geplant worden. Der gescheiterte Umsturzversuch vom 20. Juli verschärfte jedoch aus NS-Sicht die Notwendigkeit, sich bereits präventiv solcher Menschen zu entledigen, die in einer Nicht-NS-Regierung eine Rolle als Demokraten und Fachleute des Wiederaufbaus hätten spielen können.
Gesagt, getan: Am 17. August 1944 ergingen gleichlautende Telegrammen an sämtliche Staatspolizeistellen im Deutschen Reich, um die „Aktion Gewitter“ anzuordnen. Danach waren „alle früheren Reichstags- und Landtagsabgeordneten sowie Stadtverordneten der KPD und SPD im Reich festzunehmen.“
Am 22. August 1944 begannen die Razzien in den frühen Morgenstunden. Die Festgenommenen wurden reichsweit „in Schutzhaft“ genommen, etliche nach Zwischenstationen in Konzentrationslager deportiert, wo viele von ihnen ermordet wurden.
Reichsweit waren von der Verhaftungswelle, wie oben beschrieben, mehr als 5.000 frühere demokratische Funktionsträger betroffen. Über die genannte Verhaftungswelle hatte Dieter Przygode bereits einmal in der OR umfangreich berichtet.
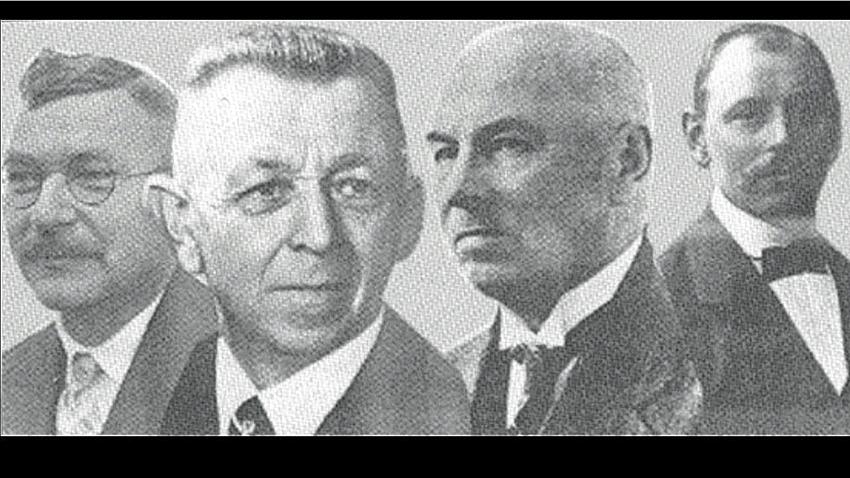
Osnabrücker Opfer
Ob sich unter den nach dem 20. Juli ermordeten Militärs ein Osnabrücker befunden hat, ist bislang in der historischen Forschung nicht eingehend bekannt geworden. Sehr wohl bekannt sind allerdings die Opfer der sogenannten „Aktion Gewitter“, die aus den Reihen Osnabrücker Sozialdemokraten und Kommunisten stammten.
Aus einer Anzahl von rund 100 Verhafteten, die zunächst bei der Gestapo im Schloss, danach im „Arbeitszuchtlager“ Ohrbeck inhaftiert worden waren, wurden am Ende gezielt Menschen zur Deportation ins KZ Neuengamme ausgewählt. Die Selektion traf jene, von denen man besonders befürchtete, dass sie in einem neuen Deutschland hätten wichtige Funktionen ausfüllen können. Die folgend aufgeführten Osnabrücker Sozialdemokraten, die jährlich in der Feier am 20. Juli von der Osnabrücker SPD geehrt werden, überlebten die Tortur ihrer Deportation ins KZ nicht und sind bereits in der OR im Rahmen ausführlicher Beiträge (gern anklicken) beleuchtet worden. Alle Texte befinden sich in erweiterter Form auch im von der OR für den ILEX-Kreis herausgegebenen Band „“Widerstand im Osnabrück der NS-Zeit“. Folgende Menschen sind dort vermerkt:
- Wilhelm Mentrup, vormals couragierter Inspektor der Allgemeinen Ortskrankenkasse
- Heinrich Groos, vormaliger Arbeitsamtsdirektor
- Heinrich Niedergesäß, vormals SPD-Parteisekretär
- Fritz Szalinski, Sozialdemokrat und vormals Bevollmächtigter des Metallarbeiterverbandes
Das „Gedenkbuch der Sozialdemokratie“ nennt allein 48 Namen von prominenten Politiker*innen, die – wie die oben genannten – bei der ,,Aktion Gitter‘‘ ums Leben kamen. Besonders tragisch ist das Schicksal der Häftlinge, die – wie Mentrup und Niedergesäß – aus Neuengamme kommend auf die Schiffe „Cap Arcona“ und „Thielbek“ getrieben wurden. Am 3. Mai 1945 wurden beide Schiffe von einem britischen Tiefflieger versenkt. Tausende starben in der Ostsee.
Ebenfalls nicht vergessen werden darf der ebenfalls im Zuge der „Aktion Gewitter“ verhaftete Kommunist August Wille, der wie Mentrup und Niedergesäß in der Lübecker Bucht umkam. Auch die junge Kommunistin Lissy Rieke wurde zwar bereits 1943 inhaftiert und gefoltert, jedoch erst Ende 1944 verurteilt und am 5. Januar des Folgejahres in Dortmund hingerichtet.

Was man tun kann
Am Sonntag, 11 Uhr, findet, wie in jedem Jahr in jüngster Zeit, unmittelbar vor der Kunsthalle eine öffentliche Kranzniederlegung statt. Redner für die Osnabrücker SPD wird dabei OB-Kandidat Robert Alferink sein.
Gut gewählter Ort
Prägend für den Ort ist eine dort seit 1964 stehende Skulptur. Gerhard Marcks (1889–1981) Werk „Der Gefesselte“ zeigt einen Mann auf einem hohen Sockel. Er ist gefesselt und trägt nur einen Lendenschurz.Sein Körper ist sehr dünn und sein Gesicht ausdruckslos.
Gewissermaßen ist die Marcks-Arbeit das genaue Gegenstück der von Bildhauer Richard Scheibe (sein Name steht auf der nationalsozialistischen „Gottbegnadeten-Liste“ ihnen genehmer NS-Künstler) geschaffene Figur im Berliner Bendler-Block. Bei Marcks und seinem Werk hatte sich die sozialdemokratisch geführte Stadtregierung dazu entschlossen, einen leidenden statt einen muskulösen, heroisch blickenden Menschen zu zeigen.
Zwar sollte die Figur ursprünglich auch an Menschenrechtsverletzungen in der damaligen DDR (Mauerbau, 17. Juni) erinnern. Dennoch wird das Mahnmal seit langer Zeit vornehmlich für antifaschistische Gedenkveranstaltungen genutzt.
Wer sich alles zur Marcks-Skulptur auch visuell wie akustisch aneignen möchte, darf gern in ein Frühwerk der OR-Filmkunst schauen